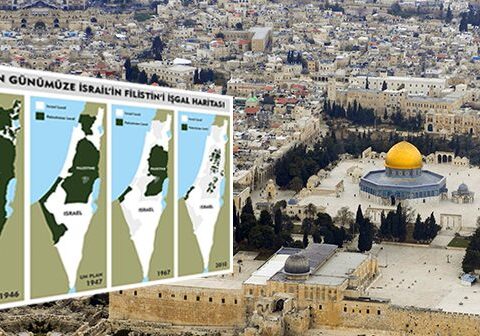Historische Statistiken sind oft unzuverlässig
Die Geschichte wurde vor langer Zeit aus politischen Gründen als akademische Disziplin instrumentalisiert. In den meisten Ländern diente die Geschichtsschreibung traditionell dem jeweils herrschenden politischen Regime. Zeiten, in denen sie relativ unabhängig arbeiten konnte, sind äußerst begrenzt. Darüber hinaus wurde in den letzten Jahren der Stellenwert der Geschichte im Bildungssystem erheblich reduziert, um Platz für „Klimareligion“, Geschlechterideologie und die Woke-Bewegung zu schaffen.
Dennoch gibt es immer noch Tausende von Studierenden, die an Universitäten und Hochschulen Geschichte studieren. Doch auch in diesen Institutionen wird der Lehrplan von politischer Korrektheit, Wokeismus und verpflichtenden kollektiven Selbstkritik-Diskursen geprägt. In der westlichen Welt wird den Studierenden beigebracht, sich für die Ungerechtigkeiten vergangener Generationen gegenüber den dunkelhäutigen Völkern der Dritten Welt schuldig zu fühlen. Je mehr Zeit für Ideologie, künstliche Gefühle und Nebenthemen aufgewendet wird, desto weniger bleibt für die wirklich wichtigen Aspekte der Geschichte.
Geschichte lebt immer von Fakten, doch genau diese Fakten in der notwendigen Zuverlässigkeit darzustellen, ist äußerst schwierig. Um Fakten aufzudecken und zu verifizieren, sind Archivforschungen erforderlich – doch was, wenn die benötigten Daten überhaupt nicht existieren, weder dort noch anderswo? Leider kommt diese Situation recht häufig vor.
Je weiter man in der Zeit zurückgeht, desto geringer wird die Zuverlässigkeit der Daten. Nehmen wir zum Beispiel Bevölkerungsstatistiken. Für die meisten europäischen Länder gibt es zumindest seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, in manchen Fällen sogar noch früher, einigermaßen verifizierbare und zuverlässige Bevölkerungsdaten. Je weiter man jedoch zurückgeht, desto fragmentarischer werden diese Daten. Außerhalb Europas verhält es sich ähnlich.
Einige große Fragen werden für immer unbeantwortet bleiben. Zum Beispiel ist es absolut unmöglich zu sagen, wie viele Menschen vor nur fünfhundert Jahren, um das Jahr 1500, in der Neuen Welt lebten. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass zu jener Zeit einige europäische Seefahrer, Entdecker und Abenteurer den amerikanischen Kontinent betraten – der erste davon war Christoph Kolumbus im Jahr 1492. Doch als Kolumbus in der Karibik ankam, wussten wir nicht, wie viele Ureinwohner dort oder in anderen Teilen der Neuen Welt lebten.
Die Frage, wie groß die indigene Bevölkerung bei der Ankunft der Europäer war, wurde zu einem Gegenstand intensiver akademischer Spekulationen, als ausländische Wissenschaftler begannen, Lateinamerika systematisch und strukturell zu untersuchen. In den 1920er Jahren waren sich der deutsche Geograph Karl Sapper (1866–1945) und der amerikanische Archäologe Herbert Spinden (1879–1967) einig, dass die Gesamtbevölkerung Amerikas zwischen 40 und 50 Millionen gelegen haben müsse. In den 1930er Jahren schätzte der amerikanische Kulturanthropologe Alfred Kroeber (1876–1960), dass nur 8,4 Millionen Menschen auf dem amerikanischen Kontinent lebten, davon 7,5 Millionen im heutigen spanischsprachigen Amerika. 1964 schlug der Historiker Woodrow Borah (1912–1999) vor, dass die Bevölkerung Amerikas 1492 „über 100 Millionen“ betragen haben könnte. Danach schätzte 1966 der amerikanische Professor Henry Dobyns (1925–2009) die Gesamtbevölkerung auf 112,5 Millionen, davon 100,3 Millionen im spanischsprachigen Amerika. Mich hat immer erstaunt, wie selbstbewusst dieser Anthropologe so genaue Zahlen bis in Dezimalstellen angab. Wie ist diese Genauigkeit möglich? In den 1980er Jahren bestätigte der niederländische Agrarhistoriker Bernard Slicher van Bath (1910–2004) mit seiner Schätzung von etwa 35 Millionen die frühen Schätzungen von Sapper und Spinden.
Alles, was wir über die Bevölkerung Amerikas um 1500 „wissen“, beruht also auf diesen Schätzungen. Anders gesagt: Wir haben keinerlei sichere Informationen, und alle Schätzungen basieren nur auf Annahmen – beispielsweise zur landwirtschaftlichen Produktivität pro Hektar. Wir wissen nicht, wie viele Menschen lebten, als der portugiesische Seefahrer Pedro Álvares Cabral 1500 Brasilien erreichte, ebenso wenig wie bei Hernán Cortés‘ Landung in Mexiko 1519 oder Francisco Pizarros Eroberung Perus 1533.
Die frühesten und relativ konkreten Bevölkerungsdaten für Lateinamerika stammen aus der Zeit um 1575 und sind in den Arbeiten des spanischen Hofhistoriografen Juan López de Velasco (1530–1598) enthalten. Zu jener Zeit betrug die Gesamtbevölkerung aller spanischen Kolonien etwa neun Millionen, wobei die Mehrheit aus indigenen Amerikanern bestand, die damals noch „Indianer“ genannt wurden. Zudem gab es etwa 160.000 Spanier, die entweder in Spanien oder Amerika geboren waren.
Daher variiert das Ausmaß des demografischen Zusammenbruchs in Amerika je nachdem, welchen „präkolumbianischen“ Bevölkerungszahlen man Glauben schenkt. Im Jahr 1992, dem fünfhundertsten Jahrestag von Kolumbus‘ erster Reise, die sowohl in Europa als auch Amerika als „Entdeckung Amerikas“ gefeiert wurde, behaupteten einige informationsarme, sensationslüsterne und offensichtlich von Schuldgefühlen getriebene Personen, dass Figuren wie Kolumbus, Cortés und Pizarro die „größten Verbrecher“ der Weltgeschichte seien — da sie für den Tod von fast hundert Millionen Menschen verantwortlich gemacht wurden. Deshalb wurden sie als schlimmer als Hitler, Stalin und Mao dargestellt.
Fast keiner der Historiker, die sich mit der Geschichte Lateinamerikas beschäftigen, hatte den Mut, solche unrealistischen und übertriebenen Behauptungen zu korrigieren. Diese Behauptungen basierten auf Märchen, nicht auf Fakten. Die wenigen, die widersprachen, wurden öffentlich kritisiert. Obwohl ihre Aussagen rechtlich völlig legitim waren, wie konnten sie es wagen, diese aufgeblasenen Zahlen in Frage zu stellen? Ein solches Verhalten wurde als Verhöhnung des Leids von Millionen und als Herabsetzung ihrer Erinnerung angesehen! Schlimmer noch, sie wurden des Leugners eines Genozids beschuldigt, selbst wenn dieser nur hypothetisch war, und mussten Spott, Ausgrenzung und mehr ertragen.
Offensichtlich basieren all diese Debatten auf erfundenen Zahlen. Dass diese Zahlen erfunden sind, hindert Menschen jedoch nicht daran, zu allen möglichen übertriebenen Schlussfolgerungen zu gelangen und absurde Erklärungen abzugeben. Tatsächlich gibt es keinerlei konkrete Beweise dafür, wie viele Menschen in der präkolumbianischen Zeit auf dem amerikanischen Kontinent lebten — ein Vergleich mit Bevölkerungsdaten anderer Zeiten und Regionen ist daher unmöglich. Insbesondere die bewusste Übertreibung der Gräueltaten der spanischen Eroberer in Amerika kann als weiterer Bestandteil der seit Jahrhunderten existierenden „Schwarzen Legende“ angesehen werden. Diese Erzählung wurde hauptsächlich von den historischen Gegnern Spaniens, wie England und den Niederlanden, konstruiert und verbreitet.
Die Geschichte Paraguays ist ein weiteres Beispiel für eine Debatte über übertriebene Bevölkerungszahlen und Massensterben. Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1814 entwickelte sich Paraguay unter seinen ersten drei Präsidenten wirtschaftlich und wurde zu einem Land, das von den Nachbarstaaten mit Neid betrachtet wurde. Brasilien und Argentinien, stark abhängig von britischer Finanzhilfe, betrachteten Paraguay als Bedrohung für ihre Interessen. 1864 brachten sie zusammen mit Uruguay Paraguay in einen Krieg. Dieser Krieg zerstörte die Wirtschaft des Landes und führte zum Tod von Tausenden Paraguayern. Lange Zeit kursierte die allgemein akzeptierte Information, dass die Bevölkerung Paraguays im Jahr 1864 bei 1,3 Millionen lag und durch den Krieg stark dezimiert wurde. Nach der Volkszählung von 1873, die unter Kontrolle der Siegerstaaten durchgeführt wurde, lebten jedoch nur noch etwa 221.000 Menschen in Paraguay.
1976 stellte der erste moderne Historiker, John Hoyt Williams (1940–2003), der sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigte, fest, dass die Bevölkerung Paraguays 1864 niemals 1,3 Millionen betragen haben konnte, sondern höchstens zwischen 375.000 und 575.000 gelegen haben müsse. Seine einfache Begründung: Die Bevölkerung hatte 1846 keinesfalls die Marke von 240.000 überschritten.
1988 bewies die amerikanische Historikerin Vera Blinn Reber mit soliden Beweisen und einwandfreier Logik überzeugend, dass die Bevölkerung Paraguays 1864 niemals 1,3 Millionen betragen haben konnte. Die wahrscheinlichste Zahl lag bei etwa 300.000. Ihr Artikel löste eine Welle des Entsetzens und Ärgers unter Lateinamerika-Experten weltweit aus.
Eine emotional aufgeladene und offen gesagt kindische Gegenschrift erschien 1990, verfasst vom amerikanischen Historiker Thomas Whigham (1955) und der deutschen Historikerin Barbara Potthast (1956). Diese beiden, geleitet von politischer Korrektheit und den damals aktuellen Trends im Fach, verteidigten die traditionelle Zahl von 1,3 Millionen für das Jahr 1864. Doch 1999 räumten sie angesichts ihrer überzogenen und fehlerhaften Reaktionen ein und schlossen sich den Forschungen von John Hoyt Williams an, indem sie angaben, dass die Bevölkerung Paraguays zur Kriegszeit zwischen 420.000 und 450.000 gelegen habe.
Eine weitere Debatte über historische Zahlen findet in Argentinien statt. 1976 führte das argentinische Militär einen Putsch durch, nachdem es die Zustimmung der USA erhalten hatte, und setzte Isabel Perón, die dritte Ehefrau von Juan Domingo Perón, der 1975 verstorben war, ab. Unter der Führung von General Jorge Rafael Videla übernahm ein Militärjunta bestehend aus Befehlshabern der Land-, See- und Luftstreitkräfte sowie zivilen Mitgliedern die Macht. Die Junta setzte den erbarmungslosen Kampf gegen städtische Guerillagruppen fort, der bereits Ende der 1960er Jahre begonnen hatte. Während der Präsidentschaft Peróns waren diese Guerilla-Aktivitäten in Buenos Aires und anderen Großstädten zu offenen Konflikten eskaliert, bei denen innerhalb von zwei Jahren mindestens tausend Aufständische getötet wurden. Nach dem Militärputsch wurde die Kampagne gegen die Guerilla mit voller Härte fortgeführt, und der Aufstand wurde innerhalb weniger Jahre niedergeschlagen. Während dieses Prozesses wurden jedoch tausende Regimegegner als „verschwunden“ gemeldet, und ihr Schicksal blieb ungeklärt.
Nach der Rückkehr zur Demokratie ernannte der argentinische Präsident Raúl Alfonsín den berühmten Schriftsteller Ernesto Sabato (1911–2011) zum Vorsitzenden der nationalen Kommission CONADEP, die das Schicksal der Verschwundenen untersuchen sollte. Laut dem offiziellen Bericht der Kommission „Nunca más“ („Nie wieder“) wurden während der Militärherrschaft etwa achttausend Argentinier als verschwunden gemeldet.
Dieses Ergebnis war für viele Menschen erschütternd, da verschiedene Schätzungen davon ausgingen, dass mindestens 30.000 Personen verschwunden seien. Trotz einer umfangreichen offiziellen Untersuchung wurde die ermittelte Zahl der Opfer als „überaus vorsichtig“ bezeichnet. Tatsächlich kursierte die Zahl 30.000 bereits, als das Militärregime noch an der Macht war. Verlässliche Quellen in Argentinien teilten mir mit, dass der Ursprung dieser Zahl in den Niederlanden liege: Funktionäre der örtlichen sozialistischen Partei hatten einer oppositionellen Delegation aus Argentinien empfohlen, die angebliche Zahl der Opfer der Junta auf 30.000 zu erhöhen, um Proteste und Empörung wirkungsvoller zu gestalten. Daher ist die Zahl von 30.000 Opfern reine Fiktion.
Das am meisten beunruhigende für einen echten Demokraten ist jedoch, dass selbst unter der demokratisch gewählten Regierung des Nationalhelden Perón und seiner Ehefrau mindestens tausend Menschen „verschwunden“ sind.
Heute, fast ein halbes Jahrhundert nach den Ereignissen, wird die Zahl 30.000 offiziell als die tatsächliche Zahl der Verschwundenen akzeptiert, wodurch die sorgfältig erarbeiteten Ergebnisse von CONADEP vollständig ignoriert werden.
Die Faszination und Leidenschaft für die hohe Zahl der Toten und Verletzten ist ein nur schwer erklärbares Phänomen. Es erinnert an eine Art Besessenheit, die man treffend als „Gewalt-Pornografie“ bezeichnen könnte. Warum erinnern Menschen sich mit solcher Begeisterung an vergangenes Leid? Warum neigen sie stets dazu, die Opferzahlen zu übertreiben? Fühlen sie sich moralisch überlegen, wenn sie Mitgefühl für das Leid anderer in der Vergangenheit zeigen? Warum sind sie so wütend gegenüber Andersdenkenden?
Da vernünftige Argumente, konkrete Beweise und fundierte historische Forschungen ihre Meinungen nicht ändern konnten, scheint die Faszination für vergangenes Leid fast alle Merkmale einer Religion aufzuweisen.
Quellen
Benjamin Keen und Keith Hayes, A History of Latin America (Boston/New York: Houghton Mifflin, 2000);
Hans Vogel, Geschiedenis van Latijns-Amerika (Utrecht: Spectrum, 2002).
John Hoyt Williams, „Observations on the Paraguayan Census of 1846“, Hispanic American Historical Review 56:3 (1976), S. 424–437.
Vera Blinn Reber, „The Demographics of Paraguay: A Reinterpretation of the Great War, 1864-1870“, Hispanic American Historical Review 68:2 (1988), S. 289–319.
Thomas L. Whigham und Barbara Potthast, „Some Strong Reservations: a Critique of Vera Blinn Reber’s ‘The Demographics of Paraguay: A Reinterpretation of the Great War, 1864-1870’“, Hispanic American Historical Review 70:4 (1990), S. 667-675.
Thomas L. Whigham und Barbara Potthast, „The Paraguayan Rosetta Stone: New Insights into the Demographics of the Paraguayan War, 1864-1870“, Latin American Research Review 34:1 (1999), S. 174–186.
CONADEP: Nunca Mas, der Bericht der Argentinischen Nationalkommission über die Verschwundenen, London: Farrar, Straus & Giroux, 1986.
Quelle: https://hansvogel.substack.com/p/numbers-in-history-the-case-of-latin