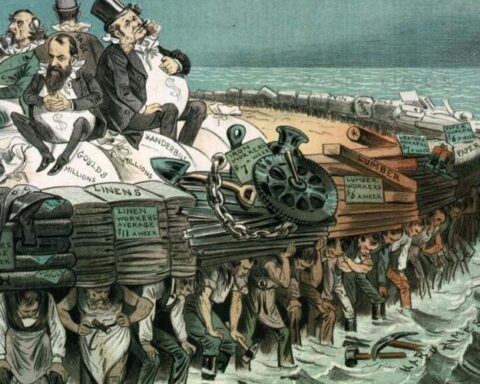Seit Langem hatte ich einen Freund nicht mehr gesehen, bis wir uns zufällig begegneten und ins Gespräch kamen. Gerade als wir uns verabschieden wollten, wurde er traurig und wollte mir von einem noch ganz frischen Kummer erzählen. „Seit ein paar Tagen kämpfe ich mit einer Scham, die mir den Schlaf raubt“, sagte er seufzend.
Ich fragte mich, was er getan haben könnte und was ihn so sehr verletzte und beschämte. Er schämte sich sogar, mir sein Leid zu erzählen…
Es ging um ein altes Haus, das vom Vater geerbt worden war. Gespräche innerhalb der Familie und eine ungerechte Aufteilung hatten ihn sehr beschämt. Es ging weder um das Haus noch um das Geld. Was in ihm Scham hervorrief, war die Tatsache, dass Menschen, mit denen er einst am selben Tisch saß, das gleiche Brot teilte, zusammen lachte und zusammen weinte, nun seine Kindheit, seine Familie und seine Erinnerungen verraten hatten.
Es war keine Wut, kein Zorn und auch keine Enttäuschung, was er empfand. Allein an diesen Gesprächen teilzunehmen, wie ein Beteiligter an Abrechnungen zu wirken, war für ihn an sich schon beschämend. Und er hatte sich einfach geschämt. Sogar im Namen der anderen!
Nach diesem Gespräch begann ich erneut, über dieses starke Gefühl nachzudenken, das mich schon seit Langem beschäftigt.
Vor vielen Jahren führte ich in der ungarischen Kleinstadt Kalocsa ein tiefes Gespräch über das Gefühl der „Scham“ mit einer etwa siebzigjährigen ungarischen Frau. Ich hatte eines ihrer wunderschönen, traditionell mit Kalocsa-Motiven verzierten Kleider anprobieren wollen. Als sie mir beim Anziehen helfen wollte, lehnte ich höflich ab.
Um ihr nicht weh zu tun, wollte ich meine Verlegenheit erklären – doch im Gegenteil, sie freute sich darüber und sprach dann sehr weise Worte:
„Früher schämten auch wir uns, uns in Gegenwart anderer auszuziehen und anzukleiden. Heutzutage kennt niemand dieses Gefühl mehr. Nacktheit gilt jetzt als große Kunstfertigkeit und als Freiheit. Indem sie dieses Gefühl zerstört haben, taten sie den Frauen das größte Unrecht. Und das auch noch durch die Frauen selbst…“
Sie hatte vollkommen recht …
In der Moderne hat man uns Frauen im Tausch gegen Freiheit und Gleichheit vor allem Nacktheit verkauft. Diese Idee – in Wahrheit nichts anderes als Exhibitionismus – wurde uns heimlich in unser Unterbewusstsein eingeschleust, neben die schönsten Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit, Recht und Gleichheit. Und sie hat zuerst unser Schamgefühl getötet.
Man überzeugte uns, dass wir frei sein würden, sobald wir unsere Hüllen ablegten. Die Intimsphäre der Frauen wurde sowohl zu einer kommerziellen als auch zu einer dämonischen Ware gemacht. Schließlich wurde das Recht der Frauen, sich nach eigenem Willen zu kleiden, leider in ein Recht verwandelt, sich nach Belieben zu entkleiden!
Wenn wir die Geschichte von Adam und Eva in den Heiligen Schriften lesen, ist es unmöglich zu übersehen, dass das erste Gefühl der Menschheitsgeschichte Scham war. Dass sie ihre Nacktheit erkannten und sich versteckten, war natürlich nicht nur ein körperliches Bedecken. Es war in gewisser Weise der Moment, in dem sie das menschlichste und moralischste aller Gefühle kennenlernten.
Das Gefühl der Scham ist etwas höchst Persönliches, es hat mit der Reinheit des eigenen Wesens zu tun. Es unterscheidet sich sowohl vom Mitgefühl als auch vom Gewissen. Mitleid oder Erbarmen – so menschlich diese Gefühle auch sind – bergen doch stets ein gewisses Maß an Überlegenheit, einen verborgenen Hochmut in sich. Denn wer Mitleid empfindet, blickt von außen, er ist nicht selbst der Leidtragende. Auch wenn er Anteilnahme zeigt, bleibt er letztlich ein Fremder. Da er nicht zu den wirklich Leidenden gehört, ist er dankbar – und diese Dankbarkeit ist für ihn tröstlich. Ist Scham ebenso? Nein. In ihr gibt es nicht das geringste Maß an Hochmut, Nutzen oder Egoismus. Sie ist das stärkste moralische Gefühl. Darum ist sie der mächtigste Hüter unserer Menschlichkeit und unserer Würde.
Besonders wertvoll ist Kants Sicht auf Moral und Scham. Seiner Auffassung nach empfindet der Mensch Verantwortung, weil er durch die in ihm wohnende, gesetzgebende Vernunft gebunden ist. Die eigentliche Scham entsteht, wenn der Mensch bemerkt, dass er das moralische Gesetz in sich selbst verraten hat. Scham ist nicht nur mit dem Blick Gottes oder der Außenwelt verbunden; sie bedeutet, in den Augen des eigenen Gewissens zu sinken. Kant zufolge ist Moral nur durch den Respekt des Menschen vor sich selbst möglich; die Scham ist der Wächter dieser Selbstachtung. „Tue das Gute, weil es gut ist, nicht weil Gott es will – denn gerade dann gefällt es Gott.“ Dieses moralische Prinzip umfasst auch, das Böse oder Beschämende nicht deshalb zu meiden, weil es verboten ist, sondern weil es böse, schändlich, beschämend ist. Moral verwandelt sich erst dann in das eigentliche Ziel der göttlichen Moral: den Respekt des Menschen vor sich selbst. Scham ist Selbstachtung.
Doch in unserer Zeit geht das Gefühl der Scham immer mehr verloren. In einer Welt, in der Exhibitionismus als Freiheit und Unverschämtheit als Mut gilt, wird Scham meist nur noch als ein gesellschaftlicher Skandal verstanden.
Seien wir ehrlich: Die größte Schande unserer Zeit, ja sogar dieses Jahrhunderts, ist der Völkermord, der vor aller Augen in Palästina geschieht. Der Genozid in Gaza ist nicht nur Ausdruck der stillschweigenden Mittäterschaft vieler Staatsoberhäupter und internationaler Institutionen, sondern auch das größte Beispiel kollektiver Schamlosigkeit.
Diese Schamlosigkeit gehört nicht allein Israel, das im Auftrag der USA und Großbritanniens einen Stellvertreterkrieg führt. Auch jene, die die Waffen für den Mörder liefern, die dem Teufel den Rücken stärken, sowie diejenigen, die das Unrecht nicht sehen oder nicht sehen wollen, sind die größten Schamlosen.
Im islamischen Denken bedeutet der Begriff Taqwa seinem Wortursprung nach „sich schützen, meiden, Vorsorge treffen“. Doch Meiden geschieht nur durch Scham. Im Koran wird Taqwa nicht allein als ein Phänomen individueller Frömmigkeit verstanden, sondern zugleich als zentrales Prinzip sozialer Gerechtigkeit, des Widerstands gegen Unterdrückung und der Wahrung des Rechts. So findet sich in der Sure Hûd die Aussage: „Neigt euch nicht den Ungerechten zu, sonst wird euch das Feuer treffen“ (11:113) – eine eindringliche Warnung für jene, die verstehen wollen.
Die wahren Gottesfürchtigen sind also nicht jene, die um eines Ziels oder Vorteils willen handeln, sondern jene, die allein deshalb das Böse meiden, weil es böse ist, und sich dafür schämen. Darum hat das Schweigen und die Gleichgültigkeit vieler muslimischer Staatsführer angesichts des Völkermords in Gaza viele von uns tief enttäuscht.
Gaza ist wie ein großer Spiegel, der jedem sein eigenes moralisches Porträt vor Augen führt. Das Gedächtnis der Menschheit und die Geschichte bewahren all diese Porträts sorgfältig. Und zweifellos wird unter diesen Porträts neben den Namen auch eine große Schande stehen.
In der islamischen Ethik gilt die Scham (hayâ) als Teil des Glaubens. Doch angesichts der Untätigkeit muslimischer Staaten gegenüber dem Unrecht in Gaza erleben wir, dass sowohl Scham als auch Taqwa ihrem eigentlichen Kern entfremdet worden sind. Wir haben zugleich erlebt, dass die Völker mancher westlicher Länder weit mehr Würde besitzen und in ihrer Haltung mitunter so viel Gottesfurcht zeigen wie ein wahrer Gläubiger – mehr als viele muslimische Machthaber.
Gerade die Fülle von Begriffen für Scham in den östlichen Kulturen – hicap, hayâ, ar, ayıp – zeigt uns, wie tief diese Empfindung in der moralischen Substanz verwurzelt ist. Jeder einzelne Ausdruck ist gleichsam eine andere Facette der Selbstbeherrschung. Diese Wörter lehren uns, dass Scham nicht bloß ein Gefühl ist, sondern ein großer Wert.
Und vielleicht gibt es für unsere Menschlichkeit noch Hoffnung. Vielleicht sind diejenigen, die Scham empfinden können, zahlreicher als die Schamlosen. In diesen schweren Zeiten brauchen wir alle mindestens ebenso sehr Scham wie Hoffnung und Glauben. Wenn wir angesichts all des Unrechts und der Grausamkeit nicht einmal mehr Scham über unsere bloße Existenz empfinden, dann hat auch das Dasein selbst keinen Sinn mehr.
Dass mein Freund sich im Namen seines Nächsten schämte, bedeutete, dass sein Vertrauen in die Menschlichkeit erschüttert war. Derjenige, der das Unrecht beging, schämte sich nicht – aber derjenige, der das Unrecht erfuhr, schämte sich an seiner Stelle. Sich selbst im Namen eines anderen zu schämen, ist eine Tugend. Denn Adam bedeutet: der Mensch, der Scham empfinden kann. Wer sich nicht mehr schämt, kann alles tun – so wie die Täter und die Zuschauer des Völkermords in Gaza. Für all jene, die sich für dieses Menschheitsverbrechen nicht schämen, empfinden wir inzwischen die Scham.