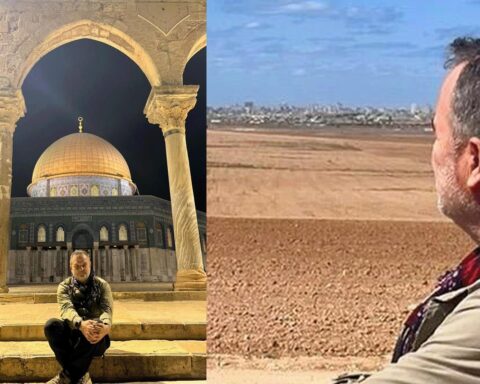Die Moderne wurde nicht nur als „Europa-zentriert“, sondern auch als „Menschen-zentriert“ bezeichnet.
Sowohl die auf menschliche Vernunft und Arbeit fokussierte Sichtweise als auch die Diskurse über Menschenrechte, Freiheit und Demokratie sowie die erleichternde und lebensverlängernde Wirkung von Wissenschaft und Technik auf das menschliche Leben führten zu dieser Bezeichnung. Die Menschzentriertheit der Moderne galt in akademischen und intellektuellen Kreisen lange Zeit als Axiom.
Wenn ich jedoch auf die Entwicklungen der letzten 20 bis 30 Jahre blicke, glaube ich persönlich nicht mehr, dass die Moderne eine menschenzentrierte Zivilisation ist, wie früher angenommen. Im Gegenteil bin ich der Ansicht, dass der Anschein von Menschzentriertheit nur eine bestimmte Phase darstellt und dass die Moderne letztlich eine menschenfeindliche Qualität besitzt. Die technomediatische Welt, besonders die Erscheinungen in Informations- und Künstlicher Intelligenz-Technologien, bestätigt diese These zunehmend. Der Mensch wird immer mehr mit anderen Lebewesen, Robotern und Lebens-Computerspielen gleichgesetzt…
Seit ich das erkannt habe, bemühe ich mich darauf hinzuweisen, dass unser Widerspruch gegen die Moderne genau hier beginnen muss: Es gilt, dem Menschen und der menschlichen Existenz wieder Anerkennung zu verschaffen und das Konzept der „Würde des Menschen“ erneut zur Fahne zu machen. Wenn uns das nicht gelingt, wird die seit geraumer Zeit dem technologischen Denken der Ingenieure überlassene und damit entwürdigte Menschlichkeit weiterhin an Ansehen verlieren. Unter dem Vorwand des „Sieges der Vernunft“ droht das Ende einer moralischen und tugendhaften Welt, unserer bekannten Natur und der Welt der Lebewesen.
Die Würde und die nicht reduzierbare Ontologie des Menschen müssen die Grundlage eines spirituellen Widerspruchs gegen die gelebte Welt bilden. Jeglichen Versuchen, die menschliche Würde und Ehre zu untergraben, ist entschieden entgegenzutreten und Widerstand zu leisten. Trotz der häufigen Versuche, die menschliche Würde zu sprengen, muss auf deren Unantastbarkeit bestanden werden. Können wir das nicht, wird der jahrtausendelange Kampf der Menschheit umsonst gewesen sein; Begriffe wie „Menschenrechte“, „Recht“, „Gerechtigkeit“ werden entwertet, und zwangsläufig entsteht eine Welt, in der die Machtvollsten alles beherrschen, nicht genug damit haben, sondern auch unsere Gedanken formen wollen und sämtliche digitalen Technologien, künstliche Intelligenz und Roboter zu diesem Zweck gegen uns einsetzen.
Ein Philosoph zum Einstieg: Immanuel Kant
Immanuel Kant eignet sich hervorragend, um einem westlichen Publikum zu erklären, warum wir den Menschen verteidigen müssen. Kant wollte, genauso wie wir, dass die Moderne eine zivilisierte Welt sein möge, die dem Menschen würdig ist. Gleichzeitig setzte er sich für Moral, Spiritualität und Maßhalten ein.
Der von Kant als „sternübersäter Himmel“ bezeichnete Naturordnung entspricht für ihn innerlich das „Gesetz der Moral“. Kant, der Newtons Gravitationsgesetz als „höchstes Naturgesetz“ ansah, glaubte, dass alle moralischen Gebote auf einem einzigen höchsten Gebot basieren können: „Handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Mit diesem allgemeinen Gesetz war es möglich zu beurteilen, ob sämtliche Handlungen im Leben moralisch sind.
Kant verglich das moralische Gesetz mit den Naturgesetzen, wusste jedoch, dass es nicht durch Sinneserfahrungen oder Kausalitätsprinzipien erfasst werden könne. Denn der Mensch ist ein freies und willentlich handelndes Wesen. Seine Bedürfnisse und Wünsche werden natürlich von den Gesetzen der Natur von außen gelenkt, doch sein Wille ist autonom und fähig zur Selbstbestimmung. Der Mensch ist frei; es liegt an ihm, ob er das Gesetz befolgt oder nicht. Während uns das moralische Gesetz fortwährend auffordert, ihm zu entsprechen, um das „höchste Gut“ zu verwirklichen, treiben uns die naturhaften Seiten in uns ständig zur Rebellion. Unsere inneren Triebe, Wünsche und Bedürfnisse wollen befriedigt werden, und auf diesem Weg sucht der Mensch das Glück. Doch das moralische Gebot in uns befiehlt, dass wir nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere das wünschen sollen, was wir uns erhoffen, und das Glück nicht von der Tugend trennen dürfen. Das wahre Ziel, das dem Menschen das höchste Glück bringt, ist die ständige Bemühung, im Bereich der Moral zu bleiben.
Der Mensch ist sich seiner Freiheit bewusst, aber dieses Wissen entstammt nicht seinen Sinnen, sondern – ähnlich wie das moralische Gesetz – einer inneren Quelle, die jenseits der Kausalität der Natur liegt. Freiheit und Moral sind untrennbar miteinander verbunden und begründen einander. Freiheit bedeutet nicht Willkür, sondern das Einhalten des Gesetzes. Wir wissen, dass wir frei sind, wegen des moralischen Gesetzes in uns. Ebenso hätte das moralische Gesetz in uns keine Bedeutung, wenn wir nicht frei wären.
Für Kant, den Urheber dieser Ansichten, macht der Wille und die Freiheit den Menschen zu einem einzigartigen Wesen und verbindet ihn mit der Unendlichkeit und dem Schöpfer. Jeder freie und willensfähige Mensch ist Träger von Menschlichkeit und dem Heiligen und daher würdevoll und achtenswert. Jeder Mensch verdient Respekt vor seiner Würde, nicht zweifellos wegen jedes einzelnen Verhaltens, sondern allein wegen seiner Menschlichkeit.
Die Würde des Menschen
Kant sagt, dass unser moralisches Verhalten durch die Religion zur Vollkommenheit gelangt und moralische Pflichten durch die Religion bedeutende Unterstützung finden. Der Zweck der Religion sei es, die Moral im Menschen zu fördern. Doch seiner Ansicht nach entspringt Moral letztlich der praktischen Vernunft und ist auch ohne Religion möglich. Diese Sichtweise ist für einen Muslim nicht vollständig nachvollziehbar. Dennoch steht es nicht im Wege, die Ähnlichkeit zwischen Kants Moralverständnis, das wir hier zusammenfassen, und den aus muslimischem Glauben hervorgehenden Prinzipien zu erwähnen. Bringt Kants universelles moralisches Gesetz nicht unmittelbar die Hadith „Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg auch keinem andern zu“ in Erinnerung? Ebenso dürften jedem Muslim, der mit Kants ethischer Herausforderung konfrontiert wird, die Hadithe „Jedes Kind wird auf der Fitra geboren“, „Trachtet nach Moral gemäß der Moral Allahs“ und „Der Islam ist schöne Moral“ lebhaft in den Sinn kommen.
Ein zentraler Schnittpunkt zwischen Kants Ethik und muslimischer Sicht ist sein Begriff der „Würde des Menschen“…
Nach muslimischem Verständnis hängt die Würde des Menschen mit seiner Ehre (Mükerremlik) zusammen, die durch den Koran bezeugt wird:
„Wahrlich, Wir haben die Kinder Adams geehrt, sie auf Land und Meer getragen und sie mit guten Gaben versorgt und sie vor vielen unserer Geschöpfe ausgezeichnet“ (Sure Isra, 17/70).
Mükerrem sein bedeutet, als Stellvertreter Gottes die Erde zu verwalten (Sure Bakara, 2/30); auf Erden zu sein, um sie zu bebauen und zu bewahren (Sure Hud, 11/61). Es bedeutet, als Geschöpf Gottes durch seine Hand erschaffen zu sein (Sure Sad, 38/75) und als vollkommene Manifestation seiner göttlichen Namen. Es bedeutet, die schwere Last zu tragen, die Himmel und Erde nicht ertragen könnten, nämlich die göttliche Verantwortung (Sure Ahzab, 33/72). Dass alles, was Himmel und Erde enthält, als göttliche Barmherzigkeit dem Menschen gegeben wurde und alles ihm untertan gemacht ist (Sure Jasiye, 45/13). Es bedeutet, das Geheimnis der besten Schöpfung zu erreichen (Sure Tin, 95/4). Es bedeutet, das Wesen zu sein, das aus Erde geschaffen und mit Gottes Geist beseelt wurde (Sure Hicr, 15/29; Sure Secde, 32/9), um geehrt zu sein.
Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz fasst zusammen: „Mükerrem sein heißt, in der Gesellschaft ohne Unterschied von Rasse, Religion, Sprache oder Geschlecht gut mit allen Menschen auszukommen. Es heißt, allen mit guten Worten und schönem Benehmen zu begegnen. Es heißt, sich mit Liebe und Brüderlichkeit zu verbinden und Feindschaften zu beenden. Es heißt, den von Gott wertgeschätzten Menschen weder klein noch wertlos oder ehrlos zu sehen.“
All das ist zweifellos richtig, doch eine weitere wichtige Ergänzung ist notwendig: Der Mensch, der die Verantwortung (Amanah) trägt und als Stellvertreter Gottes auf Erden lebt, ist verpflichtet, alle Lebewesen und die Natur genauso wie seine menschlichen Brüder – ja, sogar mehr – zu schützen und zu bewahren. Denn alle Menschen stammen aus derselben Substanz und sind mit derselben Mission ausgestattet. Daher reicht es nicht aus, die Menschenwürde anzuerkennen und die Mission des Menschen zu respektieren; wir sind persönlich auch für die anderen Lebewesen, die Tiere und das ökologische Gleichgewicht der Natur verantwortlich.
Kants Begriff der „Menschenwürde“ hatte später einen enormen Einfluss auf die Rechtsphilosophie und bildete die Grundlage vieler Verfassungen moderner Staaten. Diese Staaten werden heute faktisch durch diese Verfassungen regiert; scheinbar orientieren sich Entscheidungen an dieser Sichtweise. Doch, wie wir immer wieder betonen, ist mit dem Zeitalter des sogenannten „Posthumanen“ dieser Weg an sein Ende gelangt. Ich fürchte, dass die gegenwärtige „de facto“ gegenmenschliche Realität bald auch „de jure“ werden könnte. Es ist notwendig, diese Entwicklungen zu erkennen und die Fallen zu durchschauen, die der Würde des Menschen entgegenstehen. Oder nicht? Werden nicht etwa unter dem Deckmantel von vermeintlicher Liebe – etwa „Naturliebe“, „Tierliebe“ oder sogar „Rechte unbelebter Wesen“ – die Menschen entwürdigt? Wird nicht so getan, als sei die moderne Sichtweise, die die Natur in diesen Zustand gebracht hat, nicht verantwortlich, sondern als wäre der ehrenwerte Mensch, der die Verantwortung trägt, gar nicht wirklich fähig zu wahrer Liebe?
Beim Verteidigen der Menschenwürde müssen wir weitere Grundsätze beachten. Versuchen wir, diese zu benennen:
Ein Aspekt der Würde und der nicht reduzierbaren Ontologie des Menschen besteht darin, Natur und Welt mit derselben Perspektive zu betrachten. „Jeder Mensch ist ein Kosmos“, jeder Mensch ist ein verkleinertes Abbild des Universums. Es gilt, die Sichtweise zu bewahren: „Der Mensch ist der kleine Kosmos, das Universum der große Mensch“. Dazu ist es notwendig, die Vorteile von Wissenschaft und Technik zu kennen, aber gleichzeitig der ontologischen Zerstörung durch die Technologie entgegenzutreten. Angesichts der immer stärker gegen die Ontologie wirkenden Technologie muss ein „herzlicher Verstand“, der die Ontologie über die Technik stellt, an erster Stelle in Akademie und Politik sowie überall sonst „Stopp!“ sagen können.
Es ist notwendig, die traditionellen Weltbegriffe wie „Herz“ und „mit dem Herzen verstehen“, die wegen mangelnder Wissenschaftlichkeit abgewertet wurden, wiederzubeleben. Ebenso muss die Moral, die oftmals nur auf Ethik als akademischem Fachgebiet reduziert und in ihrer Bedeutung für die Entstehung und das Funktionieren von Gesellschaften geleugnet wird – also die Grundlagen traditionellen menschlichen Zusammenlebens, Tugenden wie Güte, Barmherzigkeit und Hoffnung – als universelle und ontologische Wahrheiten verstanden werden, nicht als historische. Überall sollte betont werden, dass Moral keine menschliche Erfindung ist, sondern ihre Grundlage darstellt und der Ontologie vorausgeht oder mit ihr Hand in Hand geht.
Es muss betont werden, dass der Mensch letztlich ein „transzendentes“ (übersinnliches) und „glaubendes Wesen“ (homo religiosus) ist, zugleich aber die Gegensätze von Wissenschaft und Religion, Glauben und Vernunft überwunden werden müssen. Wissenschaft ist der sicherste Weg, um Wahrheit durch Vernunft zu entdecken, doch auch der Glaube ist ein Teil der Wahrheit.
[*] Entnommen aus dem Nachwort von Erol Göka’s Buch „Umuda İmkân Aramak“ (Kapı Yayınları).