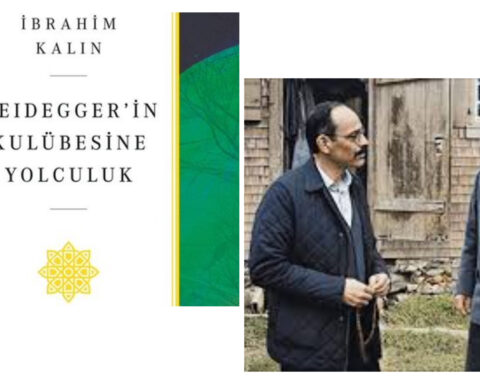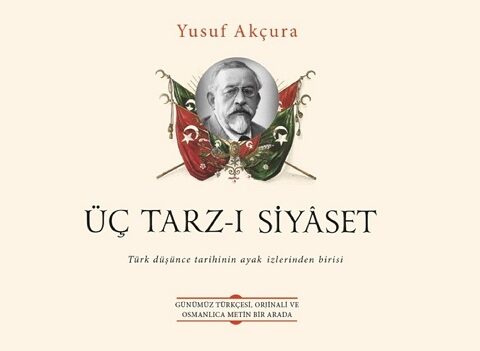Die natürliche Fortsetzung der Geldwirtschaft sind die Menschenszenen in den großen Metropolen der Welt… Georg Simmel versuchte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, den Metropolmenschen zu beschreiben, und seine Beobachtungen gelten bis heute unverändert. Tatsächlich gibt es – mich eingeschlossen – sogar noch mehr zu sagen: die starke Verbindung zwischen der konsumorientierten Kultur, die von Geld und Gewinnstreben geprägt ist, und der Bildgesellschaft hat die „technomediatische“ Welt an den Rand des Zusammenbruchs gebracht… Dennoch wollen wir uns an Simsels Erkenntnissen aus einem Jahrhundert orientieren. Er sagt Folgendes:
Der moderne Metropolmensch ist gereizt. Unter der Reizüberflutung des Stadtlebens versucht er, Abstand zu seiner sozialen und physischen Umgebung zu halten und entwickelt eine neurasthenische Persönlichkeit. Der Mensch auf dem Dorf kennt fast jeden und pflegt positive Beziehungen. Ein solches Bild kann man in der Stadt, wo man täglich hunderten Menschen begegnet, nicht aufrechterhalten. Würde man es versuchen, würde die eigene Innenwelt in Stücke zerbrechen. Angesichts der flüchtigen Begegnungen in der Metropole fühlen sich die Menschen zu Recht unsicher und ziehen zwangsläufig Distanz zu anderen. Nachbarn, die wir jahrelang in der Großstadt haben, kennen wir oft kaum. Deshalb empfinden die Dorfmenschen den Metropolmenschen als kalt und seelenlos.
„Die Geldkultur bedeutet, dass das Leben zum Gefangenen seiner eigenen Mittel wird“, sagt Simmel. Dauernd angeregt zu sein, ständig dem Einfluss der Geldwirtschaft ausgesetzt zu sein, führt schließlich zur Gleichgültigkeit, zu Zynismus, Oberflächlichkeit, Müdigkeit und Erschöpfung des Stadtmenschen. Er wird abgestumpft: „Die angeregten Nerven wurden so lange mit voller Kraft zur Reaktion gezwungen, dass sie auf nichts mehr reagieren. Für ihn ist alles gleich bleiern, grau. Nichts ist es wert, dass man sich dafür begeistert.“ Dieses Gemütsbild wird nur von starken Erregungen und heftigen Verlangen unterbrochen. Die Erfüllung der Wünsche bringt zwar vorübergehende Erleichterung, doch bald kehrt man in den alten Zustand zurück.
Es wäre gut, wenn es bei Distanz und Ermüdung bliebe… Doch in den Dschungeln des Stadtlebens versucht der Mensch, sich durch die Abwertung der Welt und der Mitmenschen zu schützen und ignoriert selbst Verwandte und Nachbarn. Er wird zum Menschen, der sieht, aber nicht hört. So entsteht „eine leichte Unzufriedenheit, die in jedem Moment, aus welchem Grund auch immer, in Hass oder Streit umschlagen kann, ein gegenseitiges Fremdsein und Ekelgefühl“. Doch egal was er tut – am Ende ist er ihnen ähnlich, in der Metropole gleichen sich alle an, das Leben wird eintönig.
Das einzige Mittel gegen diese Uniformität ist, sich in sich selbst zu versenken, nur noch an sich selbst zu glauben und zugleich durch Kleidung und Auftreten so schnell und so auffällig wie möglich seine Andersartigkeit zu zeigen. Was für ein Jammer, wenn diese Andersartigkeit seltsam, gekünstelt und übertrieben wird! Doch wenn man es schafft, mit der Andersartigkeit Aufmerksamkeit zu erregen… Je näher die Körper in der Menge beieinander sind, je enger die Räume werden, desto mehr entfernen sich die Seelen voneinander, um atmen zu können – und die Menschen vereinsamen in ihrem Labyrinth der Metropole.
Trotz all dem, wenn Menschen in einem System zusammenleben und nicht einfach auseinandergehen mit dem Gedanken „Hier gibt es nichts, was uns ausmacht“, dann liegt das immer am Geld. Das dicht gewebte soziale Netz der Metropole ist ein Spinnennetz aus Geld…
Doch kann der Mensch der Stadt, den Simmel vor einem Jahrhundert beschrieb, dessen Leiden sich in der heutigen technomediatischen Welt vervielfacht haben – also der Mensch, der in der Geldwirtschaft lebt – wirklich Glück finden?
Geld und Glück
Georg Simmel zufolge hat die Geldwirtschaft auch ihre positiven Seiten. Vor allem ist Geld der klarste Beweis dafür, dass der Mensch ein lebendes Wesen ist, das in der Lage ist, Werkzeuge für seine Zwecke zu schaffen. Ein Werkzeug symbolisiert den menschlichen Geist, bringt die Pracht seines Willens zum Ausdruck und zeigt gleichzeitig seine Grenzen auf. Durch Geld können wir mit sehr vielen Menschen Beziehungen eingehen. Wir können unsere Verpflichtungen einengen auf spezielle Dienstleistungen und Produkte und so Befriedigungen erleben, die es in anderen Wirtschaftssystemen nicht gibt. Auch kann die Geldwirtschaft als freier Raum betrachtet werden, in dem Individualität realisiert werden kann, persönliche Interessen und Anliegen geschützt und aufrechterhalten werden, der Arbeiter von den Produktionsmitteln getrennt wird und somit den Zwängen des Absolutismus sowie den Beschränkungen der sozialen Gruppen, in denen er lebt, entkommt. Diese positiven Aspekte der Geldwirtschaft nennt unser Denker Georg Simmel, doch wegen der daraus entstehenden Kulturtragödie vergibt er keine Bestnote. In der Geldwirtschaft geht es nicht ohne Geld, doch mit Geld allein gibt es kein Glück.
Manche Liberale, denen Gott gnädig sei, wie mein geschätzter Atilla Yayla, meinen, alles Gute, das uns widerfährt, verdanken wir größtenteils dem Geld… Lesen wir eine gekürzte Version von Yaylas Artikel „Die Erwartungen der Menschen im Leben“:
„Man sagt, die Menschen sind erfüllt vom Wunsch, reich zu sein und sich alles einfach kaufen zu können. Wer sich leisten kann, was er mag, und ohne Sorge Geld ausgibt, ist glücklich… Eine Studie aus den USA zeigt, dass nicht das Geld, sondern der Status in der Gesellschaft die Menschen glücklich macht. Die Untersuchung ergab, dass ‚angesehene‘ und ‚respektierte‘ Personen glücklicher sind als jene mit hohem Einkommen… Außerdem nimmt laut Studie das Glück durch Reichtum und Geld mit der Zeit ab, während Anerkennung und sozialer Respekt dauerhaft bleiben. Andere frühere Studien zeigten auch, dass es verschiedene Trends in der Beziehung zwischen Glück und Geld gibt. So bringt es Menschen, die am unteren Ende der Einkommensleiter anfangen, große Freude, sich durch eigene Arbeit und Einkommen hochzuarbeiten. Dieselbe Glücksform sieht man jedoch nicht bei Menschen, die ihr Geld durch Erbschaft oder große Spenden erhalten haben, besonders bei jungen Leuten. Oft tritt sogar das Gegenteil ein…
Diese Aspekte wurden schon früh von Propheten und Philosophen betont. Zum Beispiel hoben David Hume und Adam Smith hervor, dass der Wunsch nach Anerkennung sehr wirkungsvoll menschliches Verhalten lenkt und steuert. Doch um die Wahrheit zu erkennen, braucht es keinen Propheten oder Philosophen… Ich bin der Überzeugung, dass Geld, der Wunsch und die Anstrengung, Geld zu verdienen, sowie das Streben nach Reichtum sowohl der einzelnen Person als auch der Gesellschaft sehr zugutekommen. Die Geschichte belegt dies…
Allerdings ist Geld für sich genommen kein Zweck. Es wird letztlich zum Mittel für Respekt und Anerkennung, ähnlich wie Erfolg im Sport, in Wissenschaft oder Kunst. Sicher ist: Der Beitrag von Geld und der Anstrengungen, Geld zu verdienen, für die Menschheit ist viel größer – ja, unvergleichbar größer – als der Beitrag von Sport, Wissenschaft und Kunst.“
Über diese Beobachtungen von Yayla ließe sich viel diskutieren. Wir verweisen unsere Leser an dieser Stelle auf unseren früheren Artikel über Adam Smith (https://kritikbakis.com/de/staat-kapital-und-adam-smith/)und machen hier weiter, ohne das Thema weiter auszubreiten.
Geld ist natürlich eines der glänzendsten Produkte des menschlichen Genies… In der heutigen modernen Staatsstruktur und im zwischenstaatlichen Gefüge kann man Geld und seine Ökonomie kritisieren, aber eine vollständige Ablehnung ist unmöglich. Sofern man kein unnachgiebiger Anarchist ist, sind das unbestrittene Tatsachen… In Anlehnung an Simmels Konzeptualisierung arbeiten wir hier unter den Überschriften „Geldwirtschaft“ sowie „Philosophie und Psychologie des Geldes“. Was wir besonders hervorheben und betonen wollen, ist, dass zur Diskussion und Bewertung der Beziehungen zwischen Kapitalismus, Liberalismus und Moderne unbedingt auch das Thema „Papiergeld“ hinzugefügt werden muss… All diese Aspekte hängen sehr eng miteinander zusammen, ohne das eine funktioniert das andere nicht.
Doch was sollen wir tun, während wir uns in diesem Paradox drehen?
Simmel ist der Ansicht, dass diese Tragödie des städtischen Lebens, die Entfremdung, die von der Geldwirtschaft gesteuert wird, nur durch Kunst überwunden werden kann. Auch er suchte als Intellektueller, der unter den Nöten der frühen Moderne lebte, die Lösung in der Kunst. Ähnlich wie Nietzsche, der sagte: „Kunst und nur Kunst, wenn es etwas gibt, das uns davor bewahrt, durch die Wahrheit zu sterben, dann ist es die Kunst.“ Simmel meint, dass nur die Kunst mehr ist als das Leben. Leben und Form können nur in der Kunst zusammenkommen. „Es gab keine Epoche, in der die Menschen nicht vom Geldgier getrieben waren, aber man kann sagen, dass die Zeiten, in denen dieses Verlangen am stärksten war, auch die Perioden waren, in denen die individuelle Befriedigung am bescheidensten war, beispielsweise wenn religiöse Gefühle ihre Kraft verloren hatten, als das ultimative Ziel des Daseins erhoben zu werden.“ So sagt Simmel. Hier halten wir kurz inne und blicken etwas zurück zu den Zeiten Kierkegaards.
Sören Kierkegaard, der noch gerade rechtzeitig auf den Zug der Moderne aufsprang, also einer der ersten war, der Modernität erkannte und darüber nachdachte, verstand, dass Moderne nicht nur Massenware produziert, sondern auch Menschen, die alle gleich sind, eine Serienfertigung an Menschen. Er nannte diese Massen „die Menge“ und setzte sich in seinen ersten Schriften mit der Umgebung auseinander, die diese lebendige Ansammlung von Klischees hervorbringt: mit den Medien, politischen und kulturellen Tendenzen sowie der Rationalität in der Philosophie – seine Reaktion darauf war der Existenzialismus. Er rief die Menschen gegen die tödliche Krankheit der Verzweiflung zur wahren Religion auf. Aber diese Botschaft wurde weder von Nietzsche noch von Simmel wahrgenommen, die ihr Heil in der Kunst suchten. Meiner Meinung nach war Kierkegaards Aufruf, für die Herausforderungen der Moderne die Spiritualität zur Hilfe zu holen, sehr wichtig. Es ist eine Stimme, der wir auch heute noch zuhören sollten. Denn sonst können wir keine Parallele zwischen der alten Suche nach Glück und unserer eigenen Welt herstellen.
Wenn ich von „alter Glückssuche“ spreche, meine ich eine Glücksvorstellung, die nicht losgelöst von Tugenden ist, eine Sichtweise, in der Moral und Lebensphilosophie untrennbar miteinander verbunden sind. In der traditionellen Welt war der Zweck des Menschen auf Erden nicht einfach nur glücklich zu sein, sondern ein Mensch zu werden, der des Glücks würdig ist; Glück wurde immer zusammen mit Tugenden betrachtet. Besonders muslimische Philosophen verwendeten den Begriff „es-saade“, um Glück auszudrücken, und wenn sie darüber sprachen, trennten sie zuerst ihr eigenes Glücksverständnis von dem, was im Volk als „vermeintliches Glück“ galt. Deshalb bevorzugten sie Begriffe wie „es-saadetü’l kusva, uzma, ulya“, also „das höchste Glück“. Mit der Moderne (Kapitalismus, Geldwirtschaft) ist die Welt philosophielos geworden. Das, was das Volk für Glück hält, ist in den Vordergrund gerückt, und diese Situation wurde kaum hinterfragt, weil es unvermeidlich war, sich für mehr Konsum an den vorübergehenden Vergnügungen der Bevölkerung zu orientieren.
Ja, an dem Punkt, an dem wir heute angekommen sind, ist das Wesentliche – und worauf wir mehr achten sollten – die Frage, wo wir das Geld im Rahmen der Spiritualität und einer moralisch fundierten Lebensphilosophie verorten und wie wir in der Geldwirtschaft Haltung zeigen.
Der Mensch führt einen Lebenskampf und strebt nach Erfolg. Geld zu verdienen, und dadurch anderen Menschen eine Einkommensquelle zu ermöglichen, ist selbstverständlich ein Teil des Erfolgs. Doch egal was passiert, wir dürfen uns nicht der Geldwirtschaft völlig ergeben; wir müssen unser geistiges Empfinden als unser letztendliches Lebensziel weiterhin erheben.
Unser geschätzter Herr Yayla sagt: „Geld ist kein Zweck an sich.“ Aber wenn wir das Geld über die Tugenden stellen, wird es zwangsläufig zum Selbstzweck. Ist es nicht genau die auffälligste gesellschaftliche und psychologische Funktion des Geldes, andere Ziele auf das Mittelmaß eines bloßen Mittels zu reduzieren? Auch wenn es Gegenbeispiele gibt, zeigt uns das Erlebte nicht genau das?
Ob wir Geld verdienen oder nicht, wir sollten im Lebenskampf arbeiten und uns für das „höchste Glück“ einsetzen.