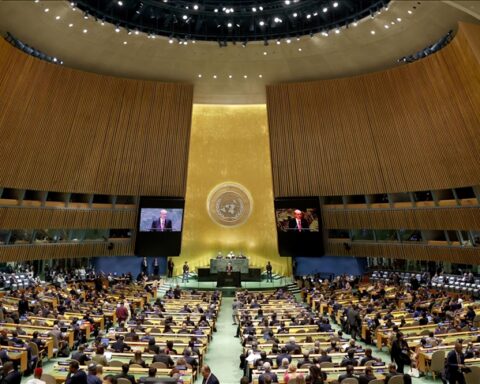Was das Zeitalter wirtschaftlicher Unsicherheit für die Welt bedeutet
Die globale Wirtschaft befindet sich – gelinde gesagt – in einem Zustand der Turbulenz. Schon vor den letzten US-Wahlen wurde sie von geopolitischen Erschütterungen und dem Potenzial disruptiver technologischer Innovationen belastet. Jetzt aber muss sie zusätzlich mit einem außergewöhnlichen Maß politischer Unbeständigkeit aus den Vereinigten Staaten selbst fertigwerden. Für Anleihe- und Aktienmärkte, aber auch für Wirtschaftsprognostiker und politische Entscheidungsträger ist das zu einer regelrechten Achterbahnfahrt geworden.
Auf einer tieferen Ebene hat dieses Chaos dazu geführt, dass weithin akzeptierte Narrative über die USA infrage gestellt werden. Die grundlegenden Annahmen, die bisher die Entscheidungen von Haushalten, Unternehmen und Investoren geprägt haben, verlieren ihre Gültigkeit. Vorgehensweisen, die einst als verlässliche Regeln galten, funktionieren nur noch bedingt. Indikatoren für das Vertrauen von Konsumenten und Produzenten sind in den Keller gerutscht, während Inflationserwartungen auf den höchsten Stand seit 1981 gestiegen sind.
Inmitten dieser tiefgreifenden Unsicherheit fällt es selbst erfahrenen Analysten schwer, den künftigen Kurs der US-Wirtschaft einzuschätzen. Dennoch lassen sich die vielen verstreuten Prognosen im Wesentlichen auf zwei mögliche Szenarien zurückführen: Im ersten Szenario durchläuft die US-Wirtschaft eine strukturelle Neuausrichtung, ähnlich jener unter Ronald Reagan oder der britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Das Ergebnis wäre ein weniger verschuldeter, effizienterer Privatsektor in einem gerechteren globalen Handelssystem.
Im zweiten Szenario gleitet das Land schrittweise in eine Stagflation ab – also in eine Kombination aus wirtschaftlicher Stagnation und hoher Inflation –, mit der realen Gefahr einer tiefen Rezession und erheblicher finanzieller Instabilität, wie sie zuletzt unter Präsident Jimmy Carter erlebt wurde.
Wie auch immer das Ergebnis ausfällt, die globalen Auswirkungen werden beträchtlich sein. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs steht das US-Finanzsystem im Zentrum der Weltwirtschaft. Washington besitzt großen Einfluss in multilateralen Institutionen. Die Vereinigten Staaten galten lange als einzige verlässliche Triebkraft des globalen Wachstums, besonders durch ihre Führungsrolle in zukunftsweisenden Technologien wie Künstliche Intelligenz, Biowissenschaften und Robotik. Dank tiefer Liquidität und robuster Infrastruktur vertrauen viele internationale Anleger ihr Kapital den US-Finanzmärkten an. Der Dollar bleibt die führende Reservewährung der Welt. Sollte die US-Wirtschaft in eine Stagflation abgleiten, könnten andere Weltregionen schnell folgen.
Viele Regierungen scheinen sich dieser Gefahr bewusst zu sein. Deshalb versuchen sie, sich zunehmend von Washingtons politischen Schwankungen abzukoppeln. Europa etwa bemüht sich um stärkere wirtschaftliche Verbindungen mit Afrika, Asien und Lateinamerika, um seine regionale Einflusskraft zu erweitern. China wiederum sieht eine Chance, sich als verlässlichere wirtschaftliche Supermacht zu positionieren. Doch all diese Bemühungen stoßen bislang an große Grenzen – denn es gibt schlicht kein anderes Land, das so wohlhabend und mächtig ist wie die USA.
In diesem Umfeld, in dem kaum jemand auf Stabilität hoffen kann, müssen Regierungen, Unternehmen und Investoren deutlich mehr tun, um sich gegen potenzielle Risiken abzusichern. Sie müssen flexibel und anpassungsfähig bleiben. Neben Kapital benötigen sie auch personelle Resilienz, um Rückschläge auszugleichen und neue Initiativen zu finanzieren. Und sie müssen bereit sein, neue Denk- und Verhaltensweisen zu erproben. Wenn diese Akteure ausreichend beweglich bleiben, können sie die Krise überstehen – vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen. Erstarren sie jedoch, riskieren sie den Wohlstand sowohl der heutigen als auch künftiger Generationen.
Eine Pause vom Exzeptionalismus
Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor das mächtigste und reichste Land der Welt mit etablierten Institutionen. Doch wirtschaftlich und finanziell betrachtet ähnelt das Land zunehmend einem Schwellenland. Wie Länder mit unausgereiften Steuersystemen und akutem Einnahmebedarf hat Washington plötzliche und hohe Zölle auf viele importierte Waren verhängt. Anschließend wurde eine Art „Swiss-Cheese-Approach“ verfolgt – scheinbar willkürliche Ausnahmen für bestimmte Produkte und Branchen. All dies geschah, während das Haushaltsdefizit weiter wuchs. So ähnelt die politische Herangehensweise der US-Beamten manchmal eher der von Regionen Lateinamerikas als der weltweit stärksten Wirtschaft.
Je länger dieses Verhalten andauert, desto größer wird das Risiko, dass die US-Wirtschaft auf Probleme stößt, die für Schwellenländer typisch sind. Bereits jetzt sind Anzeichen von Kapitalabflüssen zu sehen, ausländische Investoren agieren vorsichtiger, und die Unabhängigkeit der Zentralbank wird zunehmend infrage gestellt. Die jahrzehntelang dominierenden US-Märkte zeigten Anfang 2025 eine schwache Performance. Der einst starke Dollar verliert trotz höherer Renditen an Wert. Sogar die Zahl der Touristenbesuche ist stark zurückgegangen.
Und es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Turbulenzen bald legen. Präsident Donald Trump tritt mit dem Versprechen an, sowohl die amerikanische als auch die globale Wirtschaft durcheinanderzubringen, den Sicherheitsmantel Washingtons zurückzuziehen und die Kosten für globale öffentliche Güter wie Hilfe und Verteidigung gerechter zu verteilen. Er setzt diese Versprechen um und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er bald stoppen wird. Die eigentliche Frage ist, wie weit und wie schnell er gehen wird.
Andere Länder hoffen vielleicht, dass Washingtons aktuelle Politik die wirtschaftliche Ordnung nur begrenzt erschüttert. Doch Zölle, der schwächelnde Dollar, Risiken finanzieller Instabilität und Behauptungen, wonach die USA einige ausländische Gläubiger zwingen könnten, US-Staatsanleihen zu verlängern, haben weltweit Alarm ausgelöst. Selbst erfahrene Beobachter tun sich schwer, die Zukunft vorauszusagen. Kurz gesagt: Washington hat das Fundament der globalen Ordnung erschüttert, und es fehlt an einem verlässlichen Leitfaden für die komplexe Übergangsphase.
Die Liste der Unsicherheiten ist lang und beängstigend. Zum Beispiel ist unklar, ob Washington den globalen Handel erschüttern kann, ohne die Kapitalströme zu stören. Experten sind sich unsicher, ob die Zölle nur vorübergehend Preise beeinflussen oder eine neue inflationsfördernde Spirale auslösen. Die Zentralbanken – insbesondere die US-Notenbank (Federal Reserve/Fed) – stehen vor der Herausforderung, Preise zu kontrollieren und gleichzeitig eine starke wirtschaftliche Rezession zu verhindern. (Die Spannungen zwischen Trump und Fed-Chef Jerome Powell verschärfen diese Unsicherheit und gefährden die Unabhängigkeit, Effektivität und Glaubwürdigkeit der Bank.) Niemand kann die langfristigen Folgen der durch die Pandemie beginnenden und durch geopolitische Spannungen verschärften Störungen in den Lieferketten abschätzen. Gleichzeitig warten viele Länder angesichts der steigenden Spannungen im Pazifik darauf, ob sie sich zwischen China und den USA entscheiden müssen.
Diese unbeantworteten Fragen stellen Regierungen vor große Herausforderungen. Doch die Lage verkompliziert sich nicht nur für sie; auch Unternehmen und Investoren sehen sich mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Historisch stabile Korrelationen zwischen Anlageklassen – insbesondere zwischen Aktien- und Anleihepreisen – waren einst Grundlage vieler Investmentstrategien. Heute sind diese Beziehungen ungewöhnlich und instabil. Traditionelle „sichere Häfen“ sind längst nicht mehr so sicher, wie sie einst galten. Fundamentale Anlagegrößen wie erwartete Renditen, Volatilität und Korrelationen sind so unsicher wie selten zuvor. Daher wissen Investoren oft nicht, wie sie ihre Vermögenswerte streuen und Risiken minimieren sollen. Sie wissen, dass sie ihre Strategien anpassen müssen – doch wie, bleibt unklar.
Zwischen zwei Ansichten
Wirtschaftsprognostiker tendieren bei Zukunftsprognosen meist zu einem der beiden gegensätzlichen Extreme. Die erste Sichtweise ist optimistisch: Demnach schafft die Trump-Regierung es, die Bürokratie zu verkleinern, unnötige Vorschriften abzubauen und die Staatsausgaben zu senken, um eine schuldenreduzierte und effizientere Regierung zu etablieren. Die Wirtschaft würde die Krise durch eine freiere Privatwirtschaft überwinden, die Innovationen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Lebenswissenschaften, Robotik und zukünftig Quanteninformatik besser nutzen kann – Felder, in denen die USA bereits führend sind.
Washington könnte weiterhin höhere Zölle als vor Trump haben. Diese Zölle würden aber durch den Abbau hoher Zölle und nichttarifärer Handelshemmnisse in anderen Ländern sowie durch mehr Verantwortung bei der Bereitstellung globaler öffentlicher Güter ausgeglichen werden. Dieses Szenario erinnert nicht nur an die Reformen von Reagan und Thatcher in den 1980er Jahren, sondern geht darüber hinaus. Es umfasst nicht nur eine Neuordnung der heimischen Wirtschaft, sondern auch eine grundlegende Umgestaltung der globalen Wirtschaftsordnung.
Natürlich müssen dafür viele Dinge gut laufen. Vor allem braucht es schnelles Wirtschaftswachstum, um die Schuldenlast zu senken. Die Finanzmärkte müssen geduldig bleiben und Unsicherheiten bezüglich Dollar und US-Staatsanleihen tolerieren. International muss Vertrauen herrschen, dass Länder Washingtons Zusagen zu Handel und Zöllen einhalten. Sie müssen bereit sein, große Dollarbestände und Anleihen zu halten. Außerdem müssen sie es schaffen, die wahrscheinlich anhaltenden Spannungen zwischen den zwei Wirtschaftsmächten China und USA zu managen.
Und dann ist da noch die Federal Reserve. Wenn die Welt sich in Richtung höherer Produktivität, niedrigerer Inflation und geringerer Defizite und Schulden bewegt, sollte die Zentralbank sowohl bereit als auch in der Lage sein, die Zinsen deutlich zu senken. Dazu müsste jedoch die Auseinandersetzung zwischen Trump und Powell beigelegt werden – entweder Powell tritt zurück, oder Trump zeigt bis Powells Amtsende im Mai Geduld.
Im pessimistischen Szenario kann Trump ebenfalls eine Zinssenkung erreichen – aber nicht so, wie er es sich vorstellt. In dieser Welt gerät Washington nicht in den Griff, wachsende Haushaltsdefizite zu kontrollieren. Das Vertrauen in Rechtsstaatlichkeit und die Begrenzung exekutiver Macht schwindet, während institutionelles Vertrauen erodiert. Die USA zeigen immer weniger Interesse daran, globale Standards zu setzen oder sich an sie zu halten. Andere Länder überdenken ihre Rolle im globalen System und streben zumindest danach, widerstandsfähiger zu werden und sich selbst zu sichern. Manche könnten sogar multilaterale Bündnisse schmieden, die sie strategisch von den USA unabhängig machen – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Sicherheitsfragen.
Dieses Szenario wiederholt in großem Umfang die Angebotschocks, steigenden Rohstoffpreise und politischen Fehler, die die Weltwirtschaft in den 1970er Jahren erlebte. Es wäre eine schwierige Zeit für alle. Unternehmen müssten zwischen steigenden Kosten und sinkender Nachfrage balancieren. Investoren versuchen, in einem Umfeld Renditen zu erzielen, in dem sowohl Anleihen als auch Aktien fragil sind. Die Kaufkraft und Arbeitsplatzsicherheit der Haushalte nehmen ab. Infolgedessen könnte die Welt in eine Rezession geraten, und eine bereits finanziell und humanitär fragile Generation könnte erheblich Schaden nehmen. Auch zukünftige Generationen, die mit hoher Verschuldung, Ungleichheit und Klimakrisen kämpfen müssen, wären davon negativ betroffen.
Derzeit sind sowohl positive als auch negative Szenarien möglich; dazwischen liegen viele Zwischenwahrscheinlichkeiten. Tatsächlich zeigten verschiedene Marktpreisindikatoren Anfang 2025 eine etwa 80-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Erholung und rund 20 Prozent für eine Verschlechterung an. Doch nachdem Trump Anfang April deutlich höhere Zölle ankündigte als erwartet, sank die Wahrscheinlichkeit für das positive Szenario auf unter 50 Prozent. Gegen Ende des Monats kehrte sich die Stimmung wieder etwas um, als die 90-tägige Aufschiebung der Zölle durch Trump als handhabbar und ohne große Schocks für das globale Handelssystem angesehen wurde. Diese Kombination ist jedoch von Natur aus fließend und wird sich zumindest kurzfristig weiter verändern.
Bereiten Sie sich auf eine Kollision vor
Egal wie sehr sie es versuchen, kaum ein öffentlicher oder privater Akteur kann sich vollständig gegen die aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen schützen. Es gibt jedoch Strategien, um diesen Prozess zu bewältigen.
Eine Strategie besteht darin, den aktuellen Kurs beizubehalten und letztlich davon auszugehen, dass sich die Welt nicht grundlegend von ihrem Zustand im Januar unterscheiden wird. Schließlich erholten sich die Märkte nach Trumps umfassenden Handelsankündigungen, und die wichtigsten Börsenindizes erreichten neue Rekordstände. Während der Präsident mit verschiedenen Ländern verhandelt, könnte die Spannung nachlassen. So oder so wird der amerikanische Privatsektor seine Dynamik, Innovationskraft und Unternehmergeist bewahren. Er wird weiterhin weltweit führend bei technologischen und biologischen Entwicklungen bleiben. Einige Ökonomen meinen, dass ein volatiler und instabiler US-Staatsanleihenmarkt nicht zwangsläufig einen starken Unternehmenssektor negativ beeinflussen muss. Ihrer Ansicht nach kann man auch in einem schwankenden Viertel ein solides Haus besitzen.
Andererseits könnten andere Länder gezwungen sein, ihre eigenen wirtschaftlichen Probleme zu lösen, wenn die USA ihren Sicherheitsschirm zurückziehen. Europa könnte durch Vereinfachung seines komplexen Regulierungssystems, Förderung von Innovation und deren Verbreitung sowie Steigerung der Produktivität das Wachstum beschleunigen. Dies könnte durch stärkere regionale Bemühungen zur strukturellen Vollendung der Europäischen Union unterstützt werden, die stark von der Währungsunion abhängt und dringend Fortschritte in der Finanz- und Bankenunion benötigt.
In der Zwischenzeit könnte Peking in Asien seine Exporte einschränken, um zu verhindern, dass andere Länder durch Dumping chinesische Waren auf ihre Märkte bringen – ähnlich wie Japan vor einigen Jahrzehnten freiwillige Exportbeschränkungen einführte. China könnte zudem sein Wachstumsmodell grundlegend umbauen: Anstelle der traditionellen Exporte und öffentlichen Investitionen könnte es auf private Inlandsnachfrage und private Investitionen setzen und so ein neues Entwicklungsmodell verfolgen.
Doch bei so hoher Unsicherheit werden weder Unternehmen noch Regierungen bereit sein, alle Ressourcen auf ein so optimistisches Ergebnis zu setzen. Wenn die Rolle der USA im globalen Wirtschafts- und Finanzsystem von Natur aus unsicherer und chaotischer wird, müssen Entscheidungsträger sich auf eine fragmentiertere Welt einstellen, in der Risiken häufiger und intensiver auftreten. Das bedeutet eine Welt mit hoher durch politische Entscheidungen verursachter Volatilität, anfälligen globalen Lieferketten und nervösen Finanz- und Kreditmärkten. Länder könnten sich im Bemühen, Risiken zu reduzieren, stärker voneinander entfernen. Der Wettbewerb zwischen Peking und Washington wird sich verschärfen. Einige wichtige Schwellenländer wie Brasilien, Indien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate könnten gute Beziehungen zu beiden Seiten aufrechterhalten, aber die meisten Länder werden letztlich eine Seite wählen müssen.
In diesem Szenario müssen Entscheidungsträger viel mehr tun, um die Kontrolle über ihre wirtschaftliche und finanzielle Zukunft zurückzugewinnen. Europa, angeführt von einem Deutschland, das mehr Wert auf Verteidigung und Infrastruktur legt, sollte seine dauerhaften Zweifel an gemeinsamer Verschuldung überwinden, Brüssel mehr Kompetenzen übertragen und regional mehr Initiativen übernehmen – auch im Verteidigungsbereich. China sollte weniger zögerlich sein, kurzfristiges Wachstum zugunsten einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Transformation aufzugeben. Große Schwellenländer wie Brasilien und Indien sollten reformorientierter werden und Wege finden, aus der mittleren Einkommensfalle auszubrechen.
Glücklicherweise könnte Washingtons aktuelles Verhalten gerade den nötigen Anstoß für diese Veränderungen geben. Besonders Europa könnte die derzeitige Instabilität als Chance nutzen, um Reformen umzusetzen, wie sie der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi vorgeschlagen hat. Diese Reformen zielen darauf ab, Europas Innovationskraft, Produktivitätssteigerung und Finanzierungslücken zu verbessern. Europa könnte zudem homogenere Kapitalmärkte schaffen, die besser in der Lage sind, die starken Investitionen des Kontinents in US-Anlagen zu absorbieren.
Doch tiefgreifende Transformationen bergen ebenso Risiken wie das Verharren im Status quo. Bleibt die Zukunft unsicher, könnten Entscheidungsträger irreversible große Schritte vermeiden und stattdessen den Mittelweg wählen. Zum Beispiel könnten sie ihre Abhängigkeit von den USA begrenzt und bei Bedarf rückholbar reduzieren – still und leise, um keine Reaktion aus Washington hervorzurufen.
Entscheidungsträger sollten Verhaltensfallen vermeiden.
Die Wahl zwischen diesen verschiedenen Wegen wird nicht einfach sein. Jeder Akteur muss für sich bestimmen, was am sinnvollsten ist. Doch je mehr der geopolitische Chaos zunimmt, desto schneller müssen sich alle Akteure anpassen lernen – auch diejenigen, die glauben, die Welt werde sich kaum verändern. Das bedeutet, dass alle Beteiligten ernsthaft daran arbeiten müssen, finanzielle, personelle und operative Resilienz aufzubauen.
Beispielsweise sollten Unternehmen und Investoren mehr liquide Mittel vorhalten, ihre Bilanzen stärken, ihre Lieferketten und Portfolios diversifizieren, innovativere Instrumente nutzen, stärker in die Weiterbildung der Mitarbeitenden investieren und ihre Kommunikation effektiver gestalten. Entscheidungsträger müssen außerdem versierter darin werden, Zukunftsszenarien zu entwerfen (Game Plan), ihre Strategien einem Stresstest zu unterziehen und potenzielle Schwachstellen zu identifizieren. Dies erfordert, dass lokale Einheiten, Behörden und Individuen befähigt werden, Szenarien zu entwickeln und Stresstests durchzuführen.
Letztlich dürfen Entscheidungsträger nicht in Verhaltensfallen tappen. In Zeiten der Unsicherheit sind Menschen anfälliger für kognitive Verzerrungen, die zu schlechten Entscheidungen führen. Dies beschränkt sich nicht nur auf die Verleugnung von Veränderungen. Häufig handelt es sich um das, was Verhaltenswissenschaftler als „aktive Trägheit“ (active inertia) bezeichnen: Akteure erkennen zwar, dass Veränderungen nötig sind, klammern sich jedoch weiterhin an vertraute Muster und Methoden.
Ein eindrückliches Beispiel hierfür ist das Schicksal von IBM. Anfang der 1980er Jahre geriet der starke Fokus des Unternehmens auf Großrechnertechnologie (Mainframe Computing) durch den Aufstieg der Personal Computer ernsthaft unter Druck. Der Verwaltungsrat und das Top-Management trafen strategisch die richtige Entscheidung, Ressourcen, Personal und Innovationen auf die PC-Produktion umzulenken. Doch der Übergang scheiterte daran, dass die Führungskräfte Schwierigkeiten hatten, Mitarbeitende und Ressourcen aus vertrauten Bereichen wegzuführen. Infolgedessen fiel das Unternehmen gegenüber neuen Konkurrenten rasch zurück und musste sich im Grunde zu einem Dienstleistungsunternehmen wandeln, um zu überleben. Seine einst dominante Marktposition konnte es nie wieder zurückgewinnen.
Seien Sie mutig
Die Welt durchlebt eine Phase großer Unsicherheit. Es gibt nur noch wenige Prinzipien, Regeln oder Institutionen, auf die sich Behörden und Investoren verlassen können. Die US-Wirtschaft wird zunehmend instabiler, Washington beteiligt sich weniger an globaler Politikkoordination. Nach fast 80 Jahren steht das globale Handelssystem vor der Gefahr des Zerfalls. Die Zukunft ist völlig ungewiss.
Das ist an sich keine schlechte Nachricht, bedeutet aber, dass Entscheidungsträger äußerst wachsam sein müssen. Die in den kommenden Monaten getroffenen Entscheidungen werden tiefgreifende Auswirkungen auf die Zukunft der Weltwirtschaft und das Wohlergehen von Milliarden Menschen haben. Staatliche Akteure müssen bescheiden sein, doch es ist nicht die Zeit für Vorsicht. Vielmehr ist jetzt die Zeit für Mut, Kreativität, fantasievolle Szenarioplanung und das Infragestellen bestehender Gewissheiten.
Die bevorstehenden Aufgaben sind nicht leicht. Sie erfordern ein radikales Umdenken in der Steuerung von Wirtschaft, Unternehmen und Investitionen. Doch Führungspersönlichkeiten können und sollten dieser Herausforderung begegnen. Denn dank der bald bevorstehenden Verbreitung spannender Innovationen kann die Welt diese Krise nicht nur überstehen, sondern gestärkt und wohlhabender daraus hervorgehen.
*Mohamed A. El-Erian ist Präsident des Queens’ College der Universität Cambridge und Renee Kerns Professor für Praxis an der Wharton School der University of Pennsylvania. Von 2007 bis 2014 war er CEO von Pacific Investment Management Company (PIMCO).