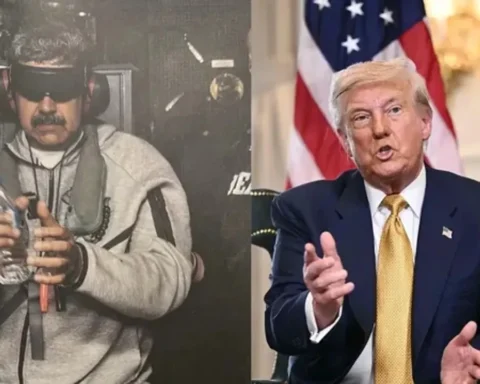Es scheint so gut wie sicher, dass das Treffen stattfinden wird – doch wer am meisten gewinnen oder verlieren wird, bleibt weiterhin ungewiss.
In der kommenden Woche dürfte das erste Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands, Donald Trump und Wladimir Putin, seit Trumps zweiter Amtsübernahme stattfinden – der Kreml hat das Zusammenkommen bereits bestätigt.
Über Einzelheiten, einschließlich Datum und Ort des Gipfels, ist bislang wenig bekannt; Putin deutete jedoch während eines Besuchs des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed Bin Zayed, in Moskau an, dass das Treffen möglicherweise in den VAE stattfinden könnte.
Im Zentrum der Trump-Putin-Agenda steht das Ende des Krieges in der Ukraine; jedoch werden voraussichtlich auch breitere Themen wie globale Stabilität, Rüstungskontrolle, die Lage im Nahen Osten, Iran, Handel und Sanktionen zur Sprache kommen.
Die Einigung auf das Treffen erfolgte nach Gesprächen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit Putin in Moskau; Trump bezeichnete diese Gespräche als „großen Fortschritt“.
Diese Wortwahl stellt eine deutliche Abkehr von Trumps in den vergangenen Wochen schärferem Ton gegenüber Putin dar. Das lässt vermuten, dass Witkoffs diplomatische Bemühungen möglicherweise eine rasche Eskalation der US-russischen Spannungen verhindert haben könnten, die viele nach Ablauf von Trumps Ultimatum vom 8. August zur Waffenruhe in der Ukraine befürchtet hatten.
Was steckt hinter diesem plötzlichen Kurswechsel? Eine mögliche Erklärung ist, dass Putin angesichts der drohenden verheerenden Sekundärsanktionen gegen Abnehmer russischen Öls – darunter China, Indien und Brasilien – dem Druck nachgegeben haben könnte. Doch Trumps Auftreten seit dem Ultimatum spricht eher dagegen – Putin scheint nicht mehr so bereit zu sein, US-Präsidenten durch umfassende Zugeständnisse zu beeinflussen, da er weiß, dass sich die Politik mit jeder Administration dramatisch ändern kann.
Zudem könnte Moskau nach drei Jahren harter Sanktionen zu dem Schluss gekommen sein, dass der Westen nur noch über wenige wirksame Hebel verfügt, um einen Konflikt, den Russland als existenziellen Kampf betrachtet, strategisch entscheidend zu beeinflussen.
Alternativ könnte diesmal Trump derjenige sein, der bereit ist, größere Zugeständnisse zu machen als bisher angenommen. Das würde erklären, warum Moskau die „neuen US-Angebote“ nach Witkoffs Besuch als akzeptabel einstufte.
Trumps offenbarers Rückzieher dürfte vor allem auf das Scheitern seiner Zollandrohungen gegenüber Indien und China zurückzuführen sein. Beide Länder wiesen den Vorschlag, auf russische Öllieferungen 100 % Zoll zu erheben, als Verletzung ihrer souveränen Handelsrechte zurück. Auch wenn Sanktionen kurzfristig wirtschaftliche Probleme verursachen könnten, sind beide Länder nicht bereit, bei diesem Grundsatz einzulenken.
Darüber hinaus behält China ein starkes Druckmittel in der Hand – wie bereits Anfang des Jahres könnte es als Vergeltung den Export seltener Erden beschränken, die für die US-Industrie und Verteidigung von entscheidender Bedeutung sind.
Aus geopolitischer Sicht birgt es für Trump das Risiko, China und Indien einander näherzubringen, wenn er beide gleichzeitig unter Druck setzt. Angesichts der Tatsache, dass Washington in den letzten Jahren gezielt versucht hat, Indien unter Premierminister Modi als Gegengewicht zu China an sich zu binden, wäre ein gemeinsames Auftreten dieser beiden asiatischen Großmächte gegen die USA für Washington ein erheblicher strategischer Rückschlag. Erste Folgen sind bereits sichtbar: Modi plant seinen ersten China-Besuch seit sieben Jahren, während sich die Spannungen mit den USA verschärfen.
Noch bedeutsamer ist, dass sowohl Peking als auch Neu-Delhi derzeit offenbar auf Moskau zugehen – ein Umstand, der sich zeigte, als Putin am Tag nach der US-Zollankündigung Modis Nationalen Sicherheitsberater auf höchster Ebene empfing. Die geopolitische Neuorientierung komplettierte Brasiliens Präsident Lula mit seinem Vorschlag, dass die BRICS-Staaten eine gemeinsame Haltung gegen die US-Zollmaßnahmen einnehmen sollten.
Trump könnte in dieser Zwickmühle im Dialog mit Moskau einen Ausweg aus der selbst geschaffenen Sackgasse suchen: Die Durchsetzung seiner Zollandrohungen würde wirtschaftlich schädliche Folgen und geopolitische Verschiebungen wie eine stärkere BRICS-Positionierung und Indiens Abkehr von Washington nach sich ziehen; ein Rückzieher sowohl bei den Zöllen als auch beim Ultimatum an Putin in Sachen Ukraine würde jedoch Trumps Glaubwürdigkeit massiv beschädigen.
Um Putins tatsächliche Kooperation zu gewinnen – und nicht nur Hinhaltetaktiken – müsste Trump auf die zentralen Kriegsforderungen Russlands eingehen: die offizielle Anerkennung der territorialen Gewinne, die Garantie der Neutralität der Ukraine (unter Ausschluss einer NATO-Mitgliedschaft) sowie eine Reduzierung der ukrainischen Streitkräfte auf ein Niveau, das Moskau nicht als Bedrohung betrachtet.
Die jüngste Erklärung von US-Außenminister Marco Rubio, dass „territoriale Fragen“ im Mittelpunkt der Friedensgespräche stehen, deutet darauf hin, dass Washington möglicherweise bereit ist, dieses Thema mit Moskau zu verhandeln. Russland beharrt auf der Kontrolle über die Krim und vier Oblaste im Donbass und verlangt deren offizielle Anerkennung. Die USA hatten bisher nur bei der Krim ein Zugeständnis signalisiert und den Status des Donbass offen gelassen. Rubio vermied es auffällig, zu sagen, welche territorialen Zugeständnisse derzeit in Betracht gezogen werden.
Natürlich lehnt die Ukraine, gestützt auf die Unterstützung Europas, diese Forderungen weiterhin ab. Washington könnte jedoch versuchen, Kiew unter Druck zu setzen, indem es die sich verschlechternde Lage der Ukraine auf dem Schlachtfeld und Präsident Selenskyjs politische Verwundbarkeit ausnutzt – insbesondere das Missmanagement im Zusammenhang mit der Auflösung und anschließenden, unter westlichem Druck erfolgten Wiederherstellung der Antikorruptionsbehörde.
Ein möglicher Kompromiss könnte in Form eines Gebietstauschs erfolgen: Russland zieht sich aus den derzeit besetzten Gebieten zurück und erhält im Gegenzug die offizielle Kontrolle über die noch nicht besetzten Teile der vier Donbass-Regionen. Im Gegenzug müsste Moskau von seinem selektiven Vorgehen abrücken und einen umfassenden sowie sofortigen Waffenstillstand verkünden.
Sollte eine solche Regelung als umsetzbar gelten, könnte sie den Weg für umfassendere Friedensgespräche ebnen. Ein bescheideneres Ergebnis des Gipfels könnte hingegen ein einfacher, direkter Waffenstillstand sein – dieser wurde von der Ukraine bereits akzeptiert, bisher jedoch von Russland abgelehnt. Ein solcher Waffenstillstand könnte die aktiven Kampfhandlungen beenden und Menschenleben retten; er würde jedoch entlang der derzeitigen Frontlinien einen eingefrorenen Konflikt hinterlassen, der typischerweise mit Unsicherheit und Instabilität einhergeht.
Alternativ könnte der Gipfel auch ohne eine Einigung in der Ukraine-Frage enden. Dies würde die Parteien zwingen, sich auf andere Spannungsfelder in ihren bilateralen Beziehungen zu konzentrieren – etwa die Erneuerung von Rüstungskontrollabkommen, Spannungen im Nahen Osten oder das iranische Atomprogramm. Solange jedoch beim Thema Kriegsbeendigung kein Fortschritt erzielt wird, ließen sich solche Entwicklungen kaum als Erfolg werten.
Das Treffen selbst bleibt fragil. Ein groß angelegter Angriff in der Ukraine mit hohen Verlusten oder Meinungsverschiedenheiten über das Format – etwa die angebliche Forderung Trumps nach einer Teilnahme Selenskyjs, die er später zurückzog, sowie Putins bedingter Widerstand gegen eine solche Teilnahme – könnten dazu führen, dass die Gespräche scheitern, noch bevor sie begonnen haben.
Ein Scheitern hätte schwerwiegende Folgen: eine neue Eskalation auf dem Schlachtfeld, eine Verschärfung der Spannungen zwischen Russland und dem Westen sowie die Zerschlagung der Hoffnungen von Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern. Nach drei Jahren eines erbarmungslosen Krieges sind laut den jüngsten Gallup-Daten 70 % der Ukrainerinnen und Ukrainer für einen sofortigen Beginn von Verhandlungen; ein gescheiterter Gipfel würde diese Tragödie daher noch weiter vertiefen.
*Eldar Mamedov ist ein in Brüssel ansässiger Außenpolitikexperte und Gastforscher am Quincy Institute.
Quelle: https://responsiblestatecraft.org/trump-putin-meeting-ukraine/