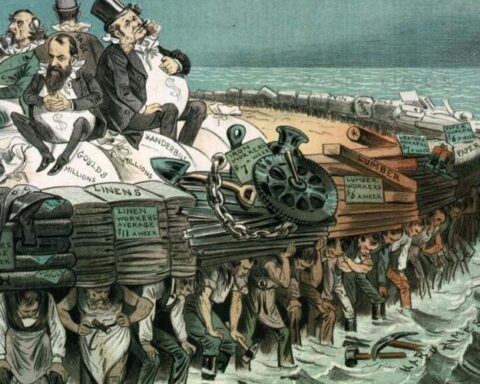Als Şevket Süreyya Aydemir in seiner Autobiographie Suyu Arayan Adam (Der Mann, der Wasser sucht) von seiner Kindheit in Edirne erzählt, betont er, dass die größte Enttäuschung der Bevölkerung nicht darin bestand, dass die Stadt in Ruinen lag, sondern dass sie einst Hauptstadt gewesen war und sich nun in eine verlassene Grenzstadt verwandelt hatte. Wie konnte es geschehen, dass diese frühere Residenzstadt der Sultane nun zu einer hilfsbedürftigen Grenzstadt herabsank und für die aus dem Balkan kommenden Menschen zum Zufluchtsort wurde? Aydemir überliefert sogar den Satz einer Frau, die ihr Haus besuchte: „Evvel Şam’dı, ahir de Şam’dır!“ – „Anfangs war es Damaskus, am Ende wird es wieder Damaskus sein!“ Das bedeutet, dass die Menschen beim Anblick der verlorenen Gebiete davon ausgingen, man werde schließlich bis in das einstige Herkunftsland Damaskus zurückgedrängt. Verlust und Exil sind prägende Faktoren, die das kollektive Gedächtnis von Völkern formen und sie zugleich zur Wiedererrichtung antreiben. Mit der Moderne haben die meisten Gesellschaften des als „Orient“ bezeichneten Raumes in irgendeiner Form das Exil erlebt, und diese Erfahrungen haben in ihnen einen starken Antrieb erzeugt, kulturelle und politische Errungenschaften zu bewahren.
Seit beinahe hundert Jahren lebt das palästinensische Volk im Exil – vor allem in den Nachbarländern Libanon, Jordanien, Syrien und Ägypten, aber auch verstreut in der ganzen Welt. Zeitgleich mit ihrem Exil begann auch die zionistische Bewegung, deren unter dem Namen „nationale Expansion“ betriebenen Besatzungspläne den Palästinensern in der Diaspora sowohl politisch als auch sozial als Motivationsquelle zur Organisierung dienten. Doch die politische und wirtschaftliche Macht der den Zionismus unterstützenden Lobbys zwingt das palästinensische Volk, auch im Exil ein weiteres Exil zu erleiden. Jeder, der den Völkermord in Gaza beim Namen nennt, wird auf irgendeine Weise schikaniert, aus Arbeits- wie auch aus Bildungszusammenhängen herausgedrängt. Und besonders, wenn man Kind eines Volkes in der Diaspora ist, wird man mit einem neuen Exil bedroht und einzuschüchtern versucht.
„Diaspora“ bedeutet wörtlich „Abtrennung vom Mutterland“. Dem Begriff ist also ein Hinweis auf Zentralität eingeschrieben. Von einem Volk in der Diaspora wird erwartet, dass es ein Bewusstsein für sein Mutterland bewahrt und eine politische Sprache entwickelt, die auf die Rückkehr dorthin ausgerichtet ist. Dieses „Rückkehr“-Narrativ und das von ihm geschaffene kulturelle Geflecht erlauben niemals, auf dem Boden des Exils dauerhaftes Glück aufzubauen. Das Leben wie auch alle aufgebauten Strukturen bleiben stets nur provisorisch. Denn das gesamte politische und kulturelle Gefüge wird von der Hoffnung auf eine künftige „Rückkehr“ getragen. Für das palästinensische Volk liegt das Zentrum dieser Rückkehr im heiligen Jerusalem und den es umgebenden alten Städten. Für die Palästinenser wie auch für das syrische Volk, das erst durch das Massaker von Hama, später durch den Bürgerkrieg seit 2011 in die Zerstreuung gedrängt wurde, ist Rückkehr nicht nur ein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit. Die anhaltende Rolle als Bürger zweiter Klasse schafft soziale, ökonomische und politische Zwänge, die die Rückkehr zur unausweichlichen Forderung machen.
Juden in der Diaspora
Doch lässt sich Ähnliches auch für das jüdische Volk sagen, das seit den 1930er Jahren verstärkt nach Palästina zog? Während fast alle im Exil lebenden Völker der Welt aus den Spuren ihrer Vorfahren emotionale Bindungen und ein kulturelles Gedächtnis schöpfen, um in das Mutterland zurückzukehren, stellt die „Rückkehr“ für die jüdische Gesellschaft eher eine theologisch gebotene religiöse Pflicht oder ein Ritual dar. Wie die Beispiele zeigen, ruft der Versuch, eine religiöse Aufgabe zu erfüllen, eine besondere Sehnsucht hervor, die zugleich Radikalismus im Verhältnis zum Anderen begünstigt. Heute ist bekannt, dass ein erheblicher Teil der israelischen Bevölkerung aus Polen, Deutschland und den USA stammt. Später kamen Juden aus arabischen Ländern, aus Russland und aus Äthiopien hinzu, die ab 1948 durch die Besetzung palästinensischer Häuser und Ländereien in Jerusalem und Umgebung angesiedelt wurden. Betrachtet man die ökonomische und politische Macht, die sie in jenen Ländern aufgebaut hatten, so zeigt sich, dass sie von der Rückkehrrhetorik klassischer Diaspora-Gemeinschaften weit entfernt waren. Dass sie bis heute ihre Besatzungs- und Völkermordpläne mit der Zustimmung und Billigung der USA ausführen, weist darauf hin, dass ihr eigentliches Zentrum nicht im Nahen Osten, sondern in Amerika liegt. Keine andere Diaspora-Erzählung kennt ein derart enges Geflecht aus emotionalen, wirtschaftlichen und politischen Bindungen an ein Land außerhalb des „Heimatbodens“. Daher ist es notwendig, auf eine Art von fiktiver Geschichtsschreibung zu achten, die ähnlich wie die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene zionistische Propaganda eine Sprache der Opferrolle erzeugt.
Die Zerstörung des salomonischen Tempels im Jahr 70 n. Chr. deutet die jüdische Gemeinde als Beginn einer „Heimatlosigkeit“ und als Zäsur ihrer Geschichte. Zwar mischen sie in ihrer Erzählung das Exil mit Theologie und produzieren so eine stark emotionalisierte Darstellung, doch die offenen Türen, die ihnen tatsächlich geboten wurden, finden darin kaum Platz. So erlaubte etwa Kyros der Große, der Herrscher des Perserreiches (Achämenidenreich), den Juden die Rückkehr nach Jerusalem und den Wiederaufbau des Tempels. Im Alten Testament wurde Kyros sogar zum „Gesalbten“, also zum Messias oder Propheten erklärt. In der Konstruktion einer europazentrierten Geschichtsschreibung, in der jüdische Intellektuelle maßgeblich an der Herausbildung des europäischen Denkens beteiligt waren, spielte man diese Tatsache jedoch herunter. Denn diese Erzählung ging davon aus, dass die als „Orient“ bezeichnete Zivilisation kein Subjekt in der Geschichte des Denkens sei und aus der politischen Geschichte gänzlich herausfalle. Folgerichtig fand Kyros darin keinen Platz; stattdessen wurde der in den heiligen Schriften erwähnte „Zülkarneyn“ mit Alexander dem Großen gleichgesetzt. Sogar die Möglichkeit, dass Zülkarneyn ein Makedonier gewesen sein könnte, wurde abgelehnt und er wurde als „Ahnherr der Griechen“ dargestellt – eine weitere These der europazentrierten Geschichtskonstruktion. Obwohl Kyros’ geographischer Weg weit mehr Parallelen zur Zülkarneyn-Erzählung aufweist, wurde er aus der Geschichtsschreibung verdrängt, weil dies das dramatisch gezeichnete Opfer-Narrativ geschwächt hätte.
Doch die auf „Heimatlosigkeit“ gegründete Geschichtserzählung wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts zum Rahmen einer politischen Theorie und trat als Zionismus auf. Dass sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg als die einzige „würdevolle Opfergemeinschaft“ inszenierten und sich in Bereichen wie Film und Literatur in den Mittelpunkt des Diskurses stellten, überschneidet sich mit dieser historischen Erzählung. Demnach erscheint die These eines Volkes, das als das am meisten leidende gilt und dessen Leid durch Flucht und Exil gereift sei, in allen Bereichen. Der mit der Besetzung Palästinas gegründete Staat Israel, der sich jedoch rasch zu einer militärischen und ideologischen Basis der Kolonialmächte entwickelte, wurde am Ende dieser Opfergeschichten als großer Gewinn präsentiert. Dieser Gewinn wird von den Theoretikern des Zionismus nicht nur als eigener Sieg gedeutet. Vielmehr wird – wie wir nach dem 7. Oktober auch in der Türkei erleben konnten – besonders in den Medien beständig das Bild Israels als „einziger demokratischer und moderner Staat des Nahen Ostens“ als Gewinn für die gesamte Menschheit vermittelt und tief in unser Bewusstsein eingeprägt. Folglich wurde die Besetzung Palästinas und der dort verübte Völkermord als Argument der Zivilisation gegen die Barbarei dargestellt. Netanyahu selbst griff auf das Dualismus-Schema „Dunkelheit–Licht“ zurück, das seit dem 17. Jahrhundert den europazentrierten Geschichtsbegriff prägt und die theoretisch-konzeptionelle Grundlage des Kolonialismus bildete – und lud damit die Weltöffentlichkeit faktisch auf die Seite Israels gegen Palästina.
Liegt die Schuld allein bei Netanyahu?
Nicht nur in der Türkei, sondern auch international nehmen politische Akteure im Hinblick auf den begangenen Völkermord stets die israelische Regierung ins Visier, statt das System, das den Staat Israel hervorgebracht und gestärkt hat. Zwar ist bekannt, dass Israel seit den 1970er Jahren von rechtsgerichteten Regierungen mit fanatischer Basis regiert wird. Doch die seit den 1930er Jahren praktizierte Vertreibungspolitik und die zahlreichen Massaker nach der Staatsgründung zeigen, dass die Praktiken, die Israel als Staat hervorgebracht haben, unabhängig von der Identität der jeweiligen Regierung sind. So besiegte etwa 1992 Jitzchak Rabin von der Arbeiterpartei die Likud-Partei, die zu verschiedenen Zeiten von fanatischen Führern wie Netanyahu, Scharon oder Begin mit einer langen Blutspur des Völkermords angeführt worden war. Rabin leitete Schritte in Richtung einer Lösung ein, wurde jedoch von fanatischen Juden durch ein Attentat ermordet. Folglich ist die These, Netanyahu als Sündenbock zu brandmarken und in seiner Abwesenheit auf ein friedlicheres Israel zu hoffen, historisch bereits dutzendfach von selbst widerlegt worden.
Die heutzutage häufig vorgebrachte Behauptung einer Zwei-Staaten-Lösung ist aufgrund des Machtungleichgewichts und der Tatsache, dass die vermeintlich zivile israelische Bevölkerung durch ihre Siedlungspolitik eine militärische Rolle übernommen hat, wenig realistisch. Eine Zwei-Staaten-Lösung zu fordern, solange Israel die Macht innehat und fortwährend – ob mit oder ohne Begründung – den Palästinensern ihre legitimen Rechte entzieht, würde die kollektive Erinnerung ignorieren und keine realistische Lösung bieten. Stattdessen erscheint ein inklusiver palästinensischer Staat, der auf einer „Bürgergemeinschaft“ basiert, in der auch jene Juden, die weder Völkermord noch Zionismus unterstützen, die gleichen Rechte genießen wie die übrige Bevölkerung, als das Modell mit dem größeren Potenzial, künftige Konflikte zu verhindern.