Wenn Heidegger nicht im badischen Meßkirch, nahe der Grenzen zu Frankreich und zur Schweiz, sondern in einer Küstenstadt geboren wäre – freilich in einer katholischen Küstenstadt – und wenn er sich im Jahr 1922, statt der kleinen Hütte am Rande des Schwarzwalddorfes Todtnauberg, wo er den größten Teil seiner Werke verfasste, gelegentlich Kollegen, Freunde und Schüler empfing, zumeist aber allein oder mit seiner Frau lebte, lange Spaziergänge auf den Pfaden unternahm und mitunter Ski fuhr, eine Fischerhütte am Meer gebaut hätte – würde er dann vom selben Sein sprechen, wenn er über das Sein nachdächte wie dort, in seiner Berghütte?
Diese Frage kam mir beim Lesen der Seiten von İbrahim Kalıns Buch Die Reise zu Heideggers Hütte, das von seinem Besuch in Heideggers Todtnauberg-Hütte im Jahr 2019 handelt – einem Besuch, dessen einleitenden Teil Kalın bereits früher teilweise veröffentlicht hatte. Besonders die Abschnitte, in denen das Verhältnis zwischen Sein und seiner Repräsentation erörtert wird, das Kalın so zusammenfasst: „Das, was wir mit Worten und Begriffen ausdrücken – und darunter fällt natürlich auch das Wort oder der Begriff Sein – ist nicht das Sein selbst, sondern seine Darstellung in Sprache und Denken“ (S. 42).
Hätte Heidegger also in einer Fischerstadt das Licht der Welt erblickt und sich dort eine kleine Hütte am Meer oder auf einer Anhöhe mit Blick auf das Meer erbaut, wären dann sowohl seine eigenen Texte über die Hütte – insbesondere der Aufsatz, in dem er sie als seine „Arbeitswelt“ bezeichnet und der auf Englisch unter dem Titel Why Do I Stay in Province? bekannt ist – als auch etwa Adam Sharrs Studie Heideggers Hütte (ins Türkische von Engin Yurt übersetzt, 2016 bei Dergah erschienen) und ähnliche Werke, die in deren Bibliographie aufgeführt sind, dieselben geblieben?
Und hätte İbrahim Kalın stattdessen ein Buch mit dem Titel Die Reise zu Heideggers Fischerhütte geschrieben – hätte er dann über dasselbe gesprochen?
Fast alle, die über Heideggers Hütte geschrieben haben – Heidegger selbst, Kalın eingeschlossen –, sind sich nahezu einig, dass seine Sicht auf das Landleben seine Überlegungen zum Sein maßgeblich geprägt hat. Zudem hebt Heidegger, wie Kalın in dem eigens mit der Überschrift „Wird auf dem Land Philosophie betrieben?“ versehenen Kapitel ausführlich darlegt, hervor, dass „die Arbeit des Bauern“ und „die Arbeit des Philosophen“ aus derselben Quelle entspringen. Wenn er schreibt: „Wenn in einer harten Winternacht ein heftiger Schneesturm über die Hütte hereinbricht und alles bedeckt und verhüllt, dann ist dies die vollkommenste Zeit für Philosophie“, betont er, dass sowohl die körperliche Arbeit des Bauern – der etwa einen Schlitten voller schwerer Baumstämme den Hang hinabbringt, oder der Hirt, der in Gedanken versunken seine Herde über die Hügel treibt, oder das Paar, das unzählige Balken für die Dachreparatur vorbereitet – als auch die geistige Arbeit des Philosophen von demselben „einfachen und grundlegenden“ Prinzip ausgehen. Damit richtet er seinen Blick nicht nur auf das Leben auf dem Land, sondern auch auf die Bauern selbst – im Gegensatz zu den Städtern, die das Aufsteigen auf den Berg oder das Wandern über Felder nur als „anregend“ empfinden.
Doch wenn Heidegger nicht in einem Schwarzwalddorf, sondern etwa an der Ostseeküste geboren wäre – sagen wir in einer katholischen Fischerstadt nahe Königsberg –, hätte er auch auf die Seeleute mit demselben Blick geschaut, mit dem er die Bauern sah?
Diese Fragen – in unterschiedlicher Form, aber stets im Hinblick auf den Zusammenhang von „Repräsentation“ gestellt – mögen auf den ersten Blick alle annähernd dieselbe Antwort zuzulassen scheinen.
Auch der Fischer verrichtet Arbeit: wenn er sein Boot hinaus aufs Meer führt, das Steuer gegen die tobenden Wellen in der Balance zu halten versucht, sein Netz auswirft, um Fische zu fangen, und es – nun schwerer, beladen mit Fischen (und vielleicht auch mit allerlei Unrat, der ins Meer geworfen wurde) – wieder einholt. Und hätte Heidegger seine Hütte nicht im Schwarzwald, sondern am Rande eines Fischerdorfes am Meer errichtet, dann wäre seine Behausung vielleicht nicht vom Schneesturm, sondern vom Aufprall wilder Sturzwellen erschüttert worden, die – begleitet vom grollenden Tosen des Meeres – auf das Dach gepeitscht hätten. In einem solchen Moment hätte Heidegger diese Erfahrung wohl ebenfalls als die „vollkommenste Zeit für Philosophie“ deuten können.
Doch es ließe sich auch ein anderer Weg einschlagen. Etwa indem man – wie Carl Schmitt – darauf hinweist, dass der Mensch ein „Wesen des Landes“ ist: Das an die Erde gebundene Leben (die Territorialität) ermöglicht das Ziehen von Grenzen und das Entstehen eines auf den Boden gegründeten Rechtsraums, während der Mensch auf dem Meer, wo keine Grenzen gezogen werden können, in der „Offenheit“ lebt. Obwohl das Meer also als grenzenloser Raum gelten muss, haben die Engländer, ursprünglich „Hirten des Landes“, diesen Raum zu ihrem Element gemacht, indem sie das landgebundene Recht in eine Logik des offenen Meeres verwandelten – und damit, wie Schmitt sagt, den Nomos selbst entorteten. In diesem Rahmen könnte man auch darauf hinweisen, dass Heidegger – obgleich er, besonders vermittelt durch Hölderlins Hymne Der Ister, oft über den „Fluss“ nachgedacht hat – kaum über das „Meer“ reflektierte (sieht man von wenigen Verweisen auf die Ägäis über Hölderlin ab). So ließe sich das Problem auch auf die unterschiedlichen Logiken der „Inselvölker“ – der Briten und der ihnen folgenden Amerikaner, die mit der Logik des offenen Meeres eine neue Weltordnung zu errichten suchten – beziehen.
Doch selbst dieser Gedanke lässt nicht vergessen, dass London, in jener Zeit, als die Briten noch „Hirten“ waren, ursprünglich ein „Fischerdorf“ war – und (so heißt es in einer Überlieferung) eines Tages wieder zu einem werden könnte. (In ähnlicher Weise analysiert Derrida in seiner Lektüre von Fichtes Reden an die deutsche Nation – einem Text, in dem sich tiefer Nationalismus und ein zugleich humanistischer Kosmopolitismus verschränken – das Wort Geschlecht und seine Ableitungen mit ihren Bedeutungen wie „Sexualität, Rasse, Gattung, Geschlecht, Abstammung, Familie, Generation oder Geschlecht“, um zu zeigen, in welchem Verhältnis sie zu „Heideggers Hand“ und „Heideggers Ohr“ stehen.)
Unsere eigentliche Frage ist also nicht, Heideggers „philosophischen Nationalismus“ mit anderen „philosophischen Nationalismen“ zu vergleichen oder zu untersuchen, inwiefern jeder Nationalismus – selbst philosophisch gedacht – ein Bedürfnis nach einer „Heimat“ ausdrückt. Die Frage ist vielmehr: Wie lässt sich das Sein denken – und darüber hinaus: wie lässt es sich „repräsentieren“?
Wie Heidegger in seiner Auslegung von Hölderlins Hymne Der Ister (S. 30) wiederholt betont, denkt er den „Fluss“ nicht als Bild oder Metapher einer „Reise“. Der „Fluss“ ist das Reisen selbst. Während das christliche Denken die Reise als Bild eines Weges von der Geburt zum Tod versteht – als Bewegung durch eine vergängliche, irdische Welt –, bedeutet für Heidegger „die Reise, die der Fluss selbst ist“, dass das Dasein der Menschen „den Weg findet, um auf Erden beheimatet zu sein“. Der „Fluss, der selbst das Reisen ist“, „herrscht“ – und zwar dadurch, dass er die Welt (die Erde, den Grund, den Boden) als den Ort der Beheimatung eröffnet.
In diesem Sinn ist es nicht möglich, von einer ‚Reise des Meeres‘ zu sprechen. Das Meer steht nicht in jenem heimatlichen Verhältnis zur Erde, wie es der Fluss tut; es ist gänzlich offen. Doch diese Offenheit ist keine „Lichtung“, in der sich das Sein zeigen könnte – sie ist eine gleichförmige, monotone Weite. Zwischen dem Meer und dem menschlichen Dasein lässt sich im Hinblick auf das Sein keine Beziehung denken. Der Fluss hingegen – der zugleich er selbst und das Reisen ist – findet, sofern er in seinem Grund (dem Boden, über den er fließt) nach seiner Offenheit sucht, darin seine Erfüllung, seine Heimkehr.
Merkwürdigerweise endet Heideggers Denken des „Flusses“, bevor dieser das Meer erreicht – bevor der Fluss im Meer seine Vereinigung findet. Darum bleibt die Offenheit des „Meeres“ für Heidegger wohl etwas „Unheimliches“. Grenzenlos, uferlos, horizonlos, gleichförmig – so würde sie ihm erscheinen. Der berühmte Begriff des Abgrunds, den man als „Abgrund“ übersetzen kann, könnte sich im Meer leicht in einen „Strudel“ – einen Maelstrom – verwandeln.
Wenn man all dies im Sinn behält und zum Beispiel des Bauern und des Fischers zurückkehrt, tritt ein weiteres Problem zutage:
Das zentrale Tun des Bauern – das „Samen“-Säen – lässt sich vielleicht noch in einer Repräsentationsbeziehung denken: Der Same „repräsentiert“ den Weizen, der aus ihm hervorgeht, oder – in der Umgebung von Heideggers Hütte – die „Wurzel“ eines Baumes „repräsentiert“ die Art des Baumes, etwa ob es sich um eine Fichte oder eine Tanne handelt. Vielleicht.
Für den Fischer jedoch ist eine solche Repräsentationsbeziehung äußerst problematisch. Was etwa „repräsentiert“ das Hauptmaterial seiner Arbeit, oder was wäre die „Wurzel“ des Meeres, das ihn umgibt? Der Fischer ist ein Mensch, der fischt, dessen „Arbeit“ also auf das Fangen von Fischen gerichtet ist. Dazu wirft er sein Netz ins Meer und zieht es wieder ein. Kurz gesagt: Er zieht mehr heraus, als er hineingeworfen hat. Weder das ausgeworfene Netz noch die eingefangenen Fische enthalten ein „Samen-“ oder „Wurzelwesen“ (oder sagen wir: ein „Wesen“). Sie dienen lediglich dem Transport: Das Netz überträgt etwas aus dem Meer in das Boot – sei es ein Fisch oder, zufällig, ein alter Schuh, der ins Meer geworfen wurde. Genau darin liegt das Problem des „Repräsentierens“ für den Fischer: Was er einholt, ist nie genau das, was er auswarf – es gibt immer ein „Mehr“.
Wie also würde ein Fischer das Sein denken?
Da er es nicht im Modus des „Samenhaften“ oder „Wurzelhaften“ denken könnte – also im Modus des Erscheinens eines im Innersten Verborgenes –, müsste er es wohl im Modus des Übertragens, des Vermittelns, des „Überbringens“ denken: durch das, was im Netz gefangen und heraufgeholt wird. Das Sein erschiene ihm somit nicht als das „Wesentliche“, sondern als das „Übertragene“. Kurz: Zwischen dem ins Meer geworfenen und dem wieder eingeholten Netz lässt sich keine Repräsentationsbeziehung herstellen.
Wenn Heidegger also in einem Fischerdorf geboren worden wäre, hätte er seine Behausung vielleicht dennoch als seine „Arbeitswelt“ bezeichnen können. Doch er hätte jene in seiner Hütte erlebte Erfahrung der Einsamkeit – die er, im Gegensatz zur Einsamkeit der Stadt, als eine „Einsamkeit [mönchischer Art]“ beschreibt, die „uns nicht isoliert, sondern unser ganzes Dasein in die weite Nähe des Seins [Wesen, presence] hinauswirft“ – nicht in derselben Weise formulieren können. Denn die Metapher, die er im selben Aufsatz verwendet – „Etwas in die Logik der Sprache zu bringen, gleicht dem Widerstand der gewaltigen Tannen gegen den Sturm“ – wäre ihm verwehrt geblieben.
Am Meer wachsen keine Tannen. Und an die Angel des Fischers könnten sich statt Fischen ebenso gut ein alter Stiefel, eine vom Liebhaber vergessene Flaschenpost oder – heute – eine Plastiktüte oder Coladose hängen. Doch das Meer verschlingt alles – selbst die Titanic. Es verwandelt sogar das Wasser des Flusses, der in es mündet, in sich selbst.
Von hier aus betrachtet, erhält auch İbrahim Kalıns Reise zu Heideggers Hütte eine neue, leicht augenzwinkernde Dimension: Die Vorstellung, Heideggers Schwarzwaldhütte in eine Fischerhütte zu verwandeln, gewinnt an Sinn.
Zum einen deshalb, weil eine schelmische Annäherung an Heidegger keineswegs bedeutet, sich von seinem Denken zu entfernen. Ich erinnere mich an meinen Philosophieunterricht bei Charles P. Bigger im zweiten Semester des akademischen Jahres 1992/1993. Er ließ uns Heideggers Sein und Zeit lesen. Einst ein überzeugter Historiker der angelsächsischen analytischen Philosophie, hatte er – wie in Cahit Sıtkı Tarancıs Versen vom „Weg zur Mitte des Lebens“ – mitten im Weg die Richtung geändert und sich der kontinentalen Philosophie zugewandt, wodurch er beide Traditionen miteinander zu verbinden wusste. Bigger blickte stets mit einem leisen Schmunzeln auf Heideggers Begriffe und Sätze. Er las eine Passage – und lachte dann leise vor sich hin.
Was mir anfangs befremdlich vorkam, verstand ich später: Diese Haltung entsprang keiner „Neckerei“, sondern dem Versuch, sich dem, was hinter dem Begriff oder dem Satz lag, anzunähern – dem, was diesen überstieg.
Diese Nähe kann positiv oder negativ bewertet werden; das hängt vom Charakter des Schalks ab. Doch eines lässt sich sagen: Ironie oder Schelmerei, selbst – ja gerade – im philosophischen Denken, kann mehr zum Verständnis eines Begriffs oder Satzes beitragen als die unmittelbare Zustimmung zu seiner Aussage.
In diesem Sinn ist es nicht bloß ein rhetorischer oder polemischer Kunstgriff, Heideggers Schwarzwaldhütte gedanklich in eine Fischerhütte am Meer zu verwandeln. Heidegger war kein Mensch des Meeres – und das hat sein Denken über das Sein und seine Sprache zutiefst geprägt.
(Damit ist freilich etwas anderes gemeint als das, was Luce Irigaray in ihrer psychoanalytischen Lektüre Nietzsches Liebhaber des Meeres hervorhebt, wo sie Nietzsche – einen der von Heidegger am meisten bedachten Denker – als jemanden beschreibt, der das „Wasser“ als zu fließend und zu weiblich fürchtete. Auf diesen Unterschied komme ich am Ende dieses Aufsatzes noch einmal zurück.)

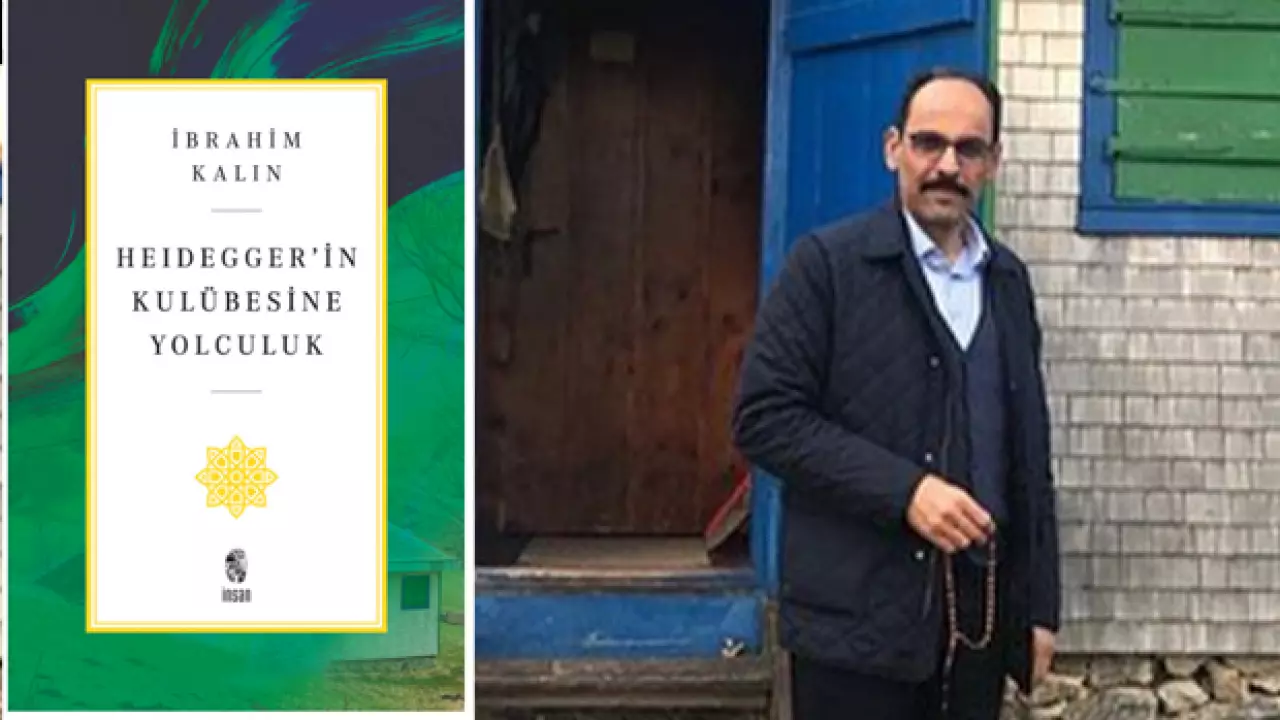

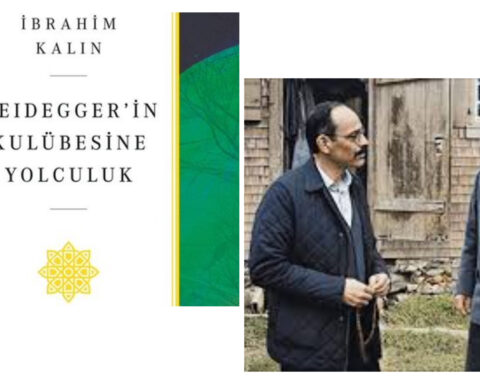
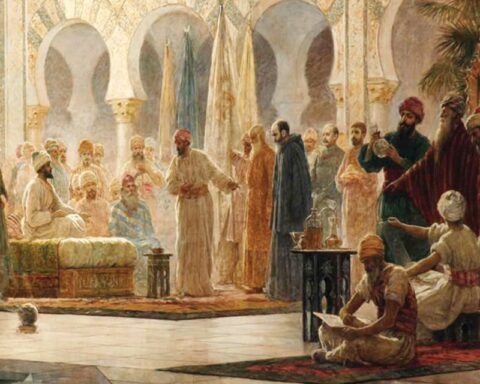

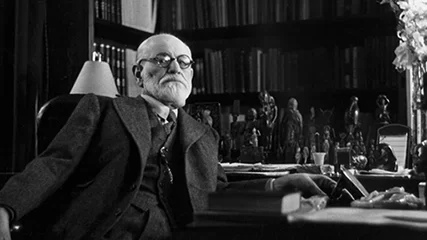
[…] Abschnitt 1: https://kritikbakis.com/de/vor-der-huette-heideggers-ueber-das-sein-nachdenken/ […]