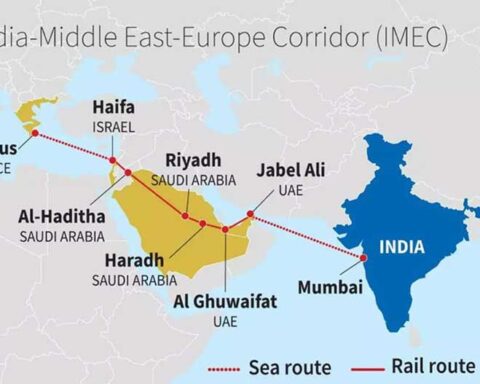Stromausfall in Spanien und Portugal: Ist die erneuerbare Energie ein Teil dieser Geschichte?
Der Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel unterstreicht den wachsenden Bedarf an stärkeren Netzverbindungen und erweiterten Energiespeicherkapazitäten, damit Europa mit dem Wachstum der erneuerbaren Energien Schritt halten kann.
Am 28. April 2025 kam es zu einem großflächigen Stromausfall, der das tägliche Leben in Spanien, Portugal und Teilen Frankreichs erheblich beeinträchtigte. Der Ausfall begann gegen 12:30 Uhr Ortszeit und führte dazu, dass U-Bahn- und Zugverbindungen eingestellt wurden, die Flughäfen in Lissabon, Madrid und Barcelona geschlossen werden mussten, Ampelanlagen außer Betrieb gerieten und Telefon- sowie Geldautomaten-Dienste auf der gesamten Iberischen Halbinsel ausfielen. Kurz vor dem Ausfall zeigte die Website des spanischen Stromnetzes, dass die Nachfrage von 27.500 Megawatt (MW) auf etwa 15.000 MW gefallen war. Der spanische Rat für nukleare Sicherheit bestätigte, dass sich die Kernreaktoren des Landes trotz des Stromausfalls in einem „sicheren Zustand“ befanden und Notstromgeneratoren aktiviert wurden.
Spanien und Portugal haben zusammen über fünfzig Millionen Einwohner, doch die genaue Zahl der Betroffenen ist derzeit noch unbekannt. Die Behörden rechnen damit, dass die Stromversorgung innerhalb von sechs bis zehn Stunden größtenteils wiederhergestellt werden kann, doch es könnte bis zu einer Woche dauern, bis der Netzbetrieb vollständig normalisiert ist. Der französische Netzbetreiber RTE unterstützt die Wiederherstellung der Stromversorgung, hat bereits 700 Megawatt bereitgestellt und wird seine Hilfe ausweiten, sobald das iberische Netz mehr Strom aufnehmen kann.
Die genaue Ursache des Ausfalls ist noch unklar. Sowohl der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, als auch der portugiesische Premierminister Luís Montenegro betonten, dass es derzeit keine Hinweise auf einen Cyberangriff gibt. Der portugiesische Netzbetreiber REN führte den Stromausfall auf eine Störung im spanischen Stromnetz zurück, die mit einem „seltenen atmosphärischen Ereignis“ aufgrund extremer Temperaturveränderungen zusammenhängen könnte. Sowohl REN als auch der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica erklärten, dass starke Schwankungen im Stromnetz dazu führten, dass das spanische Netz vom übrigen europäischen System getrennt wurde.
Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass eine Spannungsinstabilität eine mögliche Ursache für den Ausfall sein könnte. António Leitão Amaro, Minister im Präsidialamt Portugals, brachte diese Instabilität mit Problemen im spanischen Verteilnetz in Verbindung. Der portugiesische Verteilnetzbetreiber E-Redes wies ebenfalls auf Probleme im europäischen Stromnetz hin und erklärte, dass gezielte Stromabschaltungen erforderlich seien, um das System zu stabilisieren. Spaniens Premierminister Pedro Sánchez warnte vor Spekulationen und betonte, dass die genaue Ursache des Stromausfalls noch nicht bekannt sei. Es wird erwartet, dass die Klärung der wahren Ursache mehrere Monate in Anspruch nehmen wird.
Der aktuelle Stromausfall erinnert an eine ähnliche Krise vor rund zwanzig Jahren. Damals wurde in Deutschland eine Hochspannungsleitung abgeschaltet, um einem Schiff eine sichere Durchfahrt zu ermöglichen. Dies führte zu einer Netzüberlastung, die in ganz Europa etwa fünfzehn Millionen Menschen zeitweise ohne Strom ließ. In der Folge forderte die Europäische Kommission Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur, eine bessere grenzüberschreitende Netzkoordination und den Austausch von Echtzeitdaten.
Ähnlich wie im Jahr 2021, als ein Waldbrand in der Nähe von Übertragungsleitungen die Iberische Halbinsel vom europäischen Netz trennte, zeigt auch der aktuelle Vorfall: Trotz gewisser Fortschritte und der durch Russlands Invasion in der Ukraine wieder in den Fokus gerückten Energiesicherheit bestehen weiterhin Schwachstellen – insbesondere, da das europäische Energiesystem zunehmend von erneuerbaren Quellen abhängig wird.
Ein Wendepunkt für Spaniens erneuerbare Energien
Der Stromausfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem Spanien einen bedeutenden Meilenstein in seiner sauberen Energiepolitik bekannt gegeben hatte. Am 16. April 2025 wurde das nationale Stromnetz Spaniens einen Werktag lang vollständig durch erneuerbare Energien versorgt. Den Großteil der Stromerzeugung lieferten Windkraft, Solarenergie und Wasserkraft: Windkraft erzeugte 256 Gigawattstunden (GWh), Solarenergie 151 GWh und Wasserkraft 129 GWh. Solarthermie und andere erneuerbare Quellen trugen weitere 22 GWh bei. Nur wenige Tage später stellte die Solarenergie einen neuen Rekord auf: Sie deckte fast 77 Prozent des Strombedarfs und trug etwa 62 Prozent zur Gesamtstrommischung bei.
So beeindruckend dieser Erfolg auch ist, er offenbart zugleich neue Risiken. Solarstrom kann nur tagsüber erzeugt werden. Der Produktionshöhepunkt zur Mittagszeit fällt nicht mit der abendlichen Nachfragespitze zusammen. Während Spanien und andere Länder ihre Solarkapazitäten ausbauen, stehen sie vor dem sogenannten „Duck Curve“-Phänomen: ein starkes Überangebot zur Mittagszeit, gefolgt von einem steilen Anstieg der Nachfrage nach Sonnenuntergang. Dieses Muster wurde erstmals in Kalifornien beobachtet und könnte sich laut Prognosen bis 2030 zu einer „Canyon Curve“ entwickeln. Ohne ausreichende Ausgleichsmechanismen könnten solche Schwankungen die Netzstabilität gefährden – insbesondere in einem alternden und eng vernetzten System – und das Risiko von Angebots- und Nachfrageungleichgewichten erhöhen.
Regionale Schwachstellen im europäischen Stromnetz
Der Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel verweist auch auf langjährige strukturelle Herausforderungen im europäischen Netz. Mit 39 nationalen Betreibern und rund 600 Millionen Kunden ist das europäische Stromnetz das größte miteinander verbundene Netz der Welt. Diese hohe Konnektivität ermöglicht zwar einen effizienten Stromhandel und flexible Versorgung, doch ein Großteil der Infrastruktur ist veraltet: Die Komponenten sind im Durchschnitt 40 Jahre alt, und mehr als 60 Prozent der physischen Anlagen benötigen eine Erneuerung oder Modernisierung. Der Investitionsbedarf zur Modernisierung des Netzes wird auf rund 654 Milliarden US-Dollar geschätzt, während bis Ende dieses Jahrzehnts zusätzlich 700 bis 800 Gigawatt (GW) an erneuerbaren Energien in das Netz integriert werden sollen.
Spanien und Portugal befinden sich in einer besonders verletzlichen Lage. Obwohl ihre Strommärkte zu mehr als 95 Prozent miteinander verbunden sind, gelten sie wegen ihrer schwachen Verbindungen mit dem restlichen Europa als „Energieinsel“. Im Jahr 2022 teilten sich Spanien und Frankreich lediglich eine Interkonnektionskapazität von 2,8 GW. Die gesamte grenzüberschreitende Kapazität Spaniens zum zentraleuropäischen Netz betrug nur etwa 3000 MW – weit unter dem Ziel der Europäischen Kommission, diese Kapazität bis 2030 auf 15 Prozent zu erhöhen. Diese unzureichende Verbindung bedeutet, dass Europa nicht in vollem Umfang von der in der Iberischen Halbinsel erzeugten Solarenergie profitieren kann, Spanien und Portugal weniger Kapazität haben, ihren Nachbarn in Krisenzeiten zu helfen, und die gesamte europäische Energiesicherheit geschwächt wird.
Dennoch arbeitet Europa aktiv an Lösungen. Die hochrangige Arbeitsgruppe für Interkonnektoren in Südwesteuropa überwacht laufende Infrastrukturprojekte und identifiziert neue Möglichkeiten zur Stärkung der regionalen Verbindungen. Zu den laufenden Projekten zur Verbindung zwischen Spanien und Frankreich gehören ein 2200-MW-Unterseekabel durch den Golf von Biskaya, eine 1500-MW-Leitung zwischen Navarra und Landes sowie eine weitere 1500-MW-Verbindung zwischen Aragón und Massillon. Nach Fertigstellung dieser Projekte wird bis 2030 eine Gesamtkapazität von 5200 MW erreicht sein.
Auch wenn die genaue Ursache des Stromausfalls möglicherweise noch einige Zeit unklar bleibt, dürfte das wachsende Niveau erneuerbarer Energien im Netz zunehmend in die Kritik geraten. Während Spanien seinen Übergang zu sauberer Energie vertieft, erzeugt die zunehmende Dominanz von Solar-, Wind- und anderen erneuerbaren Quellen neue operative Belastungen für das Stromnetz. An erster Stelle stehen dabei größere Schwankungen zwischen Angebot und Nachfrage. Tatsächlich begann Spanien bereits im Jahr 2024, häufiger Stunden mit negativen Strompreisen zu verzeichnen als das Vereinigte Königreich – ein typisches Anzeichen dafür, dass das Angebot an erneuerbarer Energie die Nachfrage übersteigt und die bestehenden Speicherkapazitäten unzureichend sind.
Batteriespeichersysteme (BESS) sind eine zentrale Lösung zur Bewältigung der Volatilität erneuerbarer Energien. Doch Spanien hinkt in diesem Bereich hinter anderen europäischen Ländern hinterher. Im Jahr 2025 verfügte Spanien über eine Batteriekapazität von lediglich 60 MW, während das Vereinigte Königreich 5,6 GW und Italien 1 GW vorweisen konnten – obwohl der prognostizierte Speicherbedarf in diesen drei Ländern vergleichbar ist. Zwar ist Spanien hinsichtlich der gesamten installierten Speicherkapazität europäischer Spitzenreiter – hauptsächlich dank 6,3 GW Wasserkraft- und 1 GW thermischer Speicherkapazität –, bei großflächigen Batterieinvestitionen jedoch nur langsam vorangekommen. Dies liegt teilweise daran, dass traditionelle Speicherquellen den kurzfristigen Bedarf an Batterien reduziert haben, aber auch an verzögerten regulatorischen Rahmenbedingungen zur Unterstützung entsprechender Projekte. Dennoch bleibt der Ausbau von Batteriespeichern entscheidend: Sie ermöglichen die maximale Nutzung erneuerbarer Energie, stabilisieren die Marktpreise und verringern den Bedarf an Reservekraftwerken.
Spanien hat anerkannt, dass es für die Integration erneuerbarer Energiequellen mehr Flexibilität im Netz braucht, und hat im Rahmen seines Nationalen Energie- und Klimaplans (NECP) das Ziel ausgegeben, die gesamte Energiespeicherkapazität bis 2030 auf 22,5 GW zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind jedoch erhebliche Investitionen und regulatorische Reformen erforderlich. Bis dahin wird Spaniens Stromnetz weitgehend auf traditionelle Speicherlösungen angewiesen bleiben – unter dem Druck, zunehmend größere Mengen erneuerbarer Energie unterbrechungsfrei zu integrieren.
Größere Auswirkungen für Europa
Der Stromausfall in Spanien und Portugal ist nicht nur ein regionales Problem. Er stellt auch eine Bedrohung für Europas Energiewende und seine Energiesicherheitsagenda dar. Ein zentrales Element des Plans zur Stärkung der europäischen Autonomie ist die Beschleunigung des Übergangs zu erneuerbaren Energien. Doch dieses Ziel erfordert gleichzeitig Investitionen in die Modernisierung der Netzinfrastruktur, flexible Speicherlösungen und den Ausbau der Verbindungen zwischen den Mitgliedstaaten.
Wie Spaniens jüngster Meilenstein in der erneuerbaren Energie zeigt, kann der Erfolg der grünen Transformation ohne eine robuste Infrastruktur selbst zu einer neuen Risikokategorie werden. Europa muss nicht nur überdenken, wie Energie erzeugt wird, sondern auch, wie sie gemanagt, gespeichert und transportiert wird.
*Über die Autorin: Emily Day
Emily Day ist eine erfahrene Forscherin, Autorin und Redakteurin mit Spezialisierung auf Geopolitik, Kernenergie und globale Sicherheit. Sie ist stellvertretende Redakteurin der Rubrik Energy World beim Magazin The National Interest, Fellow für Energie und globale Sicherheit im Rahmen des Della Ratta-Stipendiums der Partnership for Global Security sowie Forschungsbeauftragte bei Longview Global Advisors, wo sie Analysen zu globalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen mit Schwerpunkt auf Energieversorgern, Risikomanagement, Nachhaltigkeit und Technologie liefert.
Emily hat einen Masterabschluss in Internationaler Sicherheit vom Georgia Institute of Technology, mit Schwerpunkt auf nuklearer Nichtverbreitung, aufkommenden Technologien sowie transatlantischen Beziehungen. Ihren Bachelorabschluss in Politikwissenschaft und Geschichte hat sie an der John Carroll University erworben. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Schnittstelle zwischen Kernenergie und Klimazielen, globale Führungsrollen in Abrüstungsverhandlungen sowie die Entwicklung internationaler Sicherheitsmaßnahmen.