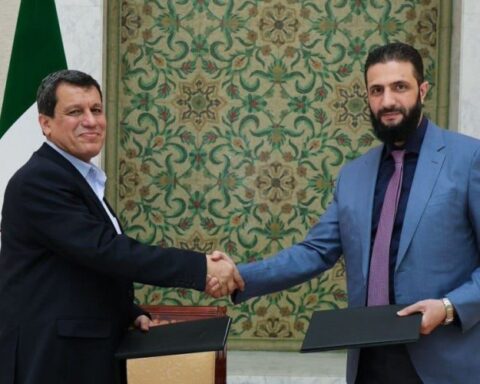„Sprache ist eine Brücke; sowohl der, der sie zerstört, als auch der, der sie errichtet, ist der Mensch.“ (Anonym)
Die Türkei steht an der Schwelle zu einer neuen und hoffnungsvollen Phase in der Lösung eines tief verwurzelten gesellschaftlichen Problems, das sie seit vielen Jahren mit sich trägt. Der Waffenverzicht der PKK und ihre offizielle Selbstauflösung sind die deutlichsten Anzeichen dafür, dass das Terrorproblem faktisch beendet ist. Diese Entwicklung stellt nicht nur im Bereich der Sicherheit, sondern auch in der Gestaltung der Politik, des gesellschaftlichen Konsenses und der demokratischen Zukunft einen historischen Wendepunkt dar.
Gleichzeitig zeigt die Einrichtung einer Kommission durch die Große Nationalversammlung der Türkei (TBMM), um den Prozess auf eine rechtliche Grundlage zu stellen, dass das politische System diese Entwicklung mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt. Jeder einzelne Schritt markiert einen historischen Moment im Prozess des Waffenverzichts und der Auflösung. Die Türkei steht sowohl politisch als auch gesellschaftlich vor dem Eintritt in eine neue Ära.
Das entscheidende Element des Prozesses: die verwendete Sprache
In einer Zeit, in der historische Schritte unternommen werden, rückt ein Thema besonders in den Vordergrund und gewinnt existenzielle Bedeutung: die Sprache, die verwendet wird. Die bisherige Entwicklung zeigt erneut, wie entscheidend der Sprachgebrauch der am Prozess beteiligten Akteure ist. Dennoch erscheint das Verantwortungsbewusstsein in der politischen Kommunikation mitunter schwach. Das Land wird in politische Sackgassen geführt, in denen sich alles nur um politische Agenden dreht. Uns begegnet eine Haltung, die auf eine Lösung wartet, ohne Verantwortung zu übernehmen: regelmäßige Aufrufe, die in Form von einseitigen, befehlenden Aussagen wie „Nun ist der andere dran“ oder „Hier muss ein Schritt erfolgen“ geäußert werden.
Wie es im Türkischen Sprichwort heißt: „Die Methode ist der Substanz voraus.“ Und der Tonfall ist der Methode voraus. Gerade in einer so sensiblen und kritischen Phase muss man sowohl die Prioritäten richtig setzen als auch realistisch und lösungsorientiert kommunizieren. Statt einer Sprache, die in einer Ghetto-Psychologie gefangen ist und den Prozess nur im Sinne eines organisatorischen Gewinns bewertet, sollte eine positive Sprache entwickelt werden, die Normalisierung als kollektiven Gewinn begreift und vermittelt. Nur eine solche Haltung stellt einen wirklich kreativen Beitrag dar und kann den Prozess voranbringen.
Was klar ist: Die alte Sprache muss endgültig hinter uns gelassen werden. Denn sie ist Träger einer Erinnerung und Gewohnheit aus der Vergangenheit. Eine neue Ära lässt sich nicht mit alten Denkmustern gestalten. Jetzt ist nicht die Zeit, sich auf bekannte Narrative zu stützen, sondern vielmehr ist es unsere Verantwortung, eine Sprache zu entwickeln, die diese Muster aufbricht und eine gemeinsame Zukunft in den Vordergrund stellt.
Rhetoriken, die einseitig Verpflichtungen einfordern und auf einer „Wir gegen die Anderen“-Dichotomie beruhen, erzeugen zwangsläufig gesellschaftliche und politische Reaktionen. Dabei stehen wir gerade vor einer historischen Chance: eine Krise gemeinsam zu überwinden und gemeinsam eine gemeinsame Zukunft zu gestalten. Dafür muss eine besonnene und inklusive Sprache entwickelt werden. Diese Verantwortung liegt insbesondere bei allen Akteuren, die Teil des Prozesses sind oder es werden wollen.
Auch in diesem Zusammenhang gibt es im Hinblick auf die geplante Kommission, die Regelungen für ehemalige Mitglieder der sich aufgelösten Organisation erarbeiten soll, Haltungen, die der Kommission – einem klar umrissenen Gremium – gleich das gesamte gesellschaftliche Problem aufbürden wollen. Solche Sichtweisen könnten den Prozess von einer gesunden Grundlage entfernen.
Dabei wurden viele Details zur geplanten Roadmap längst zwischen den Parteien besprochen, die Kommunikationskanäle stehen offen. Dennoch wird weiterhin eine befehlende Sprache verwendet, die dem Prozess schaden könnte. Sie kann sogar die gesellschaftliche Unterstützung untergraben. Darüber hinaus entstehen dadurch falsche Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit und der Prozess wird zum Instrument innenpolitischer Konkurrenz. In beiden Fällen sind es die Menschen dieses Landes, die den Schaden tragen.
Auch im Hinblick auf die Kommission erleben wir ein ähnliches Bild: Es wurden zahlreiche Gespräche geführt; alle technischen Details wie Inhalt, Umfang, Form und Beteiligung sind besprochen. Doch immer dann, wenn der Prozess an Stabilität gewinnt, tritt wieder eine Sprache auf, die durch innenpolitische Konflikte und persönliche Agenden geprägt ist – und die den Prozess erschwert.
Der Schatten des politischen Wettbewerbs: Opposition und Wahrnehmungskriege
Fast alle politischen Akteure, die heute am Lösungsprozess beteiligt sind, kennen die Erfahrungen der Vergangenheit, die Schwierigkeiten und auch, wie der Prozess sabotiert wurde. Daher wird von ihnen eine besonders vorsichtige und vernünftige Haltung erwartet. Doch das aktuelle Bild erfüllt diese Erwartungen nicht. Die verwendete Sprache ist allgemein so unachtsam, dass sie leicht durch die politische Opposition instrumentalisiert werden kann – und zugleich so scharf, dass sie gesellschaftliche Verletzlichkeit auslöst. Das ist keine bloß symbolische, sondern eine reale, tiefgreifende gesellschaftliche Sensibilität.
Einige Kreise versuchen jeden Schritt und jede Äußerung der politischen Entscheidungsträger – insbesondere der Regierung und ihrer Partner – in das Narrativ von „Verhandlungen mit dem Terror“ zu pressen. In einem solchen Klima, in dem sich diese Art von Positionierung häuft, schränkt eine befehlende Sprache den Handlungsspielraum der Akteure massiv ein. Und sie erweckt bei skeptischen Teilen der Gesellschaft erneut Misstrauen.
Wo Sprache nicht mit Sorgfalt verwendet wird, entstehen schnell falsche, aber wirkungsvolle Wahrnehmungen wie: „Seht ihr, es ist doch ein Geben-und-Nehmen-Prozess gewesen.“ Die Präsentation eines allgemein bekannten Missverständnisses als Wahrheit schadet dem Prozess – das ist offensichtlich. Ebenso sind verhandelnde Rhetoriken, Haltungen, die Gewinner-Verlierer-Schemata aufbauen, oder pauschale Erwartungen an Entwicklungen, die sich über die Zeit entfalten sollen, realitätsfern und potenziell schädlich für den Prozess.
Das Entscheidende ist das Gleichgewicht in der Sprache
Der Geist dieser neuen Ära erfordert – gemeinsam mit politischer Reife – den Aufbau einer neuen Sprache. Eine Sprache, die der Gesellschaft Vertrauen gibt, die Interessen des Landes wahrt, den Prozess mitträgt und auf dem Prinzip gegenseitiger Verantwortung basiert. Diese Sprache beeinflusst nicht nur den Tonfall, sondern auch das Wesen des Prozesses. Die politischen Parteien und Akteure sind sich der besonderen Verantwortung, die ihnen zukommt, bewusst. Seit Beginn des Prozesses haben die meisten von ihnen auf eine sorgfältige und verantwortungsvolle Sprache geachtet. Auch wenn sie nicht direkt beteiligt waren, wussten sie, dass sie durch ihre gesellschaftliche Basis Träger des Prozesses sind.
Deshalb erfordert das Wohl des Landes und seines Volkes ganz klar eine besonnene und verantwortungsvolle Sprache. Dabei darf nicht vergessen werden, dass sich diese Sprache nicht nur an die eigene Wählerschaft richtet, sondern an die gesamte türkische Gesellschaft, die den Prozess aufmerksam verfolgt und kritisch begleitet. Jedes gesprochene Wort richtet sich nicht nur an ein Lager, sondern an alle Beteiligten, die die Zukunft des Prozesses mitbestimmen.
Die in früheren Friedensprozessen oft bemühte, inzwischen jedoch inhaltsleere Rhetorik von „Anweisungen“ hat heute keine Bedeutung mehr. Entscheidend ist jetzt die gemeinsame Übernahme von Verantwortung. Denn wir stehen einem Willen gegenüber, der die Waffen abgelegt hat und eine Lösung im Rahmen demokratischer Politik sucht. In dieser Phase geht es nicht um wiederholte Parolen, sondern um die Übernahme gemeinsamer Verantwortung und die Korrektur falscher Wahrnehmungen. Das ist eine historische Verpflichtung.
Der gesunde Verlauf des Prozesses hängt nicht nur vom Tragen der Verantwortung ab, sondern auch davon, wie diese Verantwortung an die Gesellschaft kommuniziert wird. Deshalb wird von den Beteiligten nicht nur erwartet, Aufrufe zu machen, sondern durch aufrichtige Rückblicke Vertrauen in der Gesellschaft neu aufzubauen.
Ein Zitat des spanischstämmigen Philosophen George Santayana sollte in dieser Phase besonders in Erinnerung gerufen werden:
„Wer sich nicht an die Fehler der Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“
Wenn wir die Fehler der Vergangenheit erkennen und mit Aufmerksamkeit auf das Heute blicken, wird deutlich, wie wir den Prozess richtig gestalten können.
Die Bedeutung und Erwartung an die TBMM-Kommission
Die unter dem Dach des türkischen Parlaments (TBMM) eingerichtete Kommission hat als Mechanismus, der politischen und gesellschaftlichen Konsens anstrebt, eine historische Bedeutung. Ein bedeutender Schritt im Rahmen dieses Prozesses war der Besuch des MIT-Vorsitzenden bei den Fraktionen im Parlament, bei dem Informationen geteilt, Fragen beantwortet und auf den Ernst der Lage hingewiesen wurden. Dieser Besuch war ein konkreter Beweis für das Engagement der Regierung.
Die vorgesehene Struktur der Kommission ermöglicht es allen im Parlament vertretenen politischen Parteien, sich am Prozess zu beteiligen. Ein Erfolg, der hier erzielt wird, kann also nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft prägen.
Die Grundlage für diesen Erfolg ist, dass alle Akteure den Prozess mittragen, sich einbringen und mit einem starken Verantwortungsbewusstsein handeln. Denn ein Thema von dieser Tragweite erfordert ein Vorgehen und einen Ton, der Sensibilität und Ernsthaftigkeit widerspiegelt. Bereits vereinbarte Themen erneut zur Debatte zu stellen oder den Prozess als Mittel zur Kommunikation mit der eigenen Anhängerschaft zu instrumentalisieren, würde die bisherigen Errungenschaften der Türkei beschädigen. Die Kommission darf kein politisches Instrument sein, sondern muss Träger des gemeinsamen Guten bleiben.
Die Erfahrungen der Vergangenheit haben ausreichend gezeigt, wie schädlich solche Positionen für den Prozess sein können. Deshalb ist es heute eine überlebenswichtige Verantwortung, die Arbeit der Kommission, auf die große Hoffnungen gesetzt werden, nicht zu manipulieren und wirklich an diesen Prozess zu glauben. Wenn das Ziel darin besteht, den demokratischen Boden zu stärken, wird auch die Legitimität und gesellschaftliche Unterstützung ganz natürlich wachsen.
Stille, Timing und die Sprache der Verantwortung
Während die Türkei an der Schwelle zu einem neuen Abschnitt in der Suche nach gesellschaftlichem Frieden und einer Lösung steht, bekommt nicht nur die verwendete Sprache, sondern auch die Art des Schweigens eine neue Bedeutung. Wir erleben eine Zeit, in der über Personen, die im Rahmen des Strafvollzugs aus der Haft entlassen wurden, Falschmeldungen verbreitet und über Videos die öffentliche Meinung manipuliert wird.
In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, nicht auf die Lüge, sondern auf die Wahrheit zu setzen. Sich von unnötigen Polemiken fernzuhalten und gelegentlich zu schweigen, ist für den gesunden Verlauf des Prozesses oft wertvoller. Denn unzeitgemäße und sich wiederholende Aussagen schwächen die gesellschaftliche Unterstützung, während konstruktive Stille und zur rechten Zeit ausgesprochene, vertrauensstiftende Botschaften den Prozess stärken.
Jeder heute unternommene Schritt gestaltet nicht nur den Frieden von heute, sondern auch die Grundlage einer künftigen demokratischen Ordnung. Der Erfolg dieses Prozesses besteht nicht nur darin, ein rechtsstaatliches System zu schaffen, das Frieden, Sicherheit und Freiheit bringt, sondern auch darin, ein Gefühl gemeinsamer Zugehörigkeit und ein gerechtes Demokratieverständnis zu stärken.
Deshalb ist es unsere gemeinsame Verantwortung, eine politische Ethik und eine gemeinsame Sprache des Dialogs zu entwickeln. Dieser Aufruf richtet sich nicht nur an die Politik, sondern auch an die Medien, die Zivilgesellschaft und gesellschaftliche Meinungsführer. Denn die Zukunft dieses Prozesses liegt in den Brücken, die wir mit Worten bauen. Wir müssen es schaffen, diese Brücken nicht einzureißen – sondern gemeinsam darüberzugehen.
Man darf nicht vergessen: Dieses Bemühen dient der Heilung einer tiefen Wunde. Der erste Schritt zur Genesung besteht darin, den Schmerz und die negative Erinnerung der Vergangenheit in würdevoller Weise zu begraben – damit alte Fehler sich nicht wiederholen. Die Zukunft mit einer besonnenen Sprache zu gestalten, ist ebenso lebenswichtig wie die Vergangenheit nicht zu vergessen. Andernfalls, wie Lacan sagte: „Was nicht ordnungsgemäß begraben wird, kehrt zurück.“
Und wir haben kein Recht, diesem Land, diesen Menschen, dieser Zukunft eine solche Möglichkeit zuzumuten.