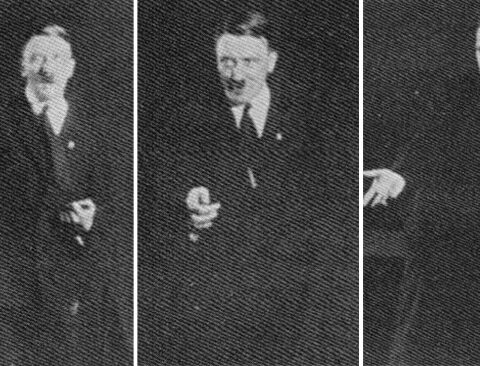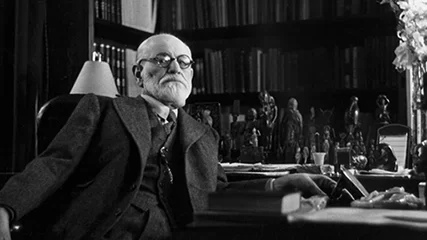Steht der Westen am Rande eines Bürgerkriegs?
Eine Frage, die noch vor zehn Jahren als absurd abgetan worden wäre, wird heute zunehmend offen diskutiert. In den letzten Wochen fanden in Ländern von Spanien über Irland bis Polen Proteste gegen Migration statt – und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sich diese Proteste in den kommenden Monaten nicht weiter ausbreiten werden.
Derjenige, der in dieser Frage Alarm schlägt, ist weder ein populistischer Provokateur noch ein medialer Demagoge, sondern ein Professor für Kriegsstudien am King’s College London.
Professor David Betz, von Haus aus Stratege, hat seine ideologische Abrechnung bereits gemacht: In westlichen Gesellschaften liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Bürgerkrieg oder bürgerkriegsähnliche Zustände derzeit bei über 50 Prozent – und er selbst bezeichnet dies als eine „vorsichtige Schätzung“.
Vor einigen Wochen war Professor Betz zu Gast im Brussels Signal Podcast – das gesamte Gespräch ist absolut sehenswert.
Auf den ersten Blick mögen diese Aussagen alarmistisch wirken. Doch Betz’ Analyse ist keine Spekulation, sondern eine vorausschauende Bewertung. Sie stützt sich auf jahrzehntelange akademische Forschung über die Anatomie des Krieges und konzentriert sich ausschließlich auf plausible Ereignisketten.
Was Betz – gemeinsam mit Denkern wie Barbara Walter – erkannt hat, ist Folgendes: Die Faktoren, die früher ausschließlich zur Prognose von Bürgerkriegen in „fernen Ländern“ herangezogen wurden, sind mittlerweile auch in Europa und Nordamerika feststellbar.
Laut Betz befinden sich moderne westliche Gesellschaften in einer „explosiven Konstellation“, deren Instabilität tief in einem Phänomen verwurzelt ist, das in der Forschung als „Fractionalisation“ (Fragmentierung) bezeichnet wird.
Dieses Phänomen beschreibt eine Entwicklung, bei der Gesellschaften sich zunehmend entlang ethnischer, kultureller oder ideologischer Linien in sich abschottende Identitätsgruppen aufspalten.
Bemerkenswert ist dabei, dass dieser Zustand im Westen nicht plötzlich entstanden ist. Im Gegenteil: Er ist das Ergebnis jahrzehntelanger politischer Ingenieurskunst durch postnationale Eliten, die sich vom Volk entfremdet haben, seine Sorgen nicht mehr teilen und es schlicht nicht mehr verstehen.
In manchen Ländern geben nur 34 Prozent der Bürger an, von der EU-Integration profitiert zu haben – während 71 Prozent der Eliten das Gegenteil behaupten. Das zeigt, wie tief die Kluft zwischen Eliten und Bevölkerung inzwischen geworden ist.
Im Zentrum dieser Krise steht das Scheitern des „Multikulturalismus-Projekts“.
Wie Robert Putnam in seiner wegweisenden Studie „E Pluribus Unum“ (2006) über Diversität zeigte, führt kulturelle Vielfalt in Stadtvierteln nicht automatisch zu mehr Nähe oder Vertrauen – im Gegenteil: Die Menschen ziehen sich zurück, zeigen sogar innerhalb ihrer eigenen Gruppen weniger Vertrauen und soziale Beteiligung.
Europa ist dabei nur das nächste Beispiel auf der Liste: Länder wie Frankreich, Deutschland oder das Vereinigte Königreich beherbergen mittlerweile große migrantische Zweitgenerationen, doch die Integration ist häufig gescheitert.
Anstelle von Assimilation erleben wir das Aufkommen paralleler Gesellschaften und die allmähliche Erosion sozialen Zusammenhalts. Das Problem ist nicht die Migration selbst, sondern die Art, wie sie gehandhabt wurde: zu schnell, zu viel – und ohne ausreichende Integrationsmechanismen.
Europäer erleben keine natürliche gesellschaftliche Entwicklung, sondern eine erzwungene Transformation, die immer mehr Menschen als bedrohlich empfinden.
Ein weiterer Faktor ist die wachsende Diskrepanz zwischen Versprechen und Realität. Zum ersten Mal seit der industriellen Revolution verdienen Kinder im Westen weniger als ihre Eltern, besitzen weniger Vermögen und sehen einer düsteren Zukunft in Bezug auf Rente und Wohneigentum entgegen.