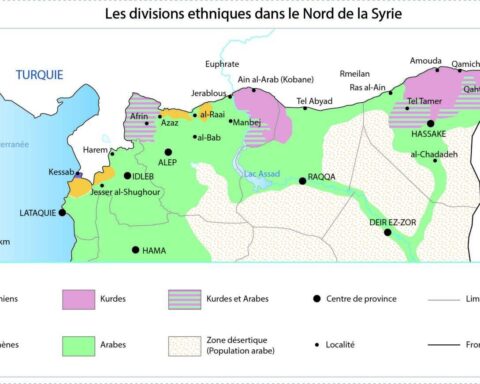Nach einem schweren Terroranschlag im hoch militarisierten kaschmirischen Ort Pahalgam, bei dem 26 indische Touristen ums Leben kamen, scheinen Indien und Pakistan erneut gefährlich nahe an eine militärische Konfrontation zu geraten. Nur wenige Minuten nach dem Vorfall beschuldigte Indien Pakistan, ohne auch nur eine formelle Untersuchung einzuleiten.
In der Folge kündigte Neu-Delhi eine Reihe vorhersehbarer Vergeltungsmaßnahmen gegen Islamabad an – darunter die Aussetzung des Indus-Wasservertrags, der in den letzten sechs Jahrzehnten mehrfach Krisen überstanden hatte. Weitere Schritte umfassten die Schließung von Grenzübergängen, die Annullierung von Visa und die drastische Reduzierung der pakistanischen diplomatischen Präsenz in Indien.
Diese sogenannten Vergeltungsmaßnahmen wurden ohne Rücksicht auf Verfahrensregeln verkündet – es gab keine Untersuchung des Vorfalls, noch wurden stichhaltige Beweise präsentiert, die Pakistan mit dem Anschlag in Verbindung bringen. Der indische Außenstaatssekretär sprach lediglich vage von „grenzüberschreitenden Verbindungen“. Trotzdem stimmten viele indische Medien bereitwillig in einen Chor der Schuldzuweisung ein.
„Pakistan ist bereit, sich an jeder neutralen, transparenten und glaubwürdigen Untersuchung zu beteiligen“, erklärte Premierminister Shehbaz Sharif, als Indien seine Maßnahmen umsetzte. Doch Indien zeigte keinerlei Interesse an einer internationalen Aufklärung. Angesichts der Tatsache, dass über 600.000 indische Soldaten und paramilitärische Kräfte in der Region stationiert sind, stellt sich die Frage: Wie konnte eine bewaffnete Gruppe so tief – rund 400 Kilometer – ins Landesinnere eindringen, einen groß angelegten Angriff verüben und dann spurlos verschwinden? Wenn selbst die hochgerüsteten und streng überwachten Grenzen Indiens dies nicht verhindern konnten, bleiben als Erklärung entweder eine erstaunliche operative Unfähigkeit oder – wahrscheinlicher – ein bewusster Kontrollverlust.
Nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitskomitees wies Pakistan die indischen Maßnahmen als „einseitig, ungerecht und verantwortungslos“ zurück und kündigte seinerseits Gegenmaßnahmen an. Die Aussetzung des Indus-Wasservertrags wurde kategorisch abgelehnt. Islamabad warnte, jeder Versuch, Pakistans Wasseranteil umzuleiten, werde als „Kriegsakt“ gewertet und mit „voller Stärke“ beantwortet. Zudem behielt sich Pakistan das Recht vor, sämtliche bilateralen Abkommen – darunter auch das Simla-Abkommen von 1972 – auszusetzen, entschied sich aber bewusst gegen deren vollständige Aufkündigung. Pakistan schloss den Wagah-Grenzübergang, sperrte seinen Luftraum für indische Flugzeuge und legte den bilateralen Handel auf Eis. Die Maßnahmen beider Seiten spiegelten sich gegenseitig deutlich wider.
Doch die entscheidende Frage bleibt: Reichen diese symmetrischen Reaktionen aus, um eine weitere Eskalation zu verhindern – oder treiben sie zwei Atommächte nur noch näher an den Abgrund?
Die Entscheidung Indiens, den Indus-Wasservertrag auszusetzen, ist kein plötzlicher Impuls, sondern das absehbare Ergebnis einer gezielt vorbereiteten Strategie. In den letzten Jahren hatte Neu-Delhi das über sechzig Jahre alte Abkommen, das trotz wiederholter Konflikte als seltenes Symbol bilateraler Kooperation galt, systematisch geschwächt. Zuletzt konzentrierten sich die Streitigkeiten auf die Mechanismen zur Konfliktlösung im Rahmen des Vertrags.
Ein besonders aufschlussreicher Schritt war Indiens Boykott der Schiedsgerichtsverhandlung im Januar 2023 in Den Haag, bei der es um Pakistans Einwände gegen indische Wasserkraftprojekte am Chenab und Jhelum ging – zwei Flüsse, die für das wasserarme Pakistan von lebenswichtiger Bedeutung sind. Stattdessen sprach sich Indien für die Einsetzung eines neutralen Experten aus und signalisierte damit offen seinen Wunsch, die Spielregeln neu zu definieren. Noch im selben Monat teilte Neu-Delhi Islamabad formell mit, dass es eine Änderung der Vertragsbedingungen anstrebe. Pakistan hingegen bekräftigte seine Bereitschaft, den Dialog über die bestehende Indus-Wasserkommission fortzusetzen und forderte Indien auf, seine langjährigen Verpflichtungen einzuhalten.
Im August 2024 forderte Neu-Delhi offiziell eine Überprüfung und Neuverhandlung des Vertrags. Begründet wurde dies mit „grundlegenden und unvorhersehbaren Veränderungen“, vage formulierten Sicherheitsbedenken sowie dringendem Bedarf an sauberer Energie, demografischen Veränderungen und ökologischen Herausforderungen. In einem Schreiben an Islamabad vom 24. April wiederholte Indien diese Argumente – und fügte, nicht überraschend, einen weiteren bekannten Vorwurf hinzu: den „anhaltenden grenzüberschreitenden Terrorismus“.
Die politische Botschaft war klar: Nationale Interessen haben Vorrang vor diplomatischen Verpflichtungen. Indiens einseitige Aussetzung des Vertrags verletzt jedoch nicht nur dessen Bestimmungen – laut denen Änderungen oder Kündigungen nur im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen dürfen –, sondern auch grundlegende internationale Normen. Die Erklärung Neu-Delhis, das Abkommen sei ausgesetzt und könne nur durch Pakistans Verzicht auf angebliche grenzüberschreitende militante Aktivitäten wieder in Kraft gesetzt werden, basiert auf einem politisch instrumentalisierten Argument.
Tatsächlich hat Indien in erster Linie die bereits stark eingeschränkten Informationsaustausch-Protokolle formell unterbrochen. Trotz dramatischer Rhetorik fehlt es Neu-Delhi derzeit an der tatsächlichen Kapazität, Wasserströme in größerem Umfang umzuleiten oder zu blockieren. Doch die symbolische Bedeutung dieses Schrittes ist erheblich – und könnte eine gefährliche Instabilität auslösen.
Seit dem 24. April häufen sich zudem provokative Äußerungen von Premierminister Modi, die auf mögliche „chirurgische Schläge“ hindeuten. Die Aussicht auf konventionelle Militäroperationen, kombiniert mit Cyberangriffen und asymmetrischen Taktiken, wird immer realistischer. Berichte über Truppenbewegungen schwerer Artillerie zur Kontrolllinie (LoC) verschärfen die Lage zusätzlich.
Ein indischer Militärschlag würde mit großer Wahrscheinlichkeit eine pakistanische Gegenreaktion provozieren – mit potenziell katastrophalen Folgen, die selbst von der indischen Führung kaum noch zu kontrollieren wären. Diese Eskalation droht, sich zu einer weit verheerenderen Krise zu entwickeln als der Konflikt von Balakot im Jahr 2019 – während die Region erneut am Rande eines Abgrunds steht.
Chinas enge Verbundenheit mit Pakistan zeigte sich erneut deutlich, als Außenminister Wang Yi in einem Telefonat mit dem stellvertretenden pakistanischen Premierminister Ishaq Dar Pekings volle Unterstützung für Pakistans Souveränität und legitime Sicherheitsbedenken bekräftigte. Wang Yi betonte zudem, dass China eine neutrale Untersuchung des Anschlags unterstütze und rief sowohl Indien als auch Pakistan zur Zurückhaltung auf.
Bereits im Jahr 2019 konnten internationale Vermittlungsbemühungen dazu beitragen, eine sich zuspitzende Krise zwischen den beiden Atommächten zu entschärfen. Doch was geschieht, wenn solche Initiativen diesmal ausbleiben? Ohne rechtzeitige internationale Einflussnahme droht der festgefahrene Konflikt in ein noch gefährlicheres und unvorhersehbares Szenario abzugleiten. Die Vorstellung eines begrenzten Kriegs unterhalb der nuklearen Schwelle ist mit enormen Risiken behaftet – Risiken, die sich nicht kontrollieren lassen.
Trotz Indiens offensichtlicher Zurückhaltung ist es dringend notwendig, geheime diplomatische Kanäle wieder zu öffnen, um eine Eskalation durch fatale Fehleinschätzungen zu verhindern. Pakistans Forderung nach einer unabhängigen und unparteiischen Untersuchung verdient breite internationale Unterstützung. Denn sie stellt nach wie vor den einzig rationalen und prinzipientreuen Ausweg aus der Krise dar.
Quelle: https://fpif.org/india-and-pakistans-crisis-water-war-and-warnings/