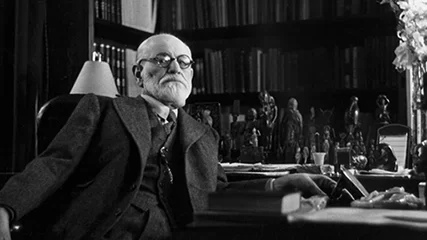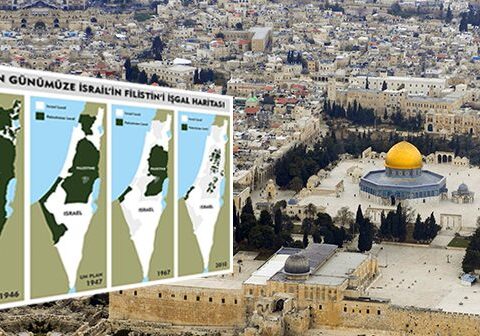Führen alle Religionen auf denselben Berg?
Stephen Prothero, Religionsprofessor an der Boston University, ist nicht der Meinung, dass alle Religionen nur verschiedene Wege auf denselben Berg darstellen. In seinem Buch God Is Not One („Gott ist nicht eins“) schreibt er:
„Die religiösen Rivalen der Welt einigen sich in Bezug auf Moral – keine Religion behauptet, es sei richtig, mit seiner Mutter zu schlafen oder seinen Bruder zu töten –, aber wenn es um Glaubensgrundsätze, Rituale, Mythologie, spirituelle Erfahrung und Recht geht, unterscheiden sie sich deutlich voneinander.“
Doch woher rührt diese Verschiedenheit?
Laut Prothero gehen die Religionen von unterschiedlichen Problemen aus und bieten jeweils eigene Lösungen. Im Judentum ist das Problem das Exil, die Lösung die Rückkehr zu Gott. Im Buddhismus ist das Problem das Leiden, die Lösung das Erwachen. Im Konfuzianismus ist das Problem das Chaos, die Lösung die Ordnung. Im Christentum ist das Problem die Sünde, die Lösung die Erlösung. Und im Islam ist das Problem der Hochmut, die Lösung die Unterwerfung.
Wie Prothero es ausdrückt:
„Wenn die Angehörigen der Weltreligionen Bergsteiger wären, würden sie auf völlig unterschiedliche Gipfel steigen – und dabei ganz verschiedene Werkzeuge benutzen.“
Die Berg-Metapher mag auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen – etwa, wenn man Religion wie Immanuel Kant im Wesentlichen auf Moral reduziert. Aber lässt sich Religion wirklich auf Moral reduzieren?
Wenn ich einem Muslim sagen würde, dass seine Religion im Wesentlichen mit dem Katholizismus, dem Buddhismus oder dem Hinduismus identisch sei, könnte seine berechtigte Antwort lauten:
„Wie können Sie behaupten, mehr über meine Religion zu wissen als ich selbst? Waren Sie jemals in Mekka? Haben Sie den Koran auf Arabisch gelesen?“
Anderen Menschen erklären zu wollen, welche Teile ihrer Religion „unwichtig“ seien, wirkt schnell überheblich.
Prothero hinterfragt die Berg-Metapher auch auf eine andere Weise. Er schreibt:
Wenn man behauptet, dass alle Religionen eine einzige seien, bedeutet das letztlich auch, dass Fragen wie „Haben wir eine Seele?“ (Christen sagen ja, Buddhisten nein) oder „Hat Gott einen Körper?“ (Mormonen ja, Muslime nein) im Grunde keine Rolle spielen. Denn – wie es der hinduistische Lehrer Swami Sivananda formuliert – „Die Grundlagen aller Religionen sind gleich. Unterschiede bestehen nur in unwesentlichen Dingen.“
Diese Behauptung ist zugleich faszinierend und merkwürdig. Bei konkurrierenden Wirtschafts- oder politischen Systemen – etwa Kapitalismus vs. Kommunismus oder Republikaner vs. Demokraten – akzeptieren wir sofort, dass sie unterschiedliche Antworten auf die Probleme der Welt anbieten. Aber sobald es um Religion geht, neigen wir dazu, uns in eine Fantasiewelt zu flüchten, in der alle Religionen überdurchschnittlich und irgendwie gleich sind – wie die Kinder in Garrison Keillors fiktiver Stadt Lake Wobegon.
Wenn Prothero recht hat, ist die Ansicht „alle Religionen sind im Kern gleich“ selbst ein religiöses Bekenntnis. Die Berg-Metapher spiegelt nicht etwa objektive Toleranz wider, sondern die hinduistische Lehre Swami Sivanandas. Dieser lehrte, dass hinter allen scheinbaren Unterschieden die eine Realität steckt: Brahman – das absolute Sein.
Dieser hinduistische Zugang reduziert nicht nur Religion, sondern die gesamte Wirklichkeit auf einen metaphysischen Monismus. (Aus Gründen, die ich an anderer Stelle erörtert habe,) halte ich es für schwierig, an den Monismus zu glauben.
Joshua D. Chatraw weist in seinem Buch Telling a Better Story: How to Talk About God in a Skeptical Age auf ein weiteres Problem der Berg-Metapher hin.
Wer unter dem Deckmantel von Inklusivität und Toleranz sagt: „Alle Religionen sind eigentlich gleich“, betreibt in Wirklichkeit eine Art fortschrittlichen Kolonialismus. Diese Menschen platzieren sich selbst metaphorisch an die Bergspitze – mit dem „wahren“ Überblick – und blicken herab auf die angeblich engstirnigen und intoleranten Gläubigen am Fuß des Berges, die nur an ihren „einen“ Weg glauben.
Das Problem ist dabei nicht, dass diese Menschen andere für falsch und sich selbst für richtig halten – das tun wir alle in irgendeiner Weise. Das eigentliche Problem ist, dass ihre Überzeugung oft unkritisch als besonders offen und tolerant akzeptiert wird – obwohl sie selbst einen exklusiven Wahrheitsanspruch erhebt.
Auch die Person auf dem Gipfel macht – wie jene an den Hängen – eine exklusive religiöse Aussage. Timothy Keller bringt es treffend auf den Punkt:
„Wie können Sie wissen, dass keine Religion die ganze Wahrheit erkennt – es sei denn, Sie besitzen selbst die umfassende spirituelle Einsicht, von der Sie behaupten, dass sie keiner Religion zukommt?“
Ein Plädoyer für Wahrheit und Toleranz – keine Gegensätze
Einige Menschen vertreten die Berg-Metapher, weil sie den interreligiösen Dialog und Toleranz fördern möchten. Dieses ehrenwerte Ziel teile ich – ebenso wie Stephen Prothero, der schreibt:
„Auch ich hoffe auf eine Welt, in der Menschen mit unterschiedlichen religiösen Überzeugungen miteinander auskommen. Aber ich glaube, dass wir dieses Ziel auf realistischere Weise erreichen müssen. Anstatt über Gott zu sprechen, indem wir alle Religionen in denselben Mülleimer oder Schatzkasten werfen, sollten wir damit beginnen, die grundlegenden Unterschiede zwischen Judentum und Islam, Buddhismus und Hinduismus, Taoismus und Konfuzianismus klar zu erkennen.“
Die Vorstellung, man müsse sich zwischen Toleranz und Wahrheit entscheiden, ist ein Trugschluss. Tatsächlich ist die Wahrheit selbst die Grundlage für echte Toleranz. Wenn wir anerkennen, dass jeder Mensch eine unbedingte Würde besitzt, dann haben wir ein stabiles Fundament, auf dem sich wahre Toleranz aufbauen lässt.
Wahrheit gegen Liebe oder Toleranz auszuspielen ist ein Fehler.
Die Philosophin und Holocaust-Märtyrerin Edith Stein lehrt uns:
„Wenn in etwas keine Liebe ist, dann glaube nicht, dass es Wahrheit ist.
Und wenn in etwas keine Wahrheit ist, dann glaube nicht, dass es Liebe ist.“
Thomas von Aquin erläutert die metaphysische Grundlage dieser Einheit von Wahrheit und Liebe:
Wenn Gott die Wahrheit ist und Gott die Liebe ist, dann gehören Wahrheit und Liebe immer untrennbar zusammen – denn in Gott sind sie auf tiefste Weise vereint.
Aquin sah die vollkommene Einheit von Wahrheit und Liebe in der Person Jesu.
Jesus ruft uns nicht nur zur Toleranz auf, sondern zur Liebe gegenüber allen Menschen – gleich welcher Religion, Hautfarbe, sozialen Schicht oder Kultur sie angehören.
Doch Jesus lehrte nicht, dass es viele Wege auf denselben Berg gibt. Vielmehr sagte er:
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ (Johannes 14,6)
*Dr. Christopher Kaczor ist Inhaber des Lehrstuhls für Erneuerung des katholischen intellektuellen Lebens am Word on Fire Institute und Professor für Philosophie an der Loyola Marymount University. Der Fulbright-Stipendiat ist Autor von 18 Büchern, darunter Thomas Aquinas on Faith, Hope, and Love sowie Thomas Aquinas on the Cardinal Virtues. Kaczor war unter anderem Humboldt-Stipendiat, Mitglied der Päpstlichen Akademie für das Leben, Gastforscher am de Nicola Center for Ethics and Culture der University of Notre Dame und William E. Simon Visiting Fellow an der Princeton University. Er ist Vizepräsident der American Catholic Philosophical Association und auf X (ehemals Twitter) unter @Prof_Kaczor zu finden.
Quelle: https://www.wordonfire.org/articles/are-all-religions-different-paths-up-the-same-mountain/