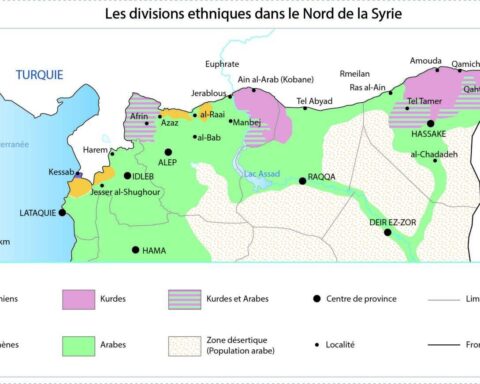Das Attentat auf die Nachkriegsordnung
Der von den USA in Venezuela organisierte Putsch sowie der in der Sprache eines skrupellosen Maklers angekündigte Invasionsplan haben faktisch erklärt, dass die „Ordnung nach 1945“ auf die vulgärstmögliche Weise – und ausgerechnet durch ihren Hauptarchitekten selbst – durch ein Attentat beendet worden ist. In unserem historischen Gedächtnis existiert ein klares Bild davon, welche Konsequenzen attentatsartige Zäsuren hatten, die den Lauf der Geschichte veränderten. Dass nach dieser Intervention ausgerechnet Venezuela zu den geringsten Sorgen der Welt gehört, hat keinen anderen Grund als eben dieses kollektive Bild. In der Hitze des Geschehens wird zwar kaum offen darüber gesprochen, wie die neue Ordnung aussehen könnte – aus Angst vor dem Unheil, das Trump verkörpert –, doch handelt es sich dabei um ein offenes Geheimnis, das jeder kennt. Ja, wir können Geschichte nicht wie ein Recyclingmaterial behandeln. Wir können keine scharfen Prognosen über die Zukunft abgeben. Aber es gibt auch keinen besonderen Grund, über das, was heute geschieht, verwirrt zu sein. Die neue Epoche, die neue Ordnung, die kommenden Jahre – wie immer man es nennen will – werden sich um ein einziges Phänomen herum formen: das amerikanische Problem.
Dieses Problem ist inzwischen ideologisch aufgeladen worden – einerseits durch die Hand von „Make America Great Again“ (MAGA), andererseits durch den amerikanischen Zionismus. Amerika brauchte jedoch niemals eine Ideologie. Denn Amerika selbst war immer schon eine Ideologie. An dem Punkt, an dem wir heute stehen, ist Amerika erstmals in seiner Geschichte auf eine derart scharfe ideologische Achse fixiert – und dies ausgerechnet unter einer Regierung, die weder ideologische Kohärenz noch ein glaubwürdiges Wertesystem besitzt. In dieser Konstellation scheint es für die USA weder im Inneren noch weltweit eine andere Richtung zu geben, als das „amerikanische Problem“ weiter zu vergrößern.
In diesem Kontext wurde das Jahr 2025 vollständig als ein Jahr des amerikanischen Problems abgeschlossen. So wie die zum Jahresende veröffentlichte Nationale Sicherheitsstrategie der USA ein Spiegel der von Trump verursachten Krisen war, wurden nahezu sämtliche globalen geopolitischen Risiken zu einem Spiegel eben dieses amerikanischen Problems. Die Welt ist in eine Phase eingetreten, in der sie geopolitische und wirtschaftliche Risiken innerhalb der Dynamiken und Konsequenzen des amerikanischen Problems managen muss. Die politische, wirtschaftliche und geopolitische Krise, in die Amerika und große Teile der Welt seit den 2010er-Jahren geraten sind, hat mit Trumps Wiederwahl den Charakter einer globalen Regimeänderung angenommen. Die Vorstellung, dass die bekannte Ordnung nach 1945 ihrem Ende entgegengeht, wird inzwischen breit akzeptiert. Dabei waren diese 80 Jahre – deren Ende heute mit verantwortungsloser Lust diskutiert wird – seit dem Römischen Reich die längste Phase, in der es zwischen Großmächten nicht zu einem „direkten“ Krieg kam. Zudem haben sich Handelskriege erstmals in der Nachkriegsordnung – anders als zuvor – nicht in militärische Kriege verwandelt. Doch an dem Punkt, den wir erreicht haben, treten wir in eine Phase ein, in der die Wahrscheinlichkeit ausbleibender Kriege in absehbarer Zukunft zu sinken beginnt.
Während das internationale System von Nahost über den Asien-Pazifik-Raum bis nach Europa und Lateinamerika eine Phase „gebündelter Turbulenzen“ durchläuft, in der zahlreiche Krisen gleichzeitig ineinandergreifen, präsentiert Washington ein globales Engagement, das sich über mehrere Fronten erstreckt und wirtschaftlich wie militärisch repressiv und unberechenbar agiert. Dieses Bild eröffnet der Weltpolitik eine Epoche, in der nicht mehr isolierte Einzelkrisen, sondern sich gegenseitig verstärkende regionale Bruchlinien dominieren. Die von Trump verursachte Instabilität wird „systemisch“. Die inzwischen fest verankerte „Chaos-Doktrin“ Washingtons hat offen eine systemische Stabilitätskrise geschaffen. Als neue Normalität beginnen Akteure außerhalb Amerikas, ihre Anpassungsfähigkeit an diese Lage zu erhöhen. Trumps Außenpolitik in seiner zweiten Amtszeit hat sich dabei von jedem Anspruch auf Kontinuität verabschiedet und ist zu einem radikalen „strategischen Abwicklungsprogramm“ geworden, das den Übergang der USA von der Rolle eines „globalen Garanten“ zu der eines „kalkulierten Störers“ grundlegend neu definiert.
In einem Prozess, in dem institutionelle Allianzen und politische Kohärenz weiter erodieren, zwingt diese Haltung jede Beziehung, jeden Prozess und jede Partnerschaft in eine Welt kurzfristiger Gewinne. In diesem zunehmend personalisierten, transaktionalen und strategisch inkonsistenten Umfeld wird Politik weniger von institutioneller Logik als vielmehr vom Instinkt des US-Präsidenten geprägt. Diese Personalisierung hat zwei strukturelle Folgen hervorgebracht. Erstens wird Politik volatil. Die Welt ist nicht mehr in der Lage vorherzusagen, wo Amerika in wenigen Wochen stehen wird. Diese Unsicherheit zwingt andere Akteure dazu, ihre Optionen zu diversifizieren. Doch daraus entstehen weder echte Prozesse noch belastbare Alternativen, da stets die Möglichkeit besteht, dass Washington morgen zu seiner alten Position zurückkehrt, als sei nichts geschehen. Zweitens werden Zugeständnisse nicht länger als Resultat systemischen Drucks wahrgenommen, sondern als „verhandelbare Privilegien“, die durch kontrollierbare Provokation erlangt werden können.
Die Trump-Regierung übernimmt diese Dynamik offen. Sie betrachtet Unberechenbarkeit als strategischen Hebel – ein Ansatz, der an Nixons „Madman-Theorie“ erinnert, jedoch ohne institutionelle Sicherheitsdämpfer auskommt. Anders als Nixon stellt Trump Unberechenbarkeit offen als Machtdemonstration dar. Er betont, dass Verbündete wie Gegner „niemals wüssten, was er als Nächstes tun werde“, und geht davon aus, durch Unsicherheit Zugeständnisse zu erzwingen. Doch Unberechenbarkeit entfaltet nur dann Hebelwirkung, wenn sie von verlässlichen Institutionen gestützt wird. Ohne institutionelle Kontinuität ist sie von Unzuverlässigkeit nicht zu unterscheiden. Infolgedessen geht es heute im Umgang mit Washington nicht mehr um Diplomatie zur Steuerung von Beziehungen oder zur Lösung von Problemen, sondern um das, was Trump selbst mit besonderem Genuss immer wieder betont: das „Dealmachen“. Vertrauen und Loyalität gegenüber diesen Deals bleiben jedoch begrenzt. Denn Washington zielt dabei nicht auf den Aufbau langfristig stabiler Rahmenbedingungen oder nachhaltiger Lösungen, sondern darauf, aus spezifischen Interaktionen maximalen Nutzen zu ziehen. Dies wirkt sich direkt auf Krisenregionen aus – vom Handelsabkommen mit China über die Beendigung des Krieges in der Ukraine bis hin zur Eindämmung israelischer Aggressionen und der Ermöglichung eines stabilen Übergangs in Syrien.
Das Erlöschen Europas, die Unmöglichkeit einer Pax Sinica
Zwei Regionen und Akteure werden vom amerikanischen Problem unmittelbar geprägt: Europa und China. Europa, das über Jahrzehnte hinweg die Normen eines liberalen Multilateralismus internalisiert hat, dessen Kosten weitgehend von anderen getragen wurden (Sicherheit durch Amerika, Energie ohne geopolitische Kosten durch Russland), ist institutionell und ideologisch unvorbereitet auf eine Epoche, in der nicht das Recht, sondern die Ergebnisse von Macht die Ordnung bestimmen. Die weit verbreiteten geopolitischen Begriffe Europas – „Risikoreduzierung“, „digitale Souveränität“, „strategische Autonomie“, „strategische Abhängigkeiten“, „strategische Geduld“ – verweisen weniger auf Lösungen als vielmehr auf die Krise des Kontinents und auf die Ängste, sich ihr zu stellen.
Unter diesem Begriffsinventar liegt die Realität der Abhängigkeit: Energie aus Russland, sicherheits- und technologiepolitische Abhängigkeit von den USA sowie tief verflochtene Märkte mit China. In der Konsequenz ist Europa zu einer „Ansammlung von Mittelmächten mit enormer regulatorischer, aber minimaler geopolitischer Macht“ geworden – mit anderen Worten: zu einem Akteur, der in einer zunehmend harten Welt in der Phase normativer Macht verharrt. Die Reaktion Europas auf den von Washington gegen Venezuela eingeleiteten Putsch und die offen angekündigte Fortsetzung durch eine Invasion – ein bloßes „Wir beobachten die Lage“ – ist genau Ausdruck dieses normativen Machtstatus. Dass Trump Europa diese Ohnmacht in der vulgärstmöglichen Weise vor den Augen der Welt spüren lässt, ist letztlich eine Folge dieser fortgeschrittenen Lähmung.