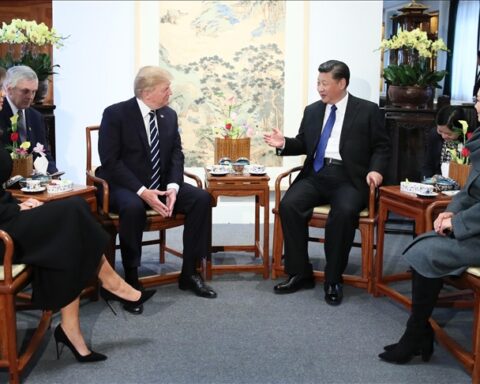Viktor Orbán kann man vieles vorwerfen – aber Unrecht hatte der ungarische Premier nicht, als er sagte: „Trump hat Ursula von der Leyen zum Frühstück verspeist.“
Der neue Entwurf des Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten ist ein klares Desaster für Europa: Während EU-Exporte in die USA mit 15 % Zoll belegt werden, bleibt der US-Warenexport nach Europa zollfrei – Trump gewinnt das Spiel eindeutig: 15 zu null.
Diese frappierende Asymmetrie liegt weit entfernt von dem, was Europa ursprünglich gefordert hatte – nämlich nahezu zollfreien Handel auf beiden Seiten. Darüber hinaus umfasst der Rahmen des Abkommens noch weitere brisante Punkte: Europa verpflichtet sich faktisch zum Kauf von US-Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar, zu Investitionen in den USA in Höhe von 600 Milliarden Dollar und zur Bestellung von in Amerika hergestelltem Militärgerät.
Natürlich könnte die EU einwenden, dass 15 % weniger sind als die ursprünglich von Trump geforderten 30 %. Zudem bleiben die Energie- und Investitionszusagen bislang vage Versprechen, denn weder die Kommission noch die Mitgliedsstaaten können europäischen Unternehmen vorschreiben, was sie kaufen oder wo sie investieren sollen. Ein kleiner Trost für Brüssel ist auch, dass es sich nur um einen noch nicht unterzeichneten Entwurf handelt – viele Details sind unklar und dürften Trump ohnehin kaum interessieren.
Trotzdem ist dieses Ergebnis für Trump bemerkenswert. Europa kann nicht ernsthaft behaupten, gewonnen zu haben. Im besten Fall hat es den Schaden begrenzt. Von der Leyen kam schwach und nervös nach Schottland – und verließ es noch schwächer, aber immerhin erleichtert.
Dabei hätte sich die EU auch anders verhalten können – denn sie ist weder wirtschaftlich noch politisch ein Zwerg. Sie ist eine der führenden Handelsmächte der Welt, Amerikas wichtigster Handelspartner und einer seiner größten Lieferanten. Rund 20 % der US-Importe stammen aus Europa – ein Anteil, der dem chinesischen Importvolumen entspricht. Und im Gegensatz zu dem, was viele von Trumps herablassenden Anhängern glauben, beschränkt sich der EU-Export nicht auf Luxusgüter und Wein. Die US-Industrie ist weitaus stärker von Europas Industrieproduktion abhängig als umgekehrt.
Europa hätte viele Karten in der Hand gehabt und seine Position durch eine koordinierte Haltung mit zwei weiteren G7-Staaten, die ebenfalls unter amerikanischem Druck standen – Japan und Kanada – noch weiter stärken können. Doch die Optionen der EU beschränkten sich nicht darauf. Ein besonders starkes Mittel wäre auch das Anti-Coercion Instrument (ACI) gewesen – ein Instrument, das genau für Situationen entwickelt wurde, in denen ein Drittstaat versucht, die EU oder einen ihrer Mitgliedstaaten durch Zwangsmaßnahmen zu wirtschaftlichen oder politischen Zugeständnissen zu bewegen. Genau das ist es, was Trump versucht hat.
Ursula von der Leyen jedoch ignorierte von Anfang an die Empfehlungen der Fachleute der Kommission und lehnte es ab, das ACI auch nur als abschreckendes Mittel einzusetzen. Hätte sie das getan, wäre der Druck auf Washington durchaus ernst genommen worden – vor allem in Anbetracht des ohnehin teuren Handelskriegs mit China. Im Gegensatz zu Europa reagierte China auf jede amerikanische Provokation mit einer eigenen Gegenmaßnahme. Das führte zu einem Zustand, den selbst Trumps Finanzminister als „nicht tragfähig“ bezeichnete. Wie von der Leyen sehr wohl weiß, hat Trump letztlich unter dem Druck der Märkte bereits mehrfach zurückgerudert.
Europa aber hat nicht einmal versucht, ein Gleichgewicht der Kräfte im Umgang mit Trump herzustellen. Hätte es wie China reagiert, wäre Trump deutlich geschwächter in die Verhandlungen gegangen. Stattdessen agierte Europa eher wie Japan – ebenfalls ein großer Handelspartner der USA, der seine Sicherheit von Washington abhängig weiß.
Das nun vorliegende Abkommen ist ein Desaster, weil es die bittere Wahrheit bestätigt: Die EU handelt aus der Angst heraus, im gefährlichen geopolitischen Klima von heute den Schutz der USA zu verlieren. Mit anderen Worten: So erniedrigend es auch sein mag, jede Form von transatlantischer Anpassung gilt als sicherer als eine ungewisse Unabhängigkeit.
In diesem Sinne wäre es jedoch ungerecht, die Schuld allein von der Leyen zuzuschreiben. Sie hat zwei rote Linien, die sie nicht überschreiten darf: den Schutz deutscher Interessen um jeden Preis – und die Vermeidung eines Bruchs mit den USA. Doch wer etwas „um jeden Preis“ erreichen will, ist auch bereit, jede Demütigung hinzunehmen.
Unterdessen wirken die meisten anderen europäischen Führer hilflos angesichts der Lage. Die Komplexität der heutigen Welt scheint sie zu überfordern – und so akzeptieren sie, was auch immer von ihnen verlangt wird. Sie scheinen die Warnung von Benjamin Franklin vergessen zu haben:
„Wer bereit ist, Freiheit aufzugeben, um kurzfristig Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit – und wird am Ende beides verlieren.“
*Zaki Laïdi war Sonderberater des EU-Außenbeauftragten für Außen- und Sicherheitspolitik und ist Professor an der Sciences Po (Paris School of International Affairs).