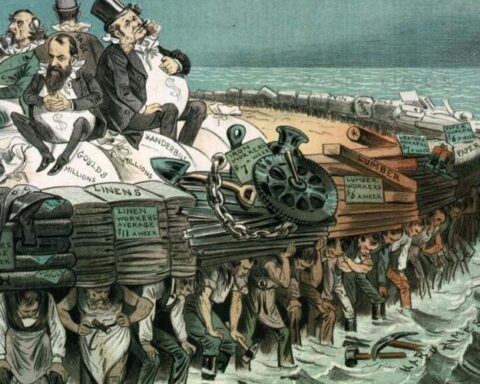In jüngster Zeit führte die Teilnahme einer Fachperson, die freiwillig israelischen Soldaten psychologische Unterstützung geboten hatte – Soldaten, die an Kriegsverbrechen und Völkermord beteiligt waren – am EMDR-Kongress zu heftigen Reaktionen innerhalb der psychologischen Fachwelt. Infolge dieser Kritik wurde die Expertin aus dem Programm gestrichen. Diese Debatte wirft grundlegende Fragen nach den ethischen Grenzen psychologischer Arbeit auf: Ist es vertretbar, Menschen, die der Menschheit schweren Schaden zugefügt und sich an Kriegsverbrechen oder Völkermord beteiligt haben, therapeutische Unterstützung zu bieten? Soll ein Psychologe dazu beitragen, dass ein Täter von seiner Schuld befreit wird? Dürfen psychotherapeutische Methoden dazu dienen, Schuld zu relativieren?
Die ethischen Grundsätze der APA bieten hierfür klare Maßstäbe: Wohltun und Schadensvermeidung, Gerechtigkeit und Respekt vor den Menschenrechten (APA, 2017). Psychologinnen haben nicht nur die Interessen ihrer Klientinnen, sondern auch das Wohl der gesamten Gesellschaft im Blick zu behalten. Die psychologische Betreuung von Völkermördern und Kriegsverbrechern, wie sie derzeit israelischen Soldaten zuteilwird, steht in direktem Widerspruch zu diesen Prinzipien. Denn sie dient nicht den Opfern, sondern trägt dazu bei, Besatzung und Völkermord aufrechtzuerhalten. Hier liegt ein eindeutiger ethischer Verstoß vor. Psychotherapie wird so zu einem Instrument, das die Schuld unsichtbar macht und die Täter erneut „funktionsfähig“ werden lässt.
Gerade in diesem Zusammenhang ist das Konzept der moral injury – der moralischen Verletzung – von besonderer Bedeutung. Es beschreibt den tiefen Schuld- und Schamkonflikt sowie den Identitätsbruch, die entstehen, wenn das eigene Handeln oder Erleben fundamentalen moralischen Werten widerspricht. Litz et al. (2009) betonten, dass eine moralische Verletzung nicht allein durch Symptomlinderung, sondern nur durch Konfrontation, Verantwortungsübernahme und Wiedergutmachung bearbeitet werden kann. Im Gegensatz zur Posttraumatischen Belastungsstörung geht es hier nicht primär um eine Bedrohung des Lebens, sondern um den Zusammenbruch des Gewissens. Die den israelischen Kriegsverbrechern angebotene psychologische Unterstützung nach den Massakern in Palästina entfernt sie jedoch von dieser notwendigen Auseinandersetzung und erleichtert es ihnen, sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Wird Therapie auf bloße Entlastung reduziert, so wird die moralische Dimension vollständig ausgeblendet.
Besonders aufschlussreich sind die Aussagen von Tätern auf der Website der Organisation The Villa, die israelischen Soldaten psychologische Hilfe anbietet. Dort berichten sie etwa: „Ein Tag hat alles verändert, die Symptome sind verschwunden“ oder „Auch wenn ich mich an die Ereignisse erinnere, fühle ich mich jetzt stark.“ Solche Aussagen belegen ein emotionales Aufatmen im Umgang mit Erinnerungen an begangene Gräueltaten – jedoch ohne jede Spur von Reue, Verantwortungsübernahme oder Wiedergutmachungsabsicht. Selbst bei Soldaten, die Babys ermordeten, ist keinerlei Bewusstsein für die Schwere ihrer Taten erkennbar. Damit stehen diese Erfahrungen im klaren Gegensatz zu den Kernelementen des Konzepts der moralischen Verletzung. Ein rein symptomorientierter Ansatz unterbindet jede Möglichkeit, sich mit der eigenen Schuld auseinanderzusetzen.
Genau hier zeigt sich die Gefahr der Instrumentalisierung wirksamer Methoden wie EMDR. EMDR gilt in zahlreichen internationalen Leitlinien als hochwirksame Behandlungsmethode bei Posttraumatischer Belastungsstörung (WHO, 2013). Doch wenn EMDR im Rahmen von The Villa durch freiwillige Fachkräfte eingesetzt wird, so wird daraus kein Heilungsprozess, sondern ein Mechanismus, der eine verbrecherische Politik stützt, indem er die gesellschaftliche Verantwortung der Täter ausblendet und sich ausschließlich auf deren Symptome konzentriert. Die Opfer werden unsichtbar gemacht, während die Täter eine Entlastung erfahren. Für die dort tätigen Psychotherapeut*innen stellt dies eine zentrale ethische Herausforderung dar. Denn wenn eine Therapie dazu beiträgt, dass ein Völkermörder weiter töten kann, wird das Prinzip des Schadensvermeidens massiv verletzt. Aufgabe des Psychologen ist es, mit Tätern zu arbeiten, ohne deren Menschlichkeit abzusprechen – aber eben auch, ohne die Konsequenzen ihrer Handlungen zu verschleiern.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Ein Psychologe kann Menschen unterstützen, die schädigende Handlungen begangen haben – doch nur unter klaren ethischen Bedingungen. Diese Unterstützung muss Konfrontation, Verantwortungsübernahme und Wiedergutmachung einschließen. Eine Intervention, die Täter zu Opfern stilisiert, ihre Fähigkeit zur Schädigung erhöht, sie nicht mit ihrer Schuld konfrontiert und diese unsichtbar macht, ist ethisch unhaltbar. Die Aufgabe des Psychologen besteht nicht darin, Massaker zu verschleiern, sondern das Wohl der geschädigten Gruppen zu schützen. Werden psychotherapeutische Methoden nicht eingesetzt, um weiteren Schaden an den Opfern zu verhindern, sondern um Tätern ihre Verbrechen zu erleichtern, liegt ein klarer Verstoß gegen die ethischen Prinzipien der Psychologie vor.
Quelle:
American Psychological Association. (2017). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct.
Litz, B. T., Stein, N., Delaney, E., Lebowitz, L., Nash, W. P., Silva, C., & Maguen, S. (2009). Moral injury and moral repair in war veterans: A preliminary model and intervention strategy. Clinical Psychology Review, 29(8), 695–706
The Villa. (2025). Testimonials. https://the-villa.co.il/en/testimonials/
World Health Organization. (2013). Guidelines for the Management of Conditions Specifically Related to Stress. WHO.