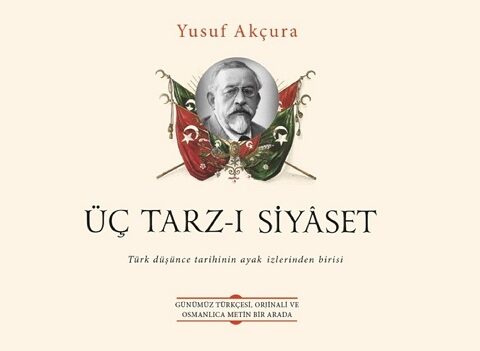Die heutige Moderne weist viele Merkmale auf, die sie von früheren Epochen der Menschheitsgeschichte unterscheiden. Eines davon ist ihre Konsumzentriertheit. In den frühen Phasen der Moderne und ihres ökonomischen Erscheinungsbildes – des Kapitalismus – war noch nicht zu erkennen, welch zentrale Stellung das Phänomen „Konsum“ einnehmen würde. Damit die modernen Industrieprodukte alle Lebensbereiche durchdringen und die Technologie menschliche Arbeit ersetzen konnte, war zunächst ein produktionsorientiertes Funktionieren erforderlich. Aus diesem Grund maßen alle Nationalökonomien den modernen Fabriken und der Produktion eine enorme Bedeutung bei und riefen ihre Bürger bei jeder Gelegenheit zum verstärkten Arbeiten und Produzieren auf. Dieser Aufruf war so mächtig, dass manche unter seinem Einfluss den Kern des Kapitalismus in der industriellen Warenproduktion wähnten und ihre Analysen darauf aufbauten. Sie konnten nicht absehen, dass die technologischen Entwicklungen eines Tages den größten Teil der menschlichen Arbeit überflüssig machen und der Fokus auf den Konsum – auf noch mehr Konsum – gelenkt werden würde. Wer heute immer noch mit dem Denken des vergangenen Jahrhunderts an die Probleme herangeht und nicht erkennt, dass der Kapitalismus sich zu einer technomediatischen Form gewandelt hat, dem können wir leider nur unser Bedauern ausdrücken. Wir dagegen müssen die Welt, in der wir leben, verstehen und beschreiben – wir haben unsere Arbeit zu tun. Und wir werden sie tun.
Das Phänomen des Konsums ist weit komplexer und schwerer zu begreifen als die Produktionsprozesse. Konsum ist beinahe endlos, ein unerschöpflicher Prozess. In diesem Prozess werden Menschen, Generationen, Weltanschauungen, Lebenswahrnehmungen und die Ideologie des Alltagslebens immer wieder neu geformt. Der Konsumprozess fegt Traditionen, große Narrative und Ideologien hinweg, und niemand bemerkt, dass er selbst diese innerlich aufnimmt.
Wir müssen sehr darauf achten, was wir konsumieren, wie viel wir konsumieren und wie wir konsumieren. Denn neben den vielen sichtbaren Problemen gibt es noch ein anderes, auf den ersten Blick unsichtbares – und weit bedeutenderes – Problem: das Identitätsproblem. Was, wie und in welchem Maß wir konsumieren, steht in direkter Verbindung zu unserem Selbst, unseren Glaubensüberzeugungen und unseren Werten.
Der „Konsum“ ist das Erkennungszeichen des gegenwärtigen Kapitalismus, der Signaturzug unserer heutigen Gesellschaft. Wir leben in einem System, das uns auffordert – ja befiehlt –, alles jeden Tag noch stärker zu konsumieren, stets das neueste Modell zu erwerben. Wenn wir dem Druck dieses Systems nicht widerstehen, wenn wir uns nicht davor bewahren, zwischen den Zahnrädern des unablässig arbeitenden Konsumgetriebes zermahlen zu werden, dann kann es geschehen, dass wir uns eines Tages kaum noch wiedererkennen. Wir selbst, unsere Werte, die uns zu dem machen, was wir sind, wären aufgebraucht. Finden wir nichts weiter, als für unsere Handlungen gezwungene juristische oder religiöse Rechtfertigungen, dann werden zwar noch unsere Autos, unsere Häuser, unsere Markenkleidung und unser Schmuck von uns erzählen – doch am Ende wird unser Name nur als der eines simplen Akteurs der Konsumgesellschaft erinnert werden. Unsere „Identität als Mitglied der Konsumgesellschaft“ würde so dominant hervortreten, dass alle anderen Identitäten in Bedeutungslosigkeit versinken.
Konsum in der Moderne als Identitätsproblem
Mit dem Zerfall der traditionellen Strukturen durch die Moderne geriet das Individuum in Unsicherheit und begann, sich mit den durch die wachsende Warenfülle auf dem Markt eröffneten oder aufgezwungenen Möglichkeiten eine Identität zu verschaffen. Zwischen dem Leben selbst, dem Selbstsein des Individuums und seinen Konsumhandlungen entstand eine unauflösbare Verbindung. Der Körper, die Kleidung, die Sprache, die Art der Freizeitgestaltung, die Vorlieben bei Speisen und Getränken, die Wahl von Haus oder Automobil – all dies wurde zu Zeichen seines Geschmacks, seines Stilempfindens, seiner Individualität und Identität. Konsum wurde zum bestimmenden Faktor der Identitätsbildung; er prägte die individuelle Psychologie und den Lebensstil des Menschen.
In der heutigen, von globalen Konsummustern gelenkten Welt wird selbst das religiöse Leben davon beeinflusst, verschmilzt mit anderen globalen Lebensformen, löst sich stellenweise auf und kann nur noch als Subkultur weiterbestehen. Trotz der Unterschiedlichkeit ihrer Gewebe leben Konsumwerte und religiöse Werte innerhalb derselben Gesellschaft – sie müssen es sogar. In einem solchen Umfeld wird der Konsum beinahe sakralisiert, während zugleich das Heilige selbst zum Konsumobjekt wird. Mit der „Sakralisierung des Konsums“ ist gemeint, dass Konsumhandlungen und -mittel mit einer überhöhten Bedeutung aufgeladen und den Menschen in einer quasi magischen Atmosphäre dargeboten werden. Die „Verwandlung des Heiligen in ein Konsumobjekt“ wiederum versucht zu erklären, wie die Elemente des Spirituellen – die eigentlich für alle gleich zugänglich sein sollten – zur Ware werden.
Der Kapitalismus tritt an die Stelle der Religion
Das Phänomen der Sakralisierung des Konsums lässt sich am deutlichsten an den „hohen Feiertagen“ der Konsumgesellschaft erkennen – jenen besonderen Tagen wie dem Black Friday. (Nebenbei bemerkt sei hier auch der antimuslimische Impuls bei der Wahl dieses Namens vermerkt.) Er findet jeweils am Freitag nach dem in den USA am vierten Donnerstag im November begangenen Thanksgiving statt. Bis zu den Weihnachtsfeiern dehnt er sich zu einem Fest der Rabatte aus. Vom Black Friday aus verbreitet sich dieser Wahnsinn mit rasender Geschwindigkeit von den USA in die ganze Welt. Für diesen Tag kursieren Begriffe wie „kollektives Verrücktwerden“ oder „Shopping-Karneval“. Doch die treffendste Bezeichnung ist: Konsumritus.
Wenn der Konsum selbst so unverzichtbar geworden ist, wenn das Einkaufen geradezu zum gültigsten Weg der Identitätsbildung und psychologischen Befriedigung geworden ist, dann verwandelt sich der Mensch mit wachsender Hingabe an diesen neuen Glauben schlicht in einen Konsumenten. Der Kapitalismus zögert nicht, für seine eigene Glaubensgemeinschaft der Konsumenten einen „rabattzentrierten Ritus“ zu etablieren. Verkäufer wie Käufer erleben nach diesem Ritus eine Art kathartische Scheinbefriedigung und binden sich noch stärker an den Glauben des Konsums. Nehmen Sie mein Wort „Befriedigung“ nicht auf die leichte Schulter – Experten diskutieren ernsthaft darüber, ob das Vergnügen am Einkaufen nicht eine Form der Sucht darstellt. Einer der Nobelpreise für Wirtschaft ging an einen Ökonomen, der das Verhalten von Konsumenten untersuchte. Die Anhänger des Konsumglaubens sind durch diese Scheinbefriedigung derart konditioniert, dass sie außerhalb dieser „Feiertage“ gar nicht mehr auf den Gedanken kommen (oder ihn nicht zulassen), zu hinterfragen, warum die Produkte sonst so teuer verkauft werden. Dank der Black-Friday-Befriedigung genießen Gesellschaft, Individuum und Verkäufer gleichermaßen den Zustand: „Käufer zufrieden, Verkäufer zufrieden“.
Am anderen Ende der Sakralisierung des Konsums steht die Verkonsumierung des Heiligen, also das Aushöhlen religiöser Werte und Symbole und deren Wiedereinführung in die Logik des Konsums. Dass unsere Wünsche, nach ihnen auch unsere Identität ausmachenden Werte, Ideale und der spirituelle Raum – der sicherste Hafen des Menschen – im Kontext des Konsums verhandelt werden, ist schmerzhaft, bitter und leider Realität. „Religiöser Tourismus“ ist dabei vielleicht das harmloseste Beispiel – den Rest brauche ich nicht weiter auszuführen, Sie sehen ohnehin alles direkt vor Augen.
Doch was ist zu tun, wie ist zu handeln? Das ist die schwierigste Frage. Denn wir sind alle Kinder einer Zeit, die jenseits unserer Kontrolle, aber uns einschließend, unaufhörlich dahinfließt. Dennoch sind uns auch heute, wie in allen historischen Epochen, Möglichkeiten gegeben – aufgrund unserer begrenzten, aber vorhandenen Willensfreiheit als Menschen. Diese Möglichkeiten lassen sich in zwei Worte fassen: Kritik und Selbstkritik. Wir müssen die Peitsche der Kritik und Selbstkritik stets bei uns tragen, das Pferd der Zeit entsprechend antreiben oder zügeln. Unserer Verantwortung als Menschen gerecht zu werden, bedeutet, die gegenwärtige Form der Prüfung zu erkennen und dementsprechend zu handeln.