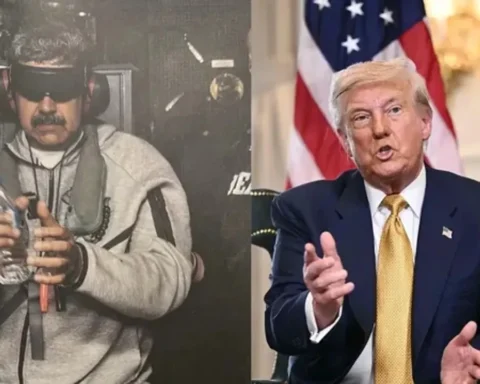Wir erleben eine Periode tiefgreifender wirtschaftlicher und geopolitischer Veränderungen.
Das globale Freihandelssystem wird kontinuierlich erodiert, indem es zunehmend Zöllen, Handelsbarrieren und einem wachsenden Vertrauen auf bilaterale Abkommen Platz macht. Gleichzeitig endet die Zeit, in der Länder auf wachsenden Wohlstand vertrauen konnten, um ihre Bürger vor den Gefahren und der Arbeitslosigkeit der früheren Ära zu schützen, da die Notwendigkeit höherer Verteidigungsausgaben Regierungen vor schwierige Entscheidungen darüber stellt, wie Ressourcen eingesetzt werden sollen.
Der Aufstieg Chinas ist ein bedeutender Faktor dieser Transformationen und das Land steht weiterhin im Zentrum der Diskussionen über Lieferketten, Technologietransfer, geistiges Eigentum und internationale Schuldendienste. Die anhaltende wirtschaftliche Abschwächung Chinas hat insbesondere zwei kritische Fragen aufgeworfen: Wird die aktuelle schwierige Phase Millionen chinesischer Verbraucher daran hindern, sowohl das lokale als auch das globale Wachstum fortzusetzen? Und wird dies die chinesische Regierung zu einer noch aggressiveren Außenpolitik veranlassen, insbesondere gegenüber Taiwan und dem Südchinesischen Meer?
Diese Fragen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da der US-Präsident Donald Trump bestrebt ist, die Haltung Amerikas gegenüber seinem wichtigsten geopolitischen Rivalen neu zu definieren. Auf der Shangri-La Dialogue, einer zentralen Veranstaltung zur Sicherheit in Asien in Singapur, bestätigte Verteidigungsminister Pete Hegseth das langjährige Engagement der USA, Taiwans Fähigkeiten zum Schutz vor Chinas Aggression zu unterstützen. Diese feste Haltung wurde nach monatelangem und zunehmend schärferem Zollstreit etwas gelockert, insbesondere durch ein Telefonat zwischen Trump und Xi Jinping sowie durch eine sich entwickelnde Vereinbarung über seltene Erden. Dennoch bleibt unklar, welche Rolle die USA China in der neuen Weltordnung zuschreiben und wie China seinen Platz darin definiert.
Die aktuellen Debatten über China und seine Politik erinnern bemerkenswert selten an die Zeit vor etwa einem halben Jahrhundert, als die Volksrepublik erstmals wieder in die kapitalistische Weltwirtschaft eingetreten ist. Angesichts der Rolle dieser Periode bei der Gestaltung der heutigen besorgniserregenden geopolitischen Lage ist diese Vernachlässigung bemerkenswert. In ihrem wichtigen und bahnbrechenden Buch The Great Transformation aus dem Jahr 2024 untersuchen Odd Arne Westad und Chen Jian, wie China zwischen den 1960er und 1980er Jahren von einer strikten, sowjetisch geprägten Planwirtschaft und der radikalen Autarkie der Kulturrevolution zu einer staatskapitalistischen Form gelangte, die als „chinesischer Sozialismus“ bezeichnet wird.
Der Wandel Chinas fand natürlich nicht in einem Vakuum statt. Seit den 1970er Jahren prägte der Neoliberalismus mit der Förderung freierer Kapitalflüsse und einer Abkehr vom Staatseingriff die globale Wirtschaft neu. Chinas außergewöhnliches Wachstum in den 1980er und 1990er Jahren hing eng mit diesen globalen Trends zusammen, die es dem Land ermöglichten, sich durch die Nutzung seiner riesigen Arbeitskraft zum Produktionszentrum der Welt zu entwickeln.
Es ist noch nicht lange her, dass amerikanische Verbraucher massiv verschuldet waren, um chinesische Waren zu kaufen, was Historiker wie Niall Ferguson und Moritz Schularick dazu veranlasste, Amerika als „Chimerica“ zu bezeichnen – ein Begriff, der die wechselseitige Abhängigkeit zwischen den beiden Volkswirtschaften beschreibt. Damals beschrieb der Ausdruck xiahai („ins Handelsmeer springen“) den unternehmerischen Geist, der durch das rasche Aufstreben der weltweit größten kommunistischen Nation zu einer der dynamischsten kapitalistischen Wirtschaften geprägt wurde und scheinbar auf globale Vorherrschaft zusteuerte.
DIE POLITISCHEN RISIKEN VON CHINAS ÖFFNUNG ZUR WELT
Die beiden neuen Bücher The Conscience of the Party von Robert Suettinger und The Southern Tour von Jonathan Chatwin analysieren die Dynamiken, die die Reform- und Öffnungsperiode Chinas prägten. Beide Autoren konzentrieren sich auf die Schlüsselfiguren, die den wirtschaftlichen Wandel des Landes vorantrieben, und zeigen eindrucksvoll, wie die Entscheidungen aus den späten Jahren des Kalten Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit die heutige Welt weiterhin beeinflussen.
Suettinger erzählt die Geschichte von Hu Yaobang, einem ehemaligen Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), dessen Rolle in der politischen Geschichte des Landes unklar bleibt. Anders als Deng Xiaoping, der weithin als der Führer der Wirtschaftsreformen anerkannt wird, wird Hu in den offiziellen Erzählungen zur Reformzeit kaum erwähnt. Im Gegensatz zu Zhao Ziyang, der 1989 nach der militärischen Niederschlagung der Tian’anmen-Proteste gestürzt wurde, ist Hu nicht vollständig aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden.
Hu war während eines Großteils der Reformperiode eine der einflussreichsten liberalen Stimmen innerhalb der KPCh. In enger Zusammenarbeit mit Deng trug er in den 1980er Jahren dazu bei, das politische Umfeld zu schaffen, das für den Erfolg der Transformation notwendig war. Basierend auf zahlreichen Quellen, darunter Parteidokumente, die nicht öffentlich zugänglich sind, präsentiert Suettinger in seiner umfassenden und tiefgründigen Biografie Hu als zentrale Figur beim Wiederaufbau Chinas nach der Kulturrevolution.
Hu wurde in eine arme Bauernfamilie in Hunan geboren und trat schon früh der kommunistischen Sache bei. Er war einer der jüngsten Teilnehmer des Langen Marsches von 1934–35. Doch die erlebten Schwierigkeiten ließen ihn die Kosten des politischen Radikalismus hinterfragen. Während der Kulturrevolution wurde er wegen politischer Vergehen verurteilt, öffentlich mit einem Holzkragen gedemütigt und gezwungen, jahrelang schwere Arbeit im ländlichen Raum zu verrichten.
Diese erschütternden Erfahrungen scheinen Hu mit tiefem Misstrauen gegenüber unkontrollierter Autorität ausgestattet zu haben und machten ihn zugleich zu einem unverzichtbaren Verbündeten für Deng, der 1978 an die Macht kam und als Hauptarchitekt der wirtschaftlichen Reformen Chinas nach Mao gilt.
Hus Einfluss auf diese neue Ausrichtung war enorm. Gemeinsam mit reformorientierten Kollegen wie Wan Li leitete er eine der frühesten und wichtigsten Initiativen der Reformperiode: die landwirtschaftliche Dekollektivierung. Zwischen 1980 und 1984 wurden Tausende von Kollektivfarmen aufgelöst und die familienbasierte Landwirtschaft wieder eingeführt.
Suettinger beschreibt, was Hu außergewöhnlich machte und warum dies ihn von seinen Kollegen in der Führung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) entfremdete. „Für ihn bedeutete Reform die Anerkennung, dass etwas schiefgelaufen war und geändert werden musste“, und dieses „Etwas“ war nicht nur wirtschaftliche Leistung und Wettbewerbsfähigkeit.
Natürlich war Hu nicht der einzige KPCh-Führer, der während der Kulturrevolution litt. Zum Beispiel wurde auch Deng ins Exil geschickt, und einer seiner Söhne wurde von den Roten Garden aus dem Fenster geworfen und blieb gelähmt. Dennoch bewahrte Hu seinen Glauben an das kommunistische System, bestand jedoch darauf, dass dieses System ein anderes, menschlicheres Verständnis von Leid enthalten müsse.
Im Jahr 1981 geriet die Situation außer Kontrolle, als Hu mit der Aufsicht über die Ausarbeitung des „Parteigeschichts-Vorschlags“ betraut wurde. Trotz seines harmlosen Titels war dieses Dokument ein großes ideologisches Projekt, das eine politisch heikle Frage zu beantworten suchte: Wie konnte die KPCh die Kulturrevolution verurteilen, ohne das Erbe Maos, des Gründers der Volksrepublik, zu zerstören?
Obwohl die Details seiner Vorschläge noch nicht veröffentlicht wurden, vertrat Hu einen radikaleren Ansatz. Bekannt ist, dass Hus Ideen Deng beunruhigten, der ihn plötzlich aus dem Komitee ausschloss und das Projekt an orthodoxere Figuren wie Deng Liqun und Hu Qiaomu übergab. Hu selbst wurde zur „Pflichtpause“ auf den schönen Tai-Berg in Shandong geschickt.
Der endgültige Bruch ereignete sich im Januar 1987. Hu wurde bei einer Sitzung, in der seine liberale Neigung und Loyalität Ziel eines erbitterten, geplanten Angriffs wurden, in eine Falle gelockt. Der Kritiker Deng Liqun sprach sechs Stunden lang und zählte zahlreiche Beschwerden gegen Hu auf. Etwa 50 hochrangige KPCh-Funktionäre umringten ihn, und nach Hus späterer Aussage versuchten sie, „mich zu demütigen und zu kritisieren, bis ich wie ein verwesender Kadaver roch“.
Deng setzte die Reformbemühungen fort
Hus Tod im April 1989 löste die Studenten- und Arbeiterproteste aus, die in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni im Tian’anmen-Massaker endeten. Doch der Schrecken dieser Ereignisse konnte die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) letztlich nicht stürzen. In den folgenden Jahren vertrat eine Fraktion um Chen Yun die Ansicht, dass die Kombination aus wirtschaftlicher und politischer Liberalisierung China gefährden würde, was zu einer wirtschaftlichen Stagnation führte.
Anfang der 1990er Jahre erkannte Deng jedoch, dass ein Rückzug von den Markt-Reformen dauerhaft werden könnte. Chatwins interessantes Werk „The Southern Tour“ beschreibt, wie Deng den orthodoxeren Fraktionen der Partei widerstand. Obwohl es kürzer als Suettingers Buch ist, ist es ebenso sorgfältig ausgearbeitet.
Chatwin konzentriert sich auf die relativ wenig erforschte Periode von 1989 bis 1992 und zeigt, wie Deng trotz seiner enormen Autorität große Anstrengungen unternahm, um die Wirtschaftsreformen wieder anzustoßen. So besuchte er beispielsweise mit seinen Unterstützern Reformzentren wie Shenzhen, das sich von einem früheren Fischerdorf nahe Hongkong rasch zu einer Großstadt entwickelte und zum Symbol kapitalistischer Begeisterung wurde.
Die Dynamiken hinter den Kulissen der Transformation werden deutlich. Im Januar 1992 hielt Deng in Zhuhai, nahe Macau, in einem modernen Döner-Restaurant eine private Rede vor chinesischen Militärs. „Wer sich gegen die Reformen stellt, wird von der Macht entfernt“, sagte er. Diese Erklärung machte deutlich, dass das Militär die Reformagenda unterstützte. Dieses Treffen war auch eine deutliche Warnung an Jiang Zemin, den Generalsekretär der KPCh, der nicht anwesend war.
Obwohl Jiang offiziell die mächtigste Figur Chinas war, war Dengs Schritt eine Botschaft an ihn und andere, dass Abweichungen vom Reformkurs ihre politische Karriere beenden könnten. Obwohl heute nur wenig über die intimsten Details der Elitepolitik in Peking bekannt ist, ist es schwer, sich nicht zu fragen, ob ein solches Treffen ohne alternative Machtzentren überhaupt hätte stattfinden können.
Der verlorene liberale Konsens
Die hervorragenden Bücher von Suettinger und Chatwin behandeln einen historischen Moment, der angeblich 2008 mit der globalen Finanzkrise endete, die Zweifel an der Zukunft der Globalisierung weckte. Doch die Entscheidungen jener Zeit sind heute, insbesondere im Hinblick auf die US-chinesischen Beziehungen, noch immer von Bedeutung.
Aus Sicht vieler amerikanischer Politiker war die Unterstützung der USA für Chinas Wiedereingliederung in die Weltwirtschaft, insbesondere der Beitritt zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001, ein strategischer Fehler, der China als gleichwertigen Rivalen hervorbrachte. Doch es gibt noch weitere wichtige Faktoren. Besonders die Unterstützung der USA für Chinas wirtschaftlichen Aufstieg beruhte teilweise auf einer oft übersehenen geopolitischen Notwendigkeit: der Schwächung der Sowjetunion.
Suettinger fokussiert sich zwar mehr auf Hus Innenpolitik, beschreibt ihn jedoch als eine Schlüsselfigur innerhalb der KPCh, die eine stärkere Öffnung gegenüber dem Westen befürwortete. Hätte eine andere Fraktion gesiegt, hätte China einen stärker westlich orientierten Weg einschlagen können.
Hinter der amerikanischen Unterstützung für den von Deng als „Reform und Öffnung“ bezeichneten Prozess standen auch wirtschaftliche Motive. Während der Amtszeit von US-Präsident Ronald Reagan wurde in großem Umfang verschuldet, um die Nachfrage nach chinesischen Waren zu steigern. In den 1990er und 2000er Jahren betrieb China Industriespionage und lenkte einen Großteil seiner wirtschaftlichen Gewinne in Forschung und Entwicklung, um heimische Innovationen zu fördern. Die USA hätten ebenso in F&E investieren können, taten dies jedoch nicht.
Sowohl im Osten als auch im Westen scheinen Schlüsselakteure in den 1980er und 1990er Jahren von den liberalen Normen abzuweichen, die das globale Handelssystem definierten. China übernahm 2021 die „Dual Circulation“-Strategie, die darauf abzielt, die Binnennachfrage zu steigern und die Wirtschaft so autark wie möglich zu gestalten.
Trump verhängte während seiner ersten Amtszeit einige Beschränkungen für chinesische Importe, von denen viele von seinem Nachfolger Joe Biden beibehalten und ausgebaut wurden. In seiner zweiten Amtszeit verfolgte Trump jedoch einen noch radikaleren Ansatz, der nicht nur China, sondern auch den Rest der Welt ins Visier nahm. Wie bei vielen seiner Politiken bleibt auch Trumps Handelspolitik gegenüber China unberechenbar.
Würden all diese Entwicklungen Hu oder Deng schockieren? Wie Suettinger beobachtet, sah Hu eine klare Verbindung zwischen liberalen Wirtschaftsreformen und einer freieren Gesellschaft. Obwohl China heute nicht so repressiv ist wie während der Kulturrevolution (es gibt keine Anzeichen dafür, dass KPCh-Führer eine Revolution von unten anstiften oder die Parteistruktur zerstören wollen), hätte Hu die Gefahr erkannt, dass grundlegende wirtschaftliche und soziale Debatten zum Schweigen gebracht werden.
Die Einschätzung, wie Deng auf die heutigen Entwicklungen reagieren würde, ist komplizierter. Seine harte Unterdrückung der Studentenproteste 1989 zeigte, dass er nicht wollte, dass wirtschaftliche Liberalisierung zur politischen Pluralität führt. Sein entschlossener Schritt, die Markt-Reformen wiederzubeleben, deutet jedoch darauf hin, dass er an die Zukunft Chinas in einer vollständigen Integration in die globale Wirtschaft glaubte.
Aber diese globale Wirtschaft existiert nicht mehr. Die Welt befindet sich in einem Wandel hin zu Nationalismus, Protektionismus und strategischer Konkurrenz, in einem Umfeld, in dem – anders als in der Nachkriegszeit – kein einzelner liberaler Hegemon allein herrscht, so wie die USA. Obwohl diese Tendenzen in den USA offener zum Ausdruck kommen als in China, zeigen die Politiken beider Länder, dass die Strukturen, die einst zu globalen Normen wurden, dauerhaft zerfallen.
Demgegenüber waren die liberalen Reformen, die Hu und Deng unterstützten, ein Produkt der Zeit, in der eine offenere Welt unvermeidlich erschien. Es mag zu früh sein, das neue internationale System als geschlossen zu deklarieren, doch die Ereignisse und Spannungen, die Trumps globaler Handelskrieg hervorgebracht hat, deuten auf eine entscheidende Tendenz zur Abschottung hin. In diesem Sinne wirkt die von Suettinger und Chatwin beschriebene Epoche wie eine längst vergangene Zeit.
*Rana Mitter ist Vorsitzende des Lehrstuhls für US-Asien-Beziehungen an der Harvard Kennedy School und Autorin des jüngsten Buchs „China’s Good War: How World War II Is Shaping a New Nationalism“ (Harvard University Press, 2020).