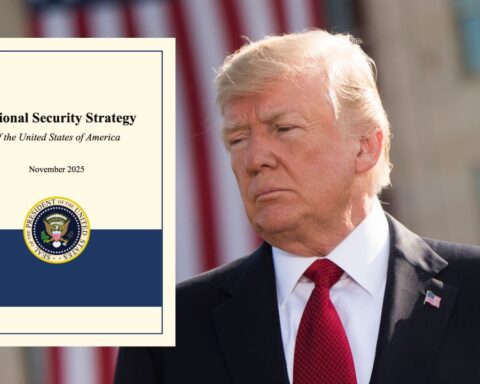Im Juni 2024 fand in Nischni Nowgorod ein BRICS-Dialogforum mit Entwicklungsländern statt. Auf die Frage, welche konkreten Unterstützungsmaßnahmen BRICS für afrikanische Staaten bereithalte, antwortete Südafrikas damalige Außenministerin Naledi Pandor diplomatisch, es gelte, „Dialogkapazitäten auszuweiten“ und „Räume zu schaffen, damit die Stimme des Globalen Südens Gehör findet“. Diese symbolische Formulierung offenbarte jedoch deutlich, wie fern selbst auf höchster Ebene konkrete Hilfe gegenüber Afrika liegt – ein Hinweis darauf, wie sehr die BRICS sich von der in Bandung formulierten Solidarität entfernt haben.
1955 trafen sich 29 Staats- und Regierungschefs aus Asien und Afrika in Bandung, Indonesien. Sie erhoben sich gegen koloniale Unterdrückung und westlichen Imperialismus und formulierten eine neue Vision von Souveränität, Solidarität und Selbstbestimmung. Aus dieser Konferenz ging die Bewegung der Blockfreien hervor und sie inspirierte panafrikanische sowie asiatisch‑afrikanische Zusammenarbeit – eine moralische und politische Alternative zur bipolar geprägten Welt des Kalten Krieges.
70 Jahre später erweitert die BRICS-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) ihre Mitgliederzahl, um der westlichen Hegemonie entgegenzuwirken. Doch viele fragen sich: Verkörpert BRICS wirklich den Bandung-Geist des antikolonialen, gleichheitsorientierten Globalen Südens, oder handelt es sich inzwischen um ein pragmatisches Bündnis ökonomischer Interessen ohne radikale Vision? Trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung hat BRICS noch keine konsistente, transformative Alternative zur westlich dominierten Globalisierung entwickelt. Es mangelt sowohl an institutioneller Tiefe als auch an ideologischer Klarheit und politischem Willen. Während Bandung auf moralische Führung setzte, wirkt BRICS geprägt von internen Spannungen, geopolitischer Vorsicht und elitären Agenden.
Bandung versprach nicht nur postkoloniale Einheit, sondern auch eine neue globale Gerechtigkeitsordnung. Führer wie Nehru, Nasser, Sukarno und Nkrumah sahen sich als Teil einer historischen Bewegung, die nicht nur nationale Souveränität verteidigte, sondern eine „von unten“ kommende internationale Solidarität formulierte. BRICS hingegen schwieg in kritischen Momenten – etwa bei der NATO‑Intervention in Libyen, dem Krieg in Gaza oder Militärputschen in Afrika und zeigte keine gemeinsame Stimme.
China und Russland fordern nach dem Ukraine-Krieg und den Spannungen im Südchinesischen Meer zunehmend westliche Dominanz heraus – allerdings meist als Rivalen, nicht als Verteidiger Unterdrückter. Brasilien und Indien schwanken zwischen Globalem Südensprech und Integration in westliche Finanz- und Sicherheitssysteme. Südafrika hat trotz symbolischer Rhetorik selten transformatorische Führung übernommen.
Die BRICS-Erweiterung 2024 um Länder wie Iran, Ägypten, Äthiopien und Argentinien wurde von manchen als Wiederbelebung südlicher Identität gefeiert. Doch ohne gemeinsame politische Vision droht der Block zu einem losen Konsortium unzufriedener Staaten zu werden, statt eine kraftvolle Bewegung zu sein. BRICS muss mehr bieten als Widerstand gegen den Westen – es muss eine echte Alternative auf den Kämpfen und Sehnsüchten der Globalen Mehrheit aufbauen.
Positive Signale gibt es: die Kritik am US-Dollar, die Gründung neuer Entwicklungsbanken und UN-Reformforderungen spiegeln wachsende Ungeduld gegenüber westlicher Vorherrschaft. Zivilgesellschaft, soziale Bewegungen und Intellektuelle beziehen sich weiterhin auf Bandung als Inspirationsquelle. Dennoch klafft eine tiefe Kluft zwischen elitären Gipfeltreffen und Basisbewegungen.
Wenn BRICS den Bandung-Geist wirklich ehren will, muss es mehr tun als symbolisch zusammenzukommen. Es braucht klare Prinzipien: Antiimperialismus, wirtschaftliche Gerechtigkeit, klimagerechte Gleichstellung und Volkssouveränität. Es muss die Stimmen von afrikanischen Bauern, asiatischen Arbeiterinnen und lateinamerikanischen Feministinnen stärken. Nur so kann BRICS einen glaubwürdigen Weg zu einer gerechteren, multipolaren Welt anbieten. Andernfalls wird es das, wogegen Bandung einst kämpfte: ein Klub mächtiger Staaten, der globale Ungleichheit erneut reproduziert.
Afrikas Rolle innerhalb von BRICS bleibt komplex und wenig erforscht. Trotz seiner Gründungsmitgliedschaft verliert Südafrika an Einfluss innerhalb der Agenda. Länder wie Sambia, belastet durch Schulden und Sparzwang, sehen BRICS als Alternative zu westlichen Finanzinstitutionen – bislang jedoch ohne konkrete Erfolge. Die afrikanischen Investitionen der Neuen Entwicklungsbank bleiben überschaubar, und viele Regierungen zögern, sich zu eng an Peking oder Moskau zu binden. Ebenso hat BRICS sich im Nahen Osten weder zu Gazas humanitären Krisen noch zur Marginalisierung Palästinas geäußert – ein weiteres Zeichen dafür, wie weit es sich vom moralischen Erbe von Bandung entfernt hat.
Vielleicht ist es längst Zeit, eine provokative Frage zu stellen: Warten wir weiterhin darauf, dass Staaten den Bandung-Geist wiederbeleben, oder haben Basisbewegungen, akademische Netzwerke und lokale Kämpfe diese Rolle längst übernommen? Von Klimagerechtigkeitsbewegungen in Nairobi bis zu feministischen Initiativen in Buenos Aires – das postkoloniale internationale Bewusstsein des 21. Jahrhunderts verlässt sich nicht länger auf elitäre Gipfeltreffen. Wenn BRICS den Globalen Süden wirklich würdigen will, steht eine klare Entscheidung an: Wird es erneut bestehende Hierarchien festigen – oder wird es den radikalen Geist von Bandung durch Taten neu entfachen?