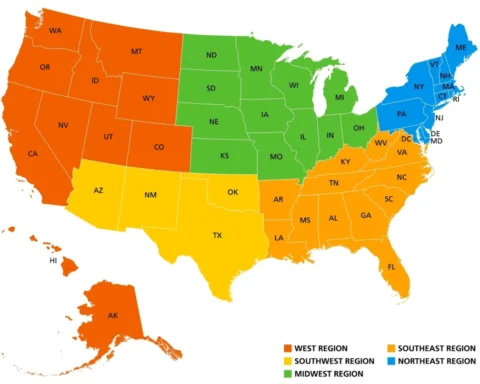Die kürzlich angestoßene Diskussion über das Problem der alternden Bevölkerung und sinkender Geburtenraten in der Türkei wirkt auf den ersten Blick wie ein Alarmzeichen, das die historische Erinnerung weckt. Im Vergleich zu den langfristigen Auswirkungen der Geburtenkontrollkampagnen der 1960er Jahre wird eine „größere Bedrohung als der Krieg“ heraufbeschworen und ein neuer Aufruf zur Mobilisierung der Bevölkerung wird laut. Doch wenn man sich die nackten Zahlen des demografischen Wandels ansieht, wird deutlich, dass die Herausforderung, vor der die Türkei steht, nicht nur ein Ziel zur Zahl der Geburten ist, sondern ein komplexes Zusammenspiel gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Prozesse. Offizielle Statistiken zeigen, dass die Gesamtfertilitätsrate von 2,38 im Jahr 2001 auf 1,51 im Jahr 2023 gesunken ist und damit deutlich unter die Erneuerungsschwelle der Bevölkerung von 2,10 gefallen ist. Zudem hat der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren 10 % überschritten, und das Medianalter ist auf 34,4 Jahre gestiegen, was die Türkei schnell aus dem klassischen „demografischen Fenster“ heraus und in die Kategorie schnell alternder Länder befördert. Die Projektionen der Vereinten Nationen gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und das Medianalter bis 2050 auf 42 Jahre und bis 2100 auf 46 Jahre steigen wird, wobei die Bevölkerung in den 2070er Jahren ihren Höhepunkt erreicht und dann schrittweise sinken wird.
Dieses erschreckende Bild zwingt uns, über einzelne Anreize zur Geburtenförderung hinaus auch die sozioökonomischen Bedingungen zu beleuchten, die den Aufbau von Haushalten bestimmen. Die Jugendarbeitslosigkeit lag Ende 2024 bei 17 %, unter Hochschulabsolventen bei 26 %. Der reale Immobilienpreisindex ist im Zeitraum 2019-2024 um mehr als 150 % gestiegen, wodurch die Wohnkosten zu einem chronischen Budgetschock geworden sind; die Unregelmäßigkeit auf dem Mietmarkt hat junge Haushalte gezwungen, länger bei ihren Familien zu wohnen. Die verzögerte Haushaltsunabhängigkeit zieht das Heiratsalter nach oben, und die Verschiebung der Heirat hat wiederum das Alter für die erste Geburt nach hinten verschoben. Dieser Mechanismus führt zu einem drastischen Rückgang der Gesamtfertilitätsrate. Das durchschnittliche Heiratsalter von Frauen in der Türkei lag 2001 bei 22 Jahren, 2023 stieg es auf 26,7 Jahre. Studien haben gezeigt, dass 60 % dieses Anstiegs mit der Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und den hohen Wohnkosten zusammenhängen. Daher wird ohne wirtschaftliche Stabilität jede Mikromaßnahme wie Kredit- oder Ratenaufschub oder finanzielle Geburtenanreize die demografische Dynamik nur begrenzt beeinflussen.
Die zweite Ebene des Problems betrifft die Arbeitsmarktintegration von Frauen und die Pflegeökonomie. Der bezahlte Mutterschaftsurlaub beträgt insgesamt nur 16 Wochen, der Vaterschaftsurlaub nur 5 Tage, was weit unter dem OECD-Durchschnitt liegt; die Kosten für die Kinderbetreuung betragen 45 % des Mindestlohns, und die universelle Betreuung für Kinder von 0-3 Jahren erreicht nur etwa 13 %. Trotz Veränderungen der Geschlechterrollen tragen immer noch hauptsächlich Frauen die Last der Pflege, und die Entscheidung für ein zweites oder drittes Kind wird häufig zu einer Kosten-Nutzen-Rechnung im Hinblick auf den Karriere- und Einkommensverlust. Länder wie Frankreich, Schweden und Ungarn, die in der Lage waren, die Fertilitätsrate wieder auf 1,8-2,0 zu steigern, haben durch langfristigen Elternurlaub, universelle frühkindliche Bildung und steigende Einkommensübertragungen pro Kind gewisse Erfolge erzielt. In der Türkei liegt die Frauenbeschäftigungsquote bei nur 36 %, was das Risiko erhöht, dass die Bevölkerung nicht quantitativ wächst, sondern dass es zu einem Verlust an qualifizierter Arbeitskraft kommt.
Die dritte Ebene des Problems besteht im Fehlen einer Synchronisation zwischen dem Bildungssystem und dem Arbeitsmarkt. In einigen Bereichen mit übermäßigen Studienplätzen liegt die Arbeitslosenquote der Absolventen in den ersten fünf Jahren bei etwa 40 %. Gleichzeitig wächst der Mangel an qualifizierten Fachkräften in Bereichen wie Industrie, IT und grüner Technologie. Die Inflation der unqualifizierten Diplome führt zu einer Zunahme der Arbeitslosigkeit unter Hochschulabsolventen und beschleunigt gleichzeitig die Abwanderung von Talenten. Laut dem internationalen Migrationsbericht des TÜİK für 2023 ist die Zahl der Auswanderer auf 714.579 gestiegen, während die Zahl der Einwanderer bei 316.456 blieb, was zu einem Nettoverlust führt und Alarm schlägt. So führt die demografische Erosion im Inland zusammen mit dem Talentabfluss ins Ausland zu einer doppelten Schädigung.
Migration und Bevölkerung sind an diesem Punkt zu einem kritischen Diskussionsthema geworden. Die Theorie, dass eine junge und dynamische Migrantenbevölkerung dem Land eine demografische „Stärkung“ bringen könnte, ist grundsätzlich gültig und notwendig. Tatsächlich könnten Schritte, um die Bevölkerung aus der Türkei und der türkischen Welt sowie aus den Regionen, die zur „kulturellen Geografie“ des Landes gehören, wie etwa aus Ostturkistan bis zu den Balkanstaaten, anzuziehen, in naher Zukunft zu ernsthaften Alternativen werden. Allerdings birgt die Migration auch potenzielle negative Auswirkungen, wenn man die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Integrationskosten nicht berücksichtigt. Die registrierte syrische Bevölkerung in der Türkei, die 4 Millionen überschreitet, bleibt aufgrund der nicht an den lokalen Arbeitsmarkt angepassten Qualifikationen, der Sprachbarrieren und der gesellschaftlichen Spannungen weiterhin ein gesellschaftliches und politisches Prüfungsthema. Die begrenzte Wirkung von Programmen für qualifizierte Arbeitsmigranten erschwert die Strategie der Verjüngung durch Migration. Umgekehrt haben Rückkehrprogramme für Migranten noch nicht den erforderlichen Umfang erreicht, um den Verlust von qualifizierten Arbeitskräften durch „Brain Drain“ zu kompensieren. Migration kann jedoch nur dann positive Auswirkungen haben, wenn sie in einem attraktiven wirtschaftlichen und sozialen Klima erfolgt, das in der Lage ist, hochqualifizierte Humankapital zu gewinnen.
Neben den wirtschaftlichen Dimensionen wird auch die Nachhaltigkeitskrise des sozialen Sicherheitssystems zunehmend kritisch. Die Rentenausgaben werden im Jahr 2024 voraussichtlich 10 % des BIP erreichen, und das Ungleichgewicht zwischen den aktiven und passiven Zahlungen im beitragsbasierten System verstärkt den Druck auf die notwendigen Reformen. Es wird prognostiziert, dass der Anteil der älteren abhängigen Bevölkerung bis 2035 von 20 % auf 31 % steigen wird. Ohne eine Erweiterung der Beitragsbasis oder eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters wird das System mit zunehmendem Defizit kämpfen. Um die gesunde Alterung zu fördern, müssen präventive Gesundheitsausgaben erhöht, flexible Arbeitsmodelle wie teilweise Rente entwickelt und Politiken umgesetzt werden, die ältere Menschen von passiven Leistungsempfängern zu aktiven, produktiven Akteuren machen. Diese Politiken sollten das Fundament einer nachhaltigen Bevölkerungspolitik bilden.
Auf kultureller Ebene muss auch die Veränderung der Familienideale berücksichtigt werden. Das in den 1990er Jahren vorherrschende Ideal der Zwei-Kind-Familie hat sich zunehmend in die Präferenz für ein Kind oder keine Kinder gewandelt, insbesondere in städtischen Mittelklassehaushalten. Diese Tendenz wird über die wirtschaftliche Rationalität hinaus durch das Argument verstärkt, Qualität der Quantität vorzuziehen. Daher spiegeln sich bei den Geburtenentscheidungen nicht nur direkte finanzielle Transfers wider, sondern auch die gesellschaftliche Verantwortung für die Kinderbetreuung, die Verbesserung der Bildungsqualität und der Aufbau sicherer Nachbarschaften und öffentlicher Räume, die zur Lebensqualität beitragen.
In diesem Kontext wird die häufig geäußerte Notwendigkeit einer Bevölkerungspolitik, wenn sie nur auf Maßnahmen zur Geburtenförderung beschränkt ist, nicht ausreichen. Was wir wirklich brauchen, ist eine ganzheitliche Politikstrategie, die die Demografie mit Wirtschaft, Bildung, dem Betreuungsökosystem, der Gleichstellung der Geschlechter, der Wohnungspolitik, der sozialen Sicherheit und dem Migrationsmanagement auf einer gemeinsamen Ebene verbindet. Zum Beispiel würde das alleinige Geburtsgeld ohne Investitionen in eine universelle Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren die Frau eher dazu bewegen, ihre Erwerbstätigkeit aufzugeben, wodurch das Haushaltsbudget sinken würde und eine negative Auswirkung auf die Geburtenrate hätte. Eine Erhöhung der dritten Kind-Kreditvergünstigung ohne eine Erweiterung des sozialen Wohnungsangebots würde die Wohnkosten nicht reduzieren. Ebenso könnte die Erhöhung des bezahlten Urlaubs der Mutter ohne eine entsprechende Verlängerung der Vaterschaftsurlaubszeit dazu führen, dass die Betreuungslast allein auf der Mutter liegt und dies Frauen davon abhält, Kinder zu bekommen.
Zusammengefasst ist die demografische Herausforderung der Türkei nicht nur eine Frage der Existenzsicherung, sondern auch eine Frage des Humankapitals, des Wohlfahrtsstaates und der sozialen Gerechtigkeit. Ein quantitatives Bevölkerungswachstum kann nur durch die Synchronisierung von Querschnittspolitiken in Bereichen wie Bildung, Recht, Wirtschaft, Gesundheit, Migration und Geschlechtergleichstellung in qualitatives und nachhaltiges Wachstum umgewandelt werden. Ja, die Bevölkerung gibt ein Warnsignal ab. Doch dieses Signal richtig zu lesen, erfordert mehrschichtige Lösungen und nicht den sofortigen Griff zum Panikknopf. Einseitige Geburtenförderungsmaßnahmen könnten kurzfristig Ergebnisse bringen. Was jedoch wichtig ist, sind langfristige Strategien, wie die Anpassung von Bildung und Beschäftigung, den Ausbau der frühkindlichen Betreuung, die Unterstützung von Frauenbeschäftigung, die Nachhaltigkeit der sozialen Sicherheit und qualifizierte Migrationsstrategien, um die demografische Stabilität zu gewährleisten. Kurz gesagt, die Türkei braucht wirklich eine Bevölkerungspolitik. Diese Politik sollte jedoch eine langfristige, multidimensionale und reformorientierte Strategie sein, die das Bevölkerungsproblem als Teil einer ganzheitlichen Entwicklungsagenda behandelt.