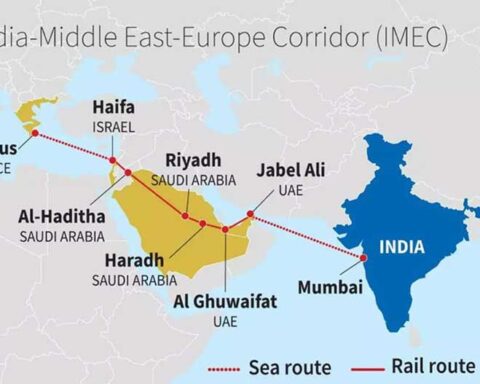Die Geschichte liefert nur wenige Beispiele dafür, dass Washington seine eigenen Allianzen ablehnt
Foreign Affairs, Juli 2025
Henry Kissinger verglich sich einmal mit dem einsamen Cowboy, der in die Stadt kommt, um die Bösewichte zur Strecke zu bringen. Doch der ehemalige Außenminister der Vereinigten Staaten, der auch als Nationaler Sicherheitsberater diente, dachte in Fragen der Beziehungen zwischen Großmächten ganz anders. Sein Held war der österreichische Staatsmann Klemens von Metternich, der 1815 eine Koalition gegen Napoleon schmiedete – mit Österreich, dem Vereinigten Königreich, Preußen, Russland und weiteren kleineren Verbündeten, indem er deren eigensinnige Führer zusammenbrachte. Wie Kissinger verstand, brauchen selbst einsame Cowboys Verbündete.
Diese Einsicht scheint US-Präsident Donald Trump zu übersehen. Seit seiner Rückkehr ins Amt im Januar hat Trump die engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten als Betrüger und Schmarotzer bezeichnet. Japan und andere Handelspartner in Asien hält er für „verwöhnt“, die Nachbarn Nordamerikas wirft er vor, Drogen und Kriminelle zu exportieren. Die Führer der wichtigsten demokratischen Partner der USA nennt er rückständig, schwach oder unehrlich – während er autoritäre Staatschefs lobt, mit denen ihm die Zusammenarbeit offenbar leichter fällt. So bezeichnete er etwa den ungarischen Präsidenten Viktor Orbán als „großartigen Führer“, den starken Mann El Salvadors, Nayib Bukele, als „großen Freund“, den Diktator Nordkoreas, Kim Jong Un, als „klugen Mann“ – und bis vor kurzem auch Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, der die Ukraine angegriffen hat, als „Genie“ und „sehr intelligent“.
In einem bisher undenkbaren Schritt für eine US-Regierung – selbst unter Trumps erster Amtszeit – stellte sich die Vereinigten Staaten im Februar bei einer UN-Abstimmung gegen ihre demokratischen Verbündeten. Dabei ging es um eine Resolution, die den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilte und die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine unterstützte. Die USA votierten auf der Seite autoritärer Staaten wie Russland, Nordkorea und Belarus.
Am erstaunlichsten ist vielleicht, dass die Regierung in einer Zeit, in der sie versucht, China einzudämmen und die Verteidigung im Indopazifik zu stärken, nun Strafzölle gegen Südkorea und Japan – die engsten Verbündeten in Asien – sowie gegen zahlreiche europäische Partner verhängen will, die sich von Peking fernhalten sollen. Weltweit sind die Verbündeten der USA zunehmend beunruhigt über öffentliche Äußerungen Trumps und seiner Kabinettsmitglieder, die den Eindruck erwecken, dass der sogenannte nukleare Schutzschirm – die amerikanische nukleare Abschreckung als Sicherheitsgarantie – nicht mehr verlässlich sei. Die Zweifel sind inzwischen so groß, dass Frankreich und das Vereinigte Königreich im Juli ein neues Abkommen verkündeten, das vorsieht, eine erweiterte nukleare Abschreckung für sich selbst sowie für Verbündete wie Südkorea, Polen und sogar Japan bereitzustellen.
In der Geschichte finden sich viele Beispiele dafür, dass Großmächte mit ihren alten Verbündeten brechen oder neue suchen. Doch es ist schwer, einen Präzedenzfall zu finden, in dem ein Führer eines großen Bündnisses seine meist verlässlichen und loyalen Partner so leichtfertig und rücksichtslos beiseitegeschoben hat. Wenn die Vereinigten Staaten sich für die Ressourcen Kanadas oder Grönlands interessieren, standen diese immer zur Verfügung. Doch mit Annexion zu drohen, hat – wie früher – nur antiamerikanische Gefühle geschürt. Dass viele NATO-Verbündete nicht genug in ihre Verteidigung investieren, stimmt. Doch liegt das zum Teil auch daran, dass die USA jahrzehntelang auf ihrer dominanten Rolle beharrt haben. Und wenn es darauf ankommt, wie zuletzt beim NATO-Gipfel im Juni, dann haben die transatlantischen Partner ihre Verteidigungsbudgets erhöht oder entsprechende Zusagen gemacht – Erhöhungen, die vor wenigen Jahren noch unvorstellbar waren.
Es fällt schwer, die Politik von Trumps zweiter Amtszeit mit vernünftigen Argumenten zu erklären. Sollte der Präsident die bestehenden Allianzen als Belastung empfinden, so bietet er wenig Alternativen – außer einem Rückgriff auf das überholte Konzept von Einflusssphären, in dem einige wenige Großmächte ihre Nachbarn dominieren und multilaterale Institutionen, wenn sie überhaupt überleben, kaum Macht und Einfluss haben. Eine solche Welt würde den USA auf lange Sicht größere Bedrohungen bringen: mit einer von China dominierten asiatischen Region und möglicherweise einem von Russland kontrollierten Osteuropa oder Zentralasien. In diesen Regionen würden kleinere Staaten gezwungen, sich entweder einer neuen Hegemonie zu unterwerfen oder mühsam Widerstand zu leisten.
Indem die Vereinigten Staaten ihre bewährten Allianzen aufgeben, riskieren sie auf lange Sicht einen Zusammenbruch der internationalen Ordnung und Stabilität – mit hohen Kosten in Form von steigenden Militärausgaben und endlosen Handelskriegen. Dass es dafür kaum historische Vorbilder gibt, bedeutet nicht, dass es sich um eine kluge, machiavellistische Strategie handelt. Im Gegenteil: Es zeigt, dass die USA gegen ihre eigenen Interessen handeln und eine der wichtigsten Quellen ihrer Macht untergraben. Und das geschieht zu einer Zeit, in der Amerikas globale Führungsrolle sowie wirtschaftliche und technologische Dominanz zunehmend unter Druck von China und anderen großen Rivalen geraten.
DAS GESETZ DER MACHT
Über Jahrhunderte hinweg wurde der Wert von Allianzen – selbst zwischen sehr unterschiedlichen Ländern – als ein grundlegendes Element der internationalen Beziehungen anerkannt. Laut historischen Aufzeichnungen haben sich Gruppen wie Clans oder Nationen zusammengeschlossen, um sich gegen gemeinsame Feinde zu schützen. Im 5. Jahrhundert v. Chr. besiegte der Delisch-Attische Bund, ein Zusammenschluss griechischer Stadtstaaten, das Persische Reich. Im Jahr 1815 vereinigten sich Österreich, das Vereinigte Königreich, Preußen und Russland in der sogenannten Heiligen Allianz, um das Frankreich Napoleons zu besiegen. Gemeinsame Ziele können selbst die unwahrscheinlichsten Partner zusammenbringen – wie etwa das katholische Frankreich und das muslimische Osmanische Reich, die sich im 16. Jahrhundert verbündeten und über zwei Jahrhunderte hinweg Alliierten blieben, oder im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion unter Joseph Stalin mit dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, um Deutschland, Japan und die anderen Achsenmächte zu besiegen.
Bevor die Welt so eng miteinander vernetzt war und Kommunikation so einfach wurde, erlaubte die Geografie es einigen Staaten, auch ohne Verbündete zu bestehen. Japan zum Beispiel lebte zweieinhalb Jahrhunderte lang isoliert, bis es 1853 durch den Besuch des US-Marineoffiziers Commodore Matthew Perry mit einer anderen, größeren Welt konfrontiert wurde. Die Vereinigten Staaten, einst durch zwei Ozeane geschützt und ohne starke Feinde an ihren Landgrenzen, rühmten sich über weite Strecken ihrer Geschichte damit, Allianzen zu vermeiden. Selbst als sie spät in den Ersten Weltkrieg eintraten, bestand Präsident Woodrow Wilson darauf, dass die Vereinigten Staaten keine Alliierte, sondern eine „assoziierte Macht“ seien. Doch nach 1945 gaben sie diese skeptische Haltung gegenüber Allianzen auf. Angesichts der feindseligen Sowjetunion und des damals mit ihr verbündeten kommunistischen China gründeten die USA erstmals in Friedenszeiten Verteidigungsbündnisse – allen voran die NATO. Wie wir heute sehen, ist die isolationistische Tendenz in der amerikanischen Außenpolitik jedoch nie ganz verschwunden.
Wie die Regierung Truman vor 80 Jahren erkannte, brauchen selbst mächtige Staaten Verbündete – teils aus Prestigegründen, vor allem aber, weil selbst große Macht Grenzen hat und ihre Aufrechterhaltung teuer ist. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts durchlief das Britische Empire – das größte Imperium, das die Welt bis dahin gesehen hatte – eine Phase, die der Historiker Paul Kennedy als „imperiale Überdehnung“ bezeichnete. Das Empire stand nicht nur alten Rivalen wie Frankreich und Russland, sondern auch neuen Herausforderern wie Deutschland, Japan und den Vereinigten Staaten gegenüber. Die britische Wirtschaft war zwar immer noch stark, und die Royal Navy beherrschte die Meere, doch andere Nationen holten schnell auf. Die britische Staatskasse und die Steuerzahler begannen sich über die Kosten der Vorherrschaft zu beklagen.
Wie verhasst das Vereinigte Königreich damals war, zeigte sich im Burenkrieg von 1899–1902, als es versuchte, zwei kleine Burenrepubliken – die Südafrikanische Republik (Transvaal) und den Oranje-Freistaat – zu unterwerfen. Die ersten Siege der Burentruppen offenbarten nicht nur die Schwächen der britischen Armee, sondern wurden weltweit mit Genugtuung aufgenommen. Die brutale Behandlung der afrikanischen Zivilbevölkerung beschädigte zusätzlich den Ruf des Britischen Empires. Auf der Pariser Weltausstellung 1900 überschütteten begeisterte Besucher den Stand des Transvaals mit Blumen. Angesichts dieser Feindseligkeit erkannten die Briten, dass auch sie Freunde brauchten. Bald schloss die britische Regierung Abkommen mit ihren Rivalen Frankreich, Japan und Russland. Diese Abkommen verringerten die Wahrscheinlichkeit von Konflikten, förderten die Zusammenarbeit und minderten die imperiale Überdehnung. In den Augen seiner Zeitgenossen blieb das Vereinigte Königreich wohl bis weit in den Zweiten Weltkrieg hinein die führende Weltmacht.
Wie die britische Erfahrung zeigt, lässt sich globale Macht nicht nur durch militärische Ressourcen messen. Waffen, Schiffe, Flugzeuge, wirtschaftliche Leistung oder wissenschaftlich-technologische Stärke lassen sich relativ leicht zählen – Kompetenz, organisatorische Kapazitäten, effektives Management oder moralische Stärke hingegen nur schwer. Vor der Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 erschien Russland als stark und war für China, Iran und Nordkorea ein attraktiver Verbündeter. Heute, nach dreieinhalb Jahren eines erfolglosen Krieges mit hohen Verlusten, könnte Russland mehr Last als Nutzen sein. Ein Staat – ganz gleich, wie es um seine Alliierten, Feinde oder die eigene Bevölkerung steht – muss in den Augen anderer als verlässlich gelten. In den 1980er-Jahren scheiterte die Sowjetunion in Afghanistan trotz militärischer Überlegenheit – ebenso wie die Vereinigten Staaten in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts. Diese Misserfolge enttäuschten nicht nur die eigenen Verbündeten, sondern entfernten auch Unentschlossene, untergruben das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Regierung und ermutigten potenzielle Feinde. Die bolschewistische Revolution von 1917, ermöglicht durch militärische Niederlagen Russlands, sollte der Sowjetregierung eine Warnung gewesen sein – und heute auch Wladimir Putin.
Macht ist zudem nicht statisch. Obwohl das Vereinigte Königreich in beiden Weltkriegen zu den Siegern gehörte, erschöpften sich seine Ressourcen, und das Empire zerfiel. Ist Amerika noch so stark wie einst? Es erlitt Niederlagen im Ausland – besonders in Afghanistan und im Irak –, ist im Inneren zunehmend gespalten, die Staatsverschuldung explodiert und Investitionen in die Infrastruktur nehmen ab. Und in einer Ära immer schnellerer und weitreichender Raketen ist Geografie kein ausreichender Schutz mehr gegen Feinde. Das liefert noch mehr Gründe, um Allianzen mit freundlichen Mächten zu pflegen, statt sie zurückzuweisen. Kanada war – außer vielleicht im Eishockey – nie eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten. Die Kanadier betrachten die Amerikaner seit Langem als enge Verwandte. Die Grenze zwischen beiden Ländern ist die längste unbewachte Grenze der Welt. Ihre Volkswirtschaften sind eng miteinander verflochten.
Doch Trumps Aussagen über einen „51. Bundesstaat“, seine Strafzölle und die Drohung, dass die USA Kanada im Rahmen des vorgeschlagenen Raketenabwehrsystems „Golden Dome“ nicht verteidigen würden, falls Kanada nicht zahlt (und er erhöht die geschätzten Kosten ständig weiter), haben ein normalerweise sanftmütiges Volk erzürnt. In Ottawa herrschen Schock und Ungläubigkeit. Dinge, die einst als unerschütterliche Grundpfeiler der kanadischen Außenpolitik galten, schmelzen wie die Gletscher in Grönland. Was zerbrochen ist, wird sich nur schwer reparieren lassen – zumindest nicht innerhalb einer Generation. Doch wofür?
DIE STÄNDIGEN GÄRTNER
Wie viele andere menschliche Beziehungen auch, sind Allianzen schwierig: Ihre Pflege erfordert Geduld, Toleranz, Geschick und – wie ein Garten – ständige Aufmerksamkeit. Die Einsätze sind oft hoch, und der Charakter der beteiligten Führungspersönlichkeiten und Diplomaten kann entscheidend sein. Diplomatie besteht nicht nur aus dem Besuch von Cocktailpartys – obwohl auch das dazugehört –, sondern vielmehr darin, Einsichten über andere Nationen und deren Führer zu gewinnen und zu lernen, wie man mit ihnen verhandelt. Wenn man, wie Vizepräsident JD Vance im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz, vermeintliche Fehler von Verbündeten öffentlich rügt, täglich Befehle und Beleidigungen in den sozialen Medien verbreitet oder Briefe an andere Staatschefs veröffentlicht, bevor die Adressaten sie erhalten, dann sät man nur Groll und erschwert künftige persönliche Beziehungen.
Hätte Henry Kissinger keine Beziehung auf der Grundlage gegenseitigen Respekts mit seinem chinesischen Amtskollegen Zhou Enlai aufgebaut, hätten sich die Beziehungen zwischen den USA und China unter der Nixon-Regierung um Jahre verzögert. Noch aufschlussreicher ist vielleicht die Beziehung zwischen dem britischen Premierminister Winston Churchill und dem US-Präsidenten Franklin Roosevelt. Seit dem Ausbruch des Krieges in Europa im Jahr 1939 versuchte Churchill – nach eigenen Worten – Roosevelt zu „umwerben“. Churchill wusste, dass das Vereinigte Königreich amerikanische Ressourcen wie Waffen und Geld, letztlich aber auch amerikanische Truppen brauchte, um zu siegen. Roosevelt wiederum wollte nicht, dass die Briten scheitern. Zwar war er durch die kriegsskeptische amerikanische Öffentlichkeit anfangs eingeschränkt, nutzte aber seine präsidialen Befugnisse bis an die Grenze, um so viel Hilfe wie möglich zu leisten.
Im Laufe des Zweiten Weltkriegs legten die beiden Führer – oft unter Gefahr für ihre Gesundheit und ihr Leben – tausende Kilometer mit Schiffen und Flugzeugen zurück, um einander und auch Stalin zu treffen. Ohne die enge persönliche Beziehung zwischen Churchill und Roosevelt hätten Spannungen und Zielkonflikte, wie sie in jeder Allianz vorkommen, die gemeinsame strategische Planung und die lebenswichtige amerikanische Militärhilfe im Rahmen des Lend-Lease-Programms erheblich behindert. Die Partnerschaft zwischen den beiden Ländern wurde durch Tausende Experten, Beamte, Journalisten, Intellektuelle und Militärangehörige erweitert und gestärkt – auch wenn die Zusammenarbeit nicht immer einfach war.
Denken wir an den britischen General John Dill, den obersten Militärvertreter in Washington, und seine tiefe, seltene Freundschaft mit dem zurückhaltenden George Marshall, dem Generalstabschef der US-Armee und wichtigsten militärischen Berater Roosevelts. Die beiden Generäle konnten häufig tiefe und bisweilen heftige Differenzen zwischen ihren Kollegen und politischen Führern überbrücken. Auch wenn Churchill und seine Nachfolger die „besondere Beziehung“ nach dem Krieg vielleicht überbetont haben, brachte diese Beziehung beiden Ländern Vorteile – von der Berliner Luftbrücke zu Beginn des Kalten Krieges bis zum Fall der Berliner Mauer am Ende desselben.
Allianzen haben jenseits ihrer unmittelbaren Ziele oft keine lange Lebensdauer. Churchill und Roosevelt hatten wesentlich weniger Erfolg bei dem Versuch, eine dauerhafte Freundschaft mit Stalin und der Sowjetunion aufzubauen. Die Kluft zwischen den Demokratien und der sowjetischen Diktatur war einfach zu groß: Die alliierte Intervention gegen die Bolschewiki am Ende des Ersten Weltkriegs, die angespannten Beziehungen in der Zwischenkriegszeit und tief verwurzeltes Misstrauen – teils aus der russischen Geschichte, teils aus der marxistischen Annahme eines letzten Kampfes zwischen Kapitalismus und Sozialismus – machten normale Beziehungen nahezu unmöglich. Die Notwendigkeit, das militärische Regime des nationalsozialistischen Deutschlands und des kaiserlichen Japans zu besiegen, war der Kitt, der die „Große Allianz“ zusammenhielt – und als dieser wegfiel, endete auch die Beziehung. Das hat sich in der Geschichte immer wieder wiederholt – etwa mit dem Zerfall des Delischen Bundes nach dem Sieg über Persien oder als die Balkanstaaten nach ihrem gemeinsamen Sieg über das Osmanische Reich im Jahr 1913 gegeneinander Krieg führten.
So unmessbar sie auch sein mögen: Gefühle wie Zuneigung oder Abneigung, Bewunderung oder Verachtung – die alltäglichen Bestandteile menschlicher Beziehungen – spielen eine zentrale Rolle beim Zustandekommen und Zerbrechen von Allianzen. Persönliche Freundschaften, gegenseitiger Respekt und Vertrauen sind das Schmiermittel, das das komplexe Getriebe einer Allianz am Laufen hält. Seit 1945 haben britische und amerikanische Führer – wie Harold Macmillan und John F. Kennedy, Margaret Thatcher und Ronald Reagan, George W. Bush und Tony Blair – gute Beziehungen aufgebaut, die die Partnerschaft ihrer Länder gestärkt haben. Doch wenn es an dieser persönlichen Chemie oder zumindest an einem gewissen Maß an Vertrauen fehlt, können Beziehungen erstaunlich schnell zerfallen – wie die Welt es heute erneut erlebt. Zar Alexander I. von Russland etwa entfernte sich langsam von Napoleon, dessen Schutz ihm zunehmend missfiel. Mao Zedong und seine Gefolgsleute wurden immer unzufriedener mit dem sowjetischen Anspruch auf Führung der weltweiten kommunistischen Bewegung, während Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow die Chinesen als gerissen und unzuverlässig betrachtete. Dies führte nach 1962 zu einem bitteren Bruch zwischen China und der Sowjetunion, der öffentlich ausgetragen wurde.
KARTEN AUF DEN TISCH LEGEN
Seit 1945 haben Dutzende Staaten in Asien, Europa und dem Nahen Osten ihre Sicherheitsbeziehungen auf Washington ausgerichtet. Dazu gehören die 31 weiteren NATO-Mitglieder, asiatische Länder wie Australien, Japan und Südkorea mit formellen Militärallianzen mit den USA, sowie Länder wie Israel oder Saudi-Arabien mit weniger formellen, aber weitreichenden militärischen Partnerschaften. Ebenso zählen Chile und Vietnam zu jenen, die weltweit freundschaftliche Beziehungen zu den USA pflegen. Diese beeindruckende Vielfalt an Ländern begrüßte die amerikanische militärische Führung nicht nur wegen der US-Supermachtstellung nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch als Symbol für Hoffnung auf eine gerechtere Welt.
Aber nun droht der Westen selbst auf die Liste gescheiterter Allianzen gesetzt zu werden. Trump war schon immer allergisch gegen das Geben und Nehmen der Bündnispolitik – vielleicht geprägt durch seine Erfahrungen als „unkomplizierter Boss“ in der Geschäftswelt. Während große Unternehmen komplexe Führungsgremien haben, führte er seine Geschäfte mit kleinen Teams. In The Apprentice wurde er berühmt für das „You’re fired!“.
In seiner ersten Amtszeit wirkte Trump auf Mehrparteien-Gipfeln unwohl und dominant. Zum Beispiel kam er beim G7-Gipfel 2018 in Kanada verspätet, verließ ihn früh und konfrontierte die anderen Führenden offen zu Handels- und Zollfragen. Allein der Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen und dem sorgfältig ausgehandelten Atomabkommen mit Iran schockierte die Verbündeten – im Juni wies das neue Trump‑Abkommen große Ähnlichkeiten mit der früheren Iran-Politik auf. Wie er selbst sagte: „Wir sind das Sparschwein, das alle plündern.“
Nun, da verdiente Berater durch Hofschmeichler und Loyalisten ersetzt wurden, lebt Trump impulsiver. Er scheut sich nicht, demokratische Staaten und multilaterale Organisationen offenzulegen, mit denen er ungeduldig scheint. Die NATO, die EU, BRICS, die UNO oder sogar die WHO werden von ihm regelmäßig mit unnötigen Beleidigungen bedacht. Fast scheint es, als existiere kein übergeordnetes Ziel außer seiner eigenen Dominanz.
Trump betrachtet internationale Beziehungen als reine Verhandlungen. Er spricht persönlich und direkt mit einzelnen Führern – und bevorzugt starke Autokraten statt demokratischer Partner. Er setzt voraus, dass Freunde und Feinde gleichermaßen nachgeben werden, solange der Deal für sie oder für Washington attraktiv ist. Bei einem weltbekannten Oval Office-Gespräch sagte er zu Präsident Selenskyj: „Du hältst gerade keine Trumpfkarte in der Hand.“
Wünschte man solche Politik wäre einfach. Doch Staaten handeln nicht immer nach dem, was für andere am besten scheint. Hitler irrte 1940 in seiner Annahme, dass Großbritannien bald kapitulieren würde, Putin hatte Anfangs auch unterschätzt. Roosevelt erkannte bereits beim Tod 1945, dass persönliche Interessen, Überzeugungen, Kultur, Demografie oder Geografie Kunst sind, Politik zu formen. Stalin stammte aus einem völlig anderen sozialen Milieu als Roosevelt und prägt von daher andere Weltanschauungen.
MASSAKER DER AMERIKANISCHEN ART
In Trumps Welt zählen langfristiges Vertrauen und Respekt wenig. Staaten kooperieren, solange es passt und bessere Angebote nicht eintreffen. Russland sieht einen Vorteil aber Freunde; europäische Partner beklagen sich, gehorchen jedoch der US-Linie, oder stehen isoliert. China verhandelt um Handel, US‑Agrargüter zu kaufen – vorausgesetzt, Washington hält die Bühne. Und wenn Peking Taiwan möchte, warum nicht geben, wenn es einen Ausgleich erhält? Trump scheint zu glauben, internationale Beziehungen funktionierten wie er selbst: Man verliert eine Runde, gewinnt vielleicht die nächste. Aber Staaten vergessen – gerade wie Individuen –, sie vergessen nicht schnell Niederlagen und Ungerechtigkeiten.
Vertrauen zwischen Individuen oder Nationen ist schwer messbar, aber unerlässlich für dauerhafte, produktive Partnerschaften. Während des Kalten Krieges verzögerten die Misstrauen die Rüstungskontrollgespräche zwischen USA und Sowjetunion. Der Abschuss des U‑2-Spions Gary Powers 1960 oder das sowjetische Abschießen eines koreanischen Verkehrsflugzeugs 1983 wurden als bös(e) Willen interpretiert. Im Gegensatz dazu nahm jedoch innerhalb westlicher Allianzen man die gegenseitige Unversehrtheit als gegeben an, diskutierte heikle Themen offen und suchte gemeinsame Lösungswege. Heute ist dieses weiße Vertrauen verschwunden – und es lässt sich nicht schnell wiederherstellen.
Derzeit erlebt die USA ihre Hochphase als mächtigste Militärmacht – ähnlich wie einst das Britische Empire. Die amerikanische Schuldenlast steigt weiterhin dramatisch, während China und andere ambitionierte Staaten in ein immer teureres Wettrüsten investieren. Wie so oft in der Geschichte ziehen Staaten zusammen, um entweder auf einen Machtwechsel zu setzen oder von einem Niedergang zu profitieren. Sollte Trumps feindselige Haltung gegenüber Allianzen Bestand haben, und die US-Regierung weiterhin ihre langjährigen Partner demütigt, unterschätzt oder gar ökonomisch boykottiert, wird Amerika zunehmend eine feindseligere Welt vorstellen.
Ehemalige Verbündete oder neutrale Staaten könnten – wie etwa die Slowakei oder Serbien – Putin und Russland als stabilere Option ansehen; andere könnten neue Handelsplattformen schaffen oder militärische Kooperationen wie in Europa oder Kanada selbst aufbauen. Ein Hinweis auf kommendes Handeln: Kanada verschickte den ersten LNG-Container nach Asien. Die Briten priesen einst ihre „grandiose Isolation“, bis die Rechnung zu hoch wurde. Trump‑Amerika könnte erkennen, dass solch eine „Isolation“ im Zeitalter des 21. Jahrhunderts gefährlich überschätzt ist.
*MARGARET MACMILLAN, Emeritus-Professorin für internationale Geschichte an der Universität Oxford und Autorin von War: How Conflict Shaped Us und The War That Ended Peace: The Road to 1914