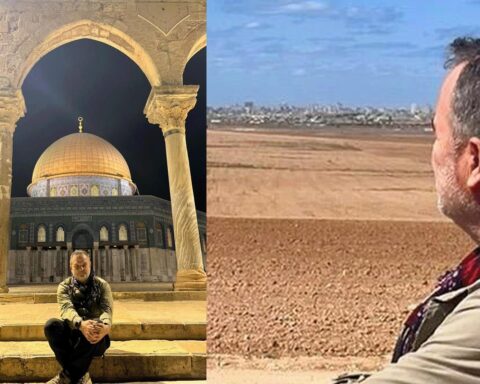Während der Prozess des Waffenverzichts der PKK wie geplant voranschreitet, werden gleichzeitig auch die Versuche, diesen Prozess zu sabotieren, zunehmend entlarvt. Einerseits wird die Diskussion darüber geführt, „was der Staat der Organisation gegeben hat, damit sie die Waffen niederlegt“, andererseits wird versucht, durch sogenannte ‚Prognosen‘ den Eindruck zu erwecken, es gebe Spannungen zwischen dem Präsidenten und Bahçeli, die beide Parteien des Prozesses sind. Solche Versuche haben zwar keine entscheidende Wirkung auf das Ergebnis, können jedoch die öffentliche Wahrnehmung negativ beeinflussen. Für die Personen, die die neue Initiative leiten und bereits zwischen 2009 und 2015 in diesen Prozessen tätig waren, sind solche ‚Aktivitäten‘ wirkungslos. Nichtsdestotrotz sollte man die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, dass solche Aktivitäten konstruierte ‚Ängste‘ auslösen könnten.
Betrachtet man die jüngere Geschichte des Landes, sind sowohl störende Aktivitäten dieser Art als auch die Lösungsbemühungen der Regierung keine Neuheit. Der Lösungsansatz ist ein zentrales Thema der letzten 40 Jahre. In den Amtszeiten von Özal, Demirel, Yılmaz, Çiller, Erbakan und Ecevit war das Thema stets auf der politischen Agenda. Ebenso wurden Ängste geschürt und störende Aktivitäten durchgeführt, um Lösungsansätze zu sabotieren. Die intensivste Phase war zwischen 2009 und 2015. Da in dieser Zeit im Rahmen der Oslo-Gespräche, der Öffnungs- und Lösungsprozesse ernsthafte Schritte unternommen wurden, versuchten Gegner der Entwaffnung durch das Erzeugen neuer Ängste, politische Schritte der Regierung zu verhindern. Die Prozesse scheiterten durch interne und externe Eingriffe. Es lassen sich zahlreiche Akteure benennen: Der Versuch der PKK, die Gewalt in die Städte zu tragen, FETÖs Bestreben, aus der Situation politische Macht zu gewinnen, sowie gewisse Länder in unserer Region, in Europa und ein bestimmter Flügel in den USA. Gegen solche Sabotageversuche hilft nur, den Verlauf des Prozesses offen und klar zu kommunizieren.
Warum Geheimhaltung?
Die meisten Prozesse zur Entwaffnung von Organisationen folgen ähnlichen Abläufen. Es ist jedoch ein großer Unterschied, aus verschiedenen Erfahrungen zu lernen oder sie einfach zu kopieren. Eine gemeinsame Eigenschaft vergleichbarer Fälle ist, dass der Prozess bis zu einem gewissen Punkt geheim abläuft – meist über den Geheimdienst. Denn in dieser Phase geht es vor allem darum, den Prozess der Entwaffnung zu besprechen, zu verhandeln und zu steuern. Eine der besten Beschreibungen dazu lieferte der damalige irische Premierminister Patrick Bartholomew Ahern (Bertie Ahern): „Wir haben die Gespräche jahrelang im Geheimen geführt – andernfalls hätte ich keinen einzigen Tag auf diesem Stuhl sitzen können.“
Eine ähnliche Einschätzung stammt vom ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos Calderón: „Bei uns liefen die Gespräche als ‚geheime Gespräche‘, ‚vertrauliche Gespräche‘ und schließlich als ‚Parlamentsgespräche‘.“ Die geheimen Gespräche definierte er als langjährige, nicht dokumentierte Kontakte. Diese Geheimhaltung dient nicht dazu, etwas vor der Öffentlichkeit zu verbergen, sondern ist notwendig, um die grundlegenden Dynamiken des Prozesses zu etablieren. Es gibt nichts, was „gegeben oder genommen“ wird, und der gesamte Prozess läuft unter der Kenntnis, Genehmigung und Kontrolle der politischen Führung.
Phasen des Prozesses
Hinsichtlich der durchgeführten und geplanten Maßnahmen lässt sich der Prozess in drei grundlegende Phasen unterteilen.
Die erste Phase umfasst die Positionierung des Geheimdienstes und der relevanten Akteure in Bezug auf den Prozess. Diese Phase kann als geheime Verhandlungen und geheimdienstliche Diplomatie bezeichnet werden. In der Türkei wurde dieser Prozess durch eine Erklärung von Devlet Bahçeli öffentlich bekannt. Dennoch begann der Geheimdienst – entsprechend den Abläufen des Staates – mit den notwendigen Schritten und Verhandlungen auf Anweisung und mit Genehmigung des Präsidenten. Die Hauptaufgabe in dieser Phase ist es, Gespräche zu führen und den Prozess zur Entwaffnung zu organisieren. Genau das geschieht derzeit.
Die zweite Phase beginnt nach der Entwaffnung der Organisation. Diese lässt sich als „juristische Nachbearbeitung des Entwaffnungsprozesses“ bezeichnen, also die Anwendung bestehender Gesetze auf die Mitglieder der entwaffneten Organisation. Die vorhandene Gesetzgebung ist weitreichend und deckt viele notwendige Aspekte ab. Sollten jedoch zusätzliche Regelungen erforderlich sein, kann und sollte das Parlament aktiv werden.
Verantwortung des Parlaments
Die dritte Phase ist die Vorbereitung und parlamentarische Beratung der notwendigen gesetzlichen Regelungen. Diese Phase kann als gesetzgeberische Arbeit innerhalb einer gesellschaftlichen Legitimität bezeichnet werden. Angesichts der aktuellen Zusammensetzung des Parlaments lässt sich sagen, dass eine hohe gesellschaftliche Repräsentativität vorhanden ist. Trotz Wahlhürden und Bündnissystemen ist die breite Repräsentation des Parlaments von großer Bedeutung. Dies erleichtert das Verständnis und die Akzeptanz gesetzlicher Regelungen in der Gesellschaft. Tatsächlich existiert bereits ein umfangreicher rechtlicher Rahmen in Bezug auf Waffenabgabe und terroristische Organisationen. Der erste Schritt in diesem Prozess sollte die Anwendung dieses Rahmens sein. Bei auftretenden Problemen, die nicht durch geltende Gesetze abgedeckt sind, kann durch neue gesetzliche Regelungen Abhilfe geschaffen werden. Da die Gesetzgebung Aufgabe des Parlaments ist, ist es nicht korrekt, den Prozess unter dem Aspekt von „was wurde gegeben“ oder „was wurde genommen“ zu bewerten. Ziel ist es, den gesellschaftlichen Frieden zu sichern und die Republik dauerhaft zu stärken.
Ziel: Der starke Bürger
Lassen Sie mich das von Anfang an klarstellen: Es wurde nichts gegeben oder genommen. Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, eines der gravierendsten Probleme des Landes zu lösen – ein Problem, das die Sicherheit von Leben und Eigentum der Bürger direkt betrifft. Die Hauptverantwortung der Staatsführung ist es, ein politisches Klima zu schaffen, in dem alle Bürger – unabhängig von ihrer Herkunft – gleiche Rechte genießen. Es reicht jedoch nicht aus, dieses politische Klima zu schaffen; die Bürger müssen es auch spüren. Denn einige Maßnahmen, die seit der Gründungszeit des Landes und in späteren Perioden ergriffen wurden, werden als Ausdruck von Diskriminierung unter den Bürgern wahrgenommen. Entsprechende Schritte zu unternehmen liegt in der Verantwortung der Regierung.
Bewertungen wie „was wurde gegeben“ oder „was wird gegeben werden“, die im Zusammenhang mit der Entwaffnung der PKK aufkommen, spiegeln im Kern konstruierte Ängste wider. Sie sind Ausdruck der Unfähigkeit, Gleichberechtigung für alle zu akzeptieren. Es wäre treffender, dies als Angst vor dem Verlust einer hegemonialen Position zu bezeichnen. Um es deutlich zu sagen: Die unausgesprochene Botschaft dahinter lautet oft: „Eigentlich sind wir die Gründer und Eigentümer dieses Landes – jetzt sollen sie uns gleichgestellt werden.“ Es ist die Angst davor, den privilegierten Status zu verlieren und nicht mehr überlegen zu sein. Diese Angst ist das Ergebnis einer auf Staatssicherheit ausgerichteten Paradigma.
Ich möchte ganz klar sagen: Die Republik ist kein System, in dem jemand jemand anderem etwas gibt oder Geschenke verteilt. Auch in diesem Prozess wird niemandem etwas gegeben. Die Regierung will lediglich das von Waffen und Gewalt geprägte anormale Regierungsklima durch eine Atmosphäre ersetzen, in der Waffen und Gewalt keine Mittel mehr sind. Ziel ist es, einen politischen Raum zu schaffen, in dem alle gleiche Rechte haben – ohne illegale Elemente. Die Entwaffnung ist kein Ziel an sich, sondern ein Mittel zur Errichtung eines demokratischen Systems, zur demokratischen Transformation des Staates und zur vollständigen Umsetzung des Prinzips der gleichberechtigten Staatsbürgerschaft. Es ist der erste Schritt hin zu einem Paradigmenwechsel: weg von einem staatlich-zentrierten Sicherheitsverständnis, hin zu einem Ansatz, der den Menschen und seine Sicherheit in den Mittelpunkt stellt.
Übrigens, die futuristischen Ansätze und selbsternannten Deutungen jener Denkweisen, die in der Vergangenheit weder zutreffende Prognosen zu politischen Prozessen geliefert noch in kritischen Momenten konstruktive Positionen eingenommen haben, sind im heutigen Kontext nicht ernst zu nehmen. Was wir derzeit erleben, ist ein lebenswichtiges Thema, bei dem jeder Mensch, der die Türkei als seine Heimat betrachtet, direkt oder indirekt einen Preis bezahlt hat. In dieser Angelegenheit werden ernsthafte und aufrichtige Schritte unternommen, um zum Guten beizutragen. Es handelt sich nicht um eine komplexe Situation. Nach vierzig Jahren, die unserem Land, unserem Volk und unserer Region nichts eingebracht haben, wird nun versucht, eine Wunde zu heilen. Und vergessen Sie nicht: Während diese Wunde geschlossen wird, wird sehr schnell deutlich, wer zum Guten und wer zum Schlechten beiträgt.
Quelle: https://www.perspektif.online/silah-birakmak-icin-ne-veriliyor/