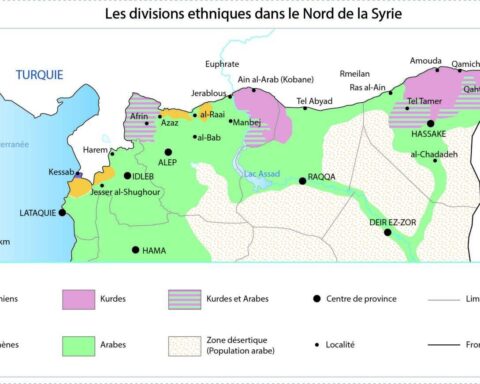Stockholm – Im Januar 2025 unterzeichnete US-Präsident Donald Trump ein Präsidialdekret, das das „Waffen“ von Bundesbehörden beenden sollte, nachdem er behauptete, dass die Verbindungen zwischen der Polizei und dem Geheimdienst von der vorherigen Regierung genutzt wurden, um politische Gegner ins Visier zu nehmen. Kritiker verurteilten diese Entscheidung als eine politische Geste, während Unterstützer sie als einen mutigen Stand gegen parteipolitische Exzesse betrachteten. Doch unter diesem rechtlichen Akt liegt eine viel größere Geschichte, die Energienetze, Seehandelsrouten, den globalen Handel und Finanzströme umfasst.
Forscher im Bereich internationale Beziehungen haben sich seit langem mit der Frage beschäftigt, wie asymmetrische wirtschaftliche Beziehungen genutzt werden können, um strategische Vorteile zu erlangen. Eine der wichtigsten Arbeiten des 20. Jahrhunderts in diesem Bereich war Albert O. Hirschmans 1945 veröffentlichte Studie National Power and the Structure of Foreign Trade, die zeigte, wie dominante Mächte in ungleichen Handelsbeziehungen ihre Positionen nutzen können, um politische Zugeständnisse von schwächeren Partnern zu erzwingen. Ähnlich katalogisierte David A. Baldwin in seiner Arbeit Economic Statecraft in den 1980er Jahren verschiedene Formen von wirtschaftlichem Druck und schlug vor, dass Sanktionen, Hilfen und Handelsanreize genauso zwangsläufig sein können wie militärische Macht.
In den folgenden Jahrzehnten (in den 1990er Jahren) argumentierte Edward Luttwak in einem einflussreichen Aufsatz, dass nach dem Kalten Krieg der Wettbewerb zwischen Großmächten nicht mehr vorwiegend in militärischen Konflikten, sondern in wirtschaftlicher Rivalität stattfindet. Lange Zeit nahm man an, dass wirtschaftliche Interdependenz natürlicherweise Frieden fördere. Doch zu Beginn der 2000er Jahre wurde diese Vorstellung erneut kritisch hinterfragt, wobei Kritiker behaupteten, dass diese „liberalen Illusionen“ die Spannungen verschleierten, die aus wirtschaftlichen Ungleichgewichten resultieren.
Die Politik entwickelte sich parallel zur Theorie. Wie Alan P. Dobson feststellte, bevorzugte die USA während des Kalten Krieges „Wirtschaftskrieg“ gegenüber direkter militärischer Intervention und nutzte Handelsblockaden, Technologiebeschränkungen und Währungspolitiken als strategische Werkzeuge. In Susan Strange’s bedeutender Theorie zur strukturellen Macht wurde dargelegt, dass die Fähigkeit eines Staates, die Grundlagen internationaler Finanz-, Produktions- oder Technologiesysteme zu gestalten, ihm die Möglichkeit gibt, die Bedingungen für das Engagement aller festzulegen, was die Notwendigkeit verringert, einen Gegner durch direkten militärischen Einsatz zu zwingen.
Ende 2013, kurz bevor Russland „grüne Männchen“ nach Krim und in große Teile der Ostukraine schickte, sah Thomas Wright vom Brookings Institute, dass wirtschaftliche Netzwerke, die gegenseitige Vorteile bieten, zu strategischen Schwachstellen werden können. Drei Jahre später warnte Mark Leonard vom European Council on Foreign Relations in einem Artikel, dass die globalen Netzwerke, die einst wegen ihrer Förderung von Kooperationen gepriesen wurden (grenzüberschreitende Investitionen, Handelsrouten und digitale Infrastruktur), leicht sabotiert und übernommen werden könnten, und prägte den Begriff der „zu Waffen gemachten Interdependenz“.
Seitdem haben Wissenschaftler der sogenannten Helsinki-Schule (Mika Aaltola, Sören Scholvin und Mikael Wigell) auf die strategischen Möglichkeiten hingewiesen, die „geostrategische Korridore“ wie Öl- und Erdgasleitungen, Seehandelsrouten und Unterseekabel für diejenigen bieten, die diese kontrollieren, nutzen oder zerstören können. Gleichzeitig betonen sie, dass diese Korridore zu Engpässen werden können.
Im Jahr 2013 erklärte der ehemalige stellvertretende US-Nationaler Sicherheitsberater Juan Zarate in seinem Buch The War on the Treasury wie Finanznetzwerke verwendet werden können, um Terroristen und andere illegale Aktivitäten zu bekämpfen. In ähnlicher Weise zeigten Robert D. Blackwill und Jennifer M. Harris, welche neuen effektiven Wege zur Sanktionierung das interbankliche SWIFT-Nachrichtennetzwerk eröffnete, und Cameron Rotblat erweiterte die „Waffenisierung von Flusswegen“-Logik auf andere Zahlungssysteme, Clearingstellen und Zentralbanknetzwerke. 2019 argumentierten Henry Farrell und Abraham Newman in einem Artikel über „bewaffnete Interdependenz“, dass Staaten, die in globalen Informations- und Finanznetzwerken zentrale Punkte beherrschen, ihre Gegner zu unerwünschten Handlungen zwingen oder ihre Transaktionen überwachen können. Gleichzeitig verfolgten Anthea Roberts, Henrique Choer Moraes und Victor Ferguson in ihrer Analyse der zunehmenden „Sicherheitssetzung der Wirtschaftspolitik und der Ökonomisierung der strategischen Politik“ die Spur hin zu einer „neuen geopolitischen Ordnung“.
Der Kontext all dieser Forschungen ist eine Zeit, in der die Globalisierung zunehmend problematisch geworden ist. Die USA haben die Kunst entwickelt, durch die Verfolgung von Dollartransaktionen verdächtige Akteure auf eine schwarze Liste zu setzen und so Organisationen aus dem globalen Finanz- und Zahlungssystem zu verdrängen – und das ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Doch China hat seinerseits durch die Belt and Road Initiative, die mit Schulden finanzierte Häfen, Eisenbahnen und Industrieparks umfasst und sich von Eurasien bis Afrika erstreckt, ein eigenes Netzwerk von Abhängigkeiten aufgebaut.
Zudem begann China, seine Dominanz bei seltenen Erden, die für die Hochtechnologieproduktion von entscheidender Bedeutung sind, als Bedrohung für diejenigen zu nutzen, die ihm entgegentreten. Ein Beispiel dafür ist Chinas Kontrolle über etwa 70 % der globalen Lithiumraffination, mit dem es einen erheblichen Engpass in der Lieferkette der Elektrofahrzeugindustrie geschaffen hat, den es nun als strategische Waffe einsetzt. Die Beziehungen zwischen China und den USA sind ein starkes Beispiel für die wechselseitige Feindschaft, die durch starke Abhängigkeiten ausgelöst wird. Auch in Europa gibt es einen Wettlauf, die Abhängigkeit sowohl von russischer Energie als auch von amerikanischen Zahlungskanälen und chinesischen Telekommunikationsunternehmen zu verringern.
Diese Problematik wird vermutlich bestehen bleiben, da die Nutzung wirtschaftlicher Knotenpunkte als Waffen im Vergleich zu traditionellen Kriegen eine verlockendere Option für Entscheidungsträger darstellt. Doch solche Taktiken haben auch ihre Kosten. Im Laufe der Zeit erhöhen solche Praktiken die Unsicherheit und fördern Vergeltungsmaßnahmen. Staaten, die ihre eigenen Verwundbarkeiten verringern möchten, werden ihre Handelspolitiken verschärfen und technologische Kooperationen einschränken.
In einer derartig fragmentierten strategischen Umgebung wird jeder wirtschaftliche Knotenpunkt – sei es eine Seehandelsroute, ein Zahlungssystem oder eine Datenplattform – zu einer potenziellen Frontlinie. Im Laufe der Zeit könnten bewaffnete Interdependenzen den globalen Handel in rivalisierende Blöcke aufteilen und die Bindungen schwächen, die in den letzten Jahrzehnten beispiellosen Wohlstand für Milliarden von Menschen ermöglicht haben. Wenn jede Pipeline oder Halbleiter-Lieferkette als Trojanisches Pferd angesehen wird, wird es noch schwieriger, bei existenziellen Bedrohungen wie dem Klimawandel oder Pandemien zusammenzuarbeiten.
Es muss ein empfindliches Gleichgewicht zwischen der Nutzung strategischer Positionen und der strategischen Nutzung dieser Positionen als Werkzeuge hergestellt werden. Indem politische Entscheidungsträger erkennen, wie sich bewaffnete Interdependenzen entwickelt haben, können sie die zerstörerischen merkantilistischen Fallen vermeiden, die die früheren Perioden der Globalisierung zerstört haben. Das einzige Problem dabei ist, ob sie tatsächlich bereit sind, dies zu tun.
Carla Norrlöf ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität von Toronto, Senior Fellow am Atlantic Council und Autorin bei Project Syndicate seit 2020.