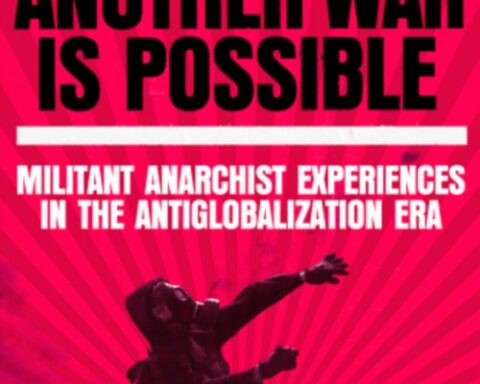Die einfachste Antwort auf diese Frage wäre zu sagen, dass wir uns in einer Übergangszeit befinden. Schließlich sind alle Epochen Übergangszeiten von einer Realität zur anderen. Doch es gibt Übergänge, und es gibt Übergänge. Es gibt Übergänge, bei denen die Realitäten, zu denen die Gesellschaft übergeht, so unterschiedlich sind oder der Wandel so schnell vonstattengeht, dass nicht nur die Institutionen, sondern auch die öffentliche Meinung und individuelle Subjektivität von Chaos, Orientierungslosigkeit und Missverständnissen geprägt sind. In solchen Zeiten ziehen einige die weiße Fahne, andere die schwarze, und wiederum andere (vielleicht die Mehrheit) vergraben sich im anonymen Schutz der Privatsphäre.
Befinden wir uns also in einem dieser Übergänge? Und wer sind eigentlich die „wir“, die diese Frage stellen? Ist dieses ganze Chaos nur das Resultat derjenigen, die an eine gewisse Stabilität und die „Unumkehrbarkeit demokratischer Errungenschaften“ gewöhnt sind? Was aber werden jene Klassen und sozialen Gruppen sagen, die niemals eine solche Stabilität gekannt oder von diesen Errungenschaften profitiert haben? Doch, unabhängig davon, wie unterschiedlich die Realitäten verschiedener Klassen, Gruppen oder Nationen sind, gibt es Zeiten, in denen sich in der Gesellschaft – mitten in zahllosen Missverständnissen – ein Gefühl von Verwirrung, ein Gefühl des Verfalls ausbreitet. Ob dies ein Übergang oder eine Dualität ist, wissen wir nicht einmal. Der Übergang ist der Moment, in dem das, was zuvor existierte, durch etwas Neues (oder Altes) ersetzt wird: Es handelt sich um einen Bruch, der durch Bewegung stattfindet. Dualität hingegen ist die existenzielle Bedingung des gleichzeitigen Daseins von Gegensätzen; ein Zustand, der Brüche oder statische Risse ermöglicht. Der Übergang und die Dualität sind der Geist unserer Zeit.
Zwischen den beiden Weltkriegen des letzten Jahrhunderts trug der Geist der Zeit – der damals nur die Zeit Europas war – einige Ähnlichkeiten mit dem Geist unserer heutigen Zeit. Der relativ kurze Frieden nach dem Ersten Weltkrieg war von kurzer Dauer, und inmitten der Begeisterung über neue wissenschaftliche und technische Errungenschaften herrschte eine Besorgnis, die von der Gewalt der neuen Zeiten, dem Widerstand der Unterdrückten und der Angst nährte, dass die in den Friedensverhandlungen des vorherigen Krieges schlecht gemachten Berechnungen in den nächsten Krieg überführt würden. Wie immer in solchen Zeiten sind es die Künstler, die den Geist ihrer Zeit oft schärfer erfassen als Philosophen oder Sozialwissenschaftler. 1927 veröffentlichte Hermann Hesse seinen Roman „Der Steppenwolf“. In diesem Roman hat ein Mann namens Harry Haller große Schwierigkeiten, sich mit der Gesellschaft, in der er lebt, in Einklang zu bringen. Deshalb fühlt er sich halb Mensch, halb Wolf. Einerseits ist er ein gewöhnlicher Mensch, der ein komfortables bürgerliches Leben führt und sich für Literatur und Musik interessiert. Andererseits ist er ein wildes Tier, das nur seinen Instinkten folgt, die bürgerliche Gesellschaft verachtet und sich ihr fremd fühlt. Irgendwann stößt er auf ein Buch mit dem Titel „Steppenwolf-Studie“, was einen Wendepunkt in seinem Leben darstellt. Er freundet sich mit der Prostituierten Herminia und dem Saxophonisten Pablo, dem Besitzer des „Magischen Theaters“, an und lernt, dass jeder Mensch mehr als nur Mensch und Wolf ist. Der Roman beginnt mit einem Vorwort, in dem die Nichte der Vermieterin das Manuskript findet, lange nachdem Harry verschwunden ist.
Ich glaube, dass viele von uns heute in diesem dualen Existenzzustand leben, der keinerlei Bezug zur klassischen Werwolf-Legende der Antike oder zum mittelalterlichen europäischen Volksglauben hat. Lassen Sie uns einige der Anzeichen dieser Trennung gemeinsam betrachten; diese sind sowohl zeitgebunden als auch existenziell und werden besonders intensiv von jungen Menschen erlebt, die oberflächlich betrachtet am besten damit zurechtzukommen scheinen.