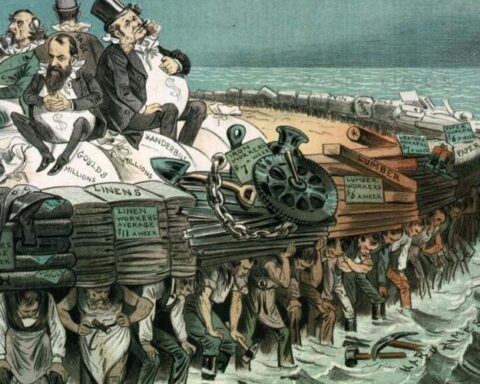Die Al-Aqsa-Flut vom 7. Oktober 2023 hat nicht nur militärisch, sondern auch politisch ein starkes Erdbeben ausgelöst.
Obwohl der Prozess der massenhaften Vernichtung, den Israel im Gazastreifen durchführt, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Brutalität der Besatzung gelenkt hat, hat er gleichzeitig auch die innere politische Repräsentationskrise Palästinas offenbart. Im Zentrum dieser Krise steht Mahmud Abbas.
Der 89-jährige Abbas ist eine Figur, die seit 20 Jahren ohne Wahlen im Amt geblieben ist und dadurch in den Augen der palästinensischen Bevölkerung seine Legitimität weitgehend verloren hat.
Eine der wichtigsten Veränderungen, die der 7. Oktober in der palästinensischen Politik mit sich brachte, war die offene Bloßstellung des Abbas-Regimes als eine Struktur, die sich nicht am Volk, sondern vielmehr an der Zufriedenheit Israels und des Westens orientiert.
In diesem Sinne hat der 7. Oktober die autoritäre Regierungsführung von Mahmud Abbas – der im Namen des palästinensischen Staates vorgibt zu sprechen, in der Praxis jedoch im Einklang mit israelischen Interessen agiert – offengelegt.
Damit wurde erneut die dringende Notwendigkeit einer tiefgreifenden und umfassenden Umstrukturierung der politischen Repräsentation Palästinas in der Nach-Besatzungsära auf die Tagesordnung gesetzt.
Abbas’ distanzierte Haltung zur nationalen Einheit
Die Äußerung Mahmud Abbas’ im April 2025, in der er Mitglieder der Hamas als „Hundesöhne“ bezeichnete, kann nicht nur als politische Polemik gewertet werden, sondern stellt zugleich einen offenen Angriff auf den legitimen Widerstandskampf des palästinensischen Volkes dar. Diese Aussage erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem in Gaza Tausende Märtyrer ihr Leben gelassen hatten und die Al-Qassam-Brigaden einen hohen Preis zahlten – sie markiert daher sowohl moralisch als auch politisch einen tiefen Bruch.
Mit diesen Worten hat Abbas nicht nur die Hamas, sondern auch breite Teile der Bevölkerung, die den palästinensischen Widerstand unterstützen, beleidigt. Darüber hinaus zeigt sich Abbas mit solchen Aussagen sowie mit seinen Erklärungen nach dem 7. Oktober – etwa, dass „Israels Sicherheit gewährleistet werden müsse“ – klar als Gegner des bewaffneten Widerstands und somit in einer Haltung, die den Interessen Israels zugutekommt.
Der wiederholte Gebrauch solcher Formulierungen hat in der Bevölkerung die Überzeugung gestärkt, dass das Abbas-Regime seine Zusammenarbeit mit Israel zu legitimieren sucht. Seit Langem fungiert die Abbas-Administration als eine Autorität, die die Sicherheitskoordination mit Israel aufrechterhält, in der Westbank sowohl Gegner von Abbas als auch bewaffnete Widerstandsgruppen unterdrückt und Wahlen systematisch verhindert.
Vor diesem Hintergrund tragen die Hamas-feindlichen Erklärungen dazu bei, die Kriegsverbrechen Israels und die Besatzung Gazas zu legitimieren und gleichzeitig die innere Einheit Palästinas zu untergraben.
Die Reaktion des Hamas-Politbüromitglieds Usama Hamdan – „Wir sind die Kinder von Izz ad-Din al-Qassam“ – stellt die deutlichste Antwort auf Abbas dar. Diese Aussage ist nicht nur ein identitätspolitisches Bekenntnis, sondern auch ein Ausdruck der Verteidigung nationaler Würde.
Abbas hingegen ignoriert solche Reaktionen und bewegt sich zunehmend in eine autoritäre Richtung. Er hat Schritte unternommen, um Hamas aus dem politischen Raum auszuschließen.
Mit diesen Äußerungen und seiner Strategie, den palästinensischen Staat im Rahmen der israelisch-amerikanischen Achse in sicherheits-, nachrichtendienstliche und wirtschaftliche Strukturen zu integrieren, verfolgt Abbas eine Politik, die weit entfernt ist von einer nationalen Einheit, welche das palästinensische Volk tatsächlich repräsentieren könnte.
Die Ernennung von Hussein al-Scheich
Unmittelbar nach seinen scharfen Aussagen gegen die Hamas ernannte Mahmud Abbas den 64-jährigen Hussein al-Scheich sowohl zum Vizepräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde als auch der PLO – eine Entscheidung, die die politische Ausrichtung des Regimes deutlich offenbart. Diese Ernennung ist kein Ausdruck eines Bemühens um inneren Ausgleich oder demokratische Repräsentation, sondern vielmehr das Ergebnis eines Projekts zur Schaffung eines Nachfolgers, der bei Israel und dem Westen Akzeptanz findet.
Erstmals wurde mit al-Scheich offiziell eine Vizepräsidentenrolle innerhalb der PLO definiert – ein klarer Fingerzeig darauf, wer Abbas potenziell beerben soll. Doch al-Scheich ist nicht die Wahl des palästinensischen Volkes, sondern eine Figur, die vom etablierten Status quo innerhalb der PLO und von äußeren Akteuren gebilligt wird. Damit verfolgt Abbas das Ziel, selbst im Falle seines Todes eine politische Stabilität im Einklang mit Israel sicherzustellen.
Die Biografie von Hussein al-Scheich erzählt die Geschichte eines Mannes, der aus dem historischen Widerstand hervorgegangen ist, sich jedoch im Laufe der Zeit in die diplomatische Bürokratie und Sicherheitsapparate integriert hat. Zwischen 1978 und 1989 war er in israelischer Haft, lernte dort Hebräisch und beteiligte sich 1988 aktiv an der Ersten Intifada. Nach dem Oslo-Abkommen war er in verschiedenen Sicherheitsbehörden tätig, 1999 wurde er zum Fatah-Sekretär für das Westjordanland ernannt.
Ab 2007 leitete er die Zivilbehörde, die für die Koordinierung mit Israel zuständig ist, und vertrat Palästina im Wiederaufbaukomitee für Gaza. 2022 stieg er zum Generalsekretär des PLO-Exekutivkomitees sowie zum Leiter der Verhandlungsabteilung auf – eine Position, die ihn faktisch zur „Nummer Zwei“ innerhalb der PLO machte. Zudem war er die zentrale Figur bei diplomatischen Kontakten mit Trumps Nahost-Gesandtem sowie mit den Golfstaaten und vertrat Abbas häufig international.
Die Positionen, die al-Scheich innehat, verleihen ihm nicht nur politischen, sondern auch administrativen Einfluss. Die von ihm geleitete Zivilbehörde hat direkte Kontrolle über Reise- und Arbeitserlaubnisse im Westjordanland – eine Macht, die ihm sowohl gegenüber der Bevölkerung als auch politischen Rivalen erheblichen Einfluss verschafft und ihn zugleich zu einem integralen Bestandteil des israelischen Verwaltungssystems macht.
Die Legitimationsproblematik seiner Ernennung ist offenkundig: Bedeutende Gruppen wie die Hamas, die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), die Demokratische Front (DFLP) und die Nationale Initiative haben den Prozess boykottiert. Die Kritik an dieser Ernennung verweist darauf, dass es sich um einen Versuch der Monopolisierung handelt – beeinflusst von äußeren Kräften.
Dass Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und die USA die Ernennung positiv aufgenommen haben, hat im palästinensischen Volk die Wahrnehmung verstärkt, dass die Entscheidung nicht dem nationalen Willen, sondern den Interessen externer Akteure entspricht.
Zudem gibt es schwerwiegende Vorwürfe gegen al-Scheich aus der Vergangenheit: Es wurden Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung laut, die angeblich durch finanzielle Schweigegelder unterdrückt worden seien – was seine öffentliche Glaubwürdigkeit und moralische Legitimität weiter untergräbt.
In Meinungsumfragen aus dem Jahr 2022 lag seine Unterstützung bei lediglich 3 %, während Marwan Barghouti mit 37 % weiterhin als aussichtsreichster Kandidat gilt. Auch nach der Ernennung bleibt Abbas in der Lage, al-Scheich jederzeit wieder zu entlassen, da dessen Position nur kommissarischen Charakter hat.
Diese Entscheidung stellt somit keine endgültige Nachfolgeregelung dar, sondern vermittelt vielmehr das Bild eines Übergangsszenarios.
Zudem ist ersichtlich, dass diese Ernennung innerhalb der PLO einen taktischen Schritt darstellt: Für den Fall, dass Marwan Barghouti infolge eines Gefangenenaustauschs zwischen Hamas und Israel freikommt, will Abbas offenbar mit der Ernennung al-Scheichs verhindern, dass Barghouti zum Präsidenten der PLO oder eines zukünftigen palästinensischen Staates aufsteigen kann.
Das Scheitern des Abbas-Regimes
Mahmud Abbas hat seit 2005 keine Wahl mehr gewonnen, den Hamas-Sieg bei den Parlamentswahlen 2006 nicht anerkannt und sämtliche Forderungen nach demokratischer Legitimität durch Repression und Ausgrenzung unterdrückt. Selbst angesichts der Zerstörung Gazas hat er mit der Bezeichnung der Hamas – der gewählten Vertretung eines bedeutenden Teils des palästinensischen Volkes – als „Hundesöhne“ offenbart, dass sich sein Regime in Opposition zum eigenen Volk positioniert.
Abbas stellt sich zudem entschieden gegen eine Umstrukturierung der PLO. Die Beteiligung der Hamas an der Organisation wird seit Langem blockiert; die kleine Clique um Abbas hat die PLO in eine rein bürokratische, auf Ramallah zentrierte Struktur verwandelt. Die Parlamente funktionieren nicht, Parteikongresse finden nur noch symbolisch statt – das Volk nimmt diese Strukturen nicht mehr ernst.
Diese Repräsentationskrise betrifft nicht nur die Hamas, sondern auch Jugendbewegungen, die palästinensische Diaspora und die Zivilgesellschaft, die allesamt systematisch ausgeschlossen werden.
Nach dem 7. Oktober jedoch hat sich das internationale Bewusstsein für die palästinensische Sache verändert. Länder wie Südafrika, Kolumbien, Chile, Belize, Venezuela und Malaysia haben Palästina offiziell anerkannt; Frankreich und Großbritannien haben angekündigt, diesen Schritt ebenfalls zu prüfen.
Dies zeigt, dass Hamas zunehmend internationale Anerkennung als politische Kraft gewinnt, während das Abbas-Regime auch auf globaler Ebene an Legitimität verliert. Hamas hat erklärt, nicht auf der Alleinregierung Gazas zu bestehen und ist offen für Modelle wie eine „nationale Einheitsregierung“ oder eine „interimistische Technokratenregierung“.
Das Abbas-Regime jedoch verweigert jede Reaktion auf diese Vorschläge. Im Gegenteil: Es signalisiert seine Bereitschaft, Gaza mit israelischer Zustimmung zu verwalten – ein Verhalten, das zeigt, dass Abbas nicht länger die Interessen Palästinas, sondern jene Israels vertritt.
Die Notwendigkeit einer neuen politischen Architektur
Die Rhetorik und Personalentscheidungen Mahmud Abbas’ machen deutlich, dass in der palästinensischen Politik die Legitimität zunehmend durch eine autoritär aufgezwungene Ordnung ersetzt wurde. Die Ernennung von Hussein al-Scheich ist nicht nur ein Versuch, den bestehenden Status quo zu wahren, sondern auch ein Ausdruck des Versuchs, die Zukunft Palästinas einem von westlichen und israelischen Akteuren vorgezeichneten Szenario zu unterwerfen.
Dabei steht der Wille des palästinensischen Volkes nicht hinter diesem Regime, sondern hinter dem Widerstand, der Unabhängigkeit und der Idee einer gemeinsamen Repräsentation. Der 7. Oktober hat der Welt vor Augen geführt, dass das Abbas-Regime politisch gescheitert ist und Palästina eine neue Repräsentationsarchitektur benötigt – eine demokratische, am Volk orientierte Vision des Widerstands. Diese Vision sollte nicht nur den Widerstand gegen die Besatzung, sondern ebenso den Befreiungskampf gegen innere Herrschaftsstrukturen verkörpern.
Die Überwindung der gegenwärtigen Repräsentationskrise in Palästina erfordert nicht nur das Ende der autoritären Ordnung, die sich in der Person von Abbas manifestiert, sondern auch den Wiederaufbau jener Institutionen, die seit der Oslo-Ära entstanden sind – entfremdet vom Volk und abhängig vom Ausland. In diesem Zusammenhang ist eine Neustrukturierung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) im Rahmen eines breit angelegten und inklusiven politischen Reformprozesses unumgänglich.
Ein neuer Repräsentationsrahmen muss durch einen Nationalkongress oder eine vorläufige Volksversammlung geschaffen werden, in der Vertreter der Diaspora, Jugendbewegungen, zivilgesellschaftlicher Organisationen und Akteure aus dem Gazastreifen mitwirken. Nur so kann verlorene Legitimität wiederhergestellt werden.
Die erklärte Bereitschaft der Hamas, für eine technokratische Übergangsregierung und eine gemeinsame Verwaltung offen zu sein, bietet eine historische Chance für einen solchen Neugründungsprozess.