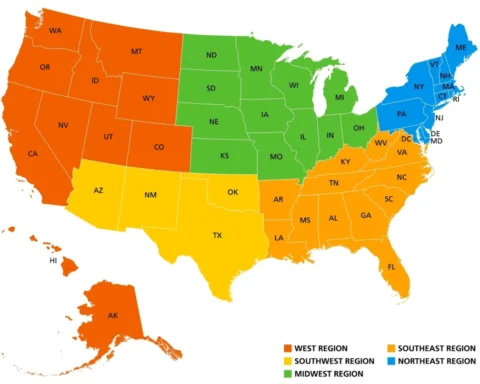Heinz-Jürgen Axt, der als Sektionsherausgeber der Comparative Southeast European Studies, Band 70, Heft 3, mit dem Themenschwerpunkt östliches Mittelmeer fungierte, war zum Zeitpunkt der Vorbereitung dieser Ausgabe emeritierter Professor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen sowie Gastprofessor am Europäischen Institut für Fortgeschrittenes Verhaltensmanagement an der Universität des Saarlandes. Darüber hinaus war er früherer Vizepräsident der Südosteuropa-Gesellschaft in München.
Seine Forschungsgebiete umfassen die europäische Integration, die EU-Erweiterung, die Strukturpolitik der EU, Südosteuropa, Griechenland, die Türkei und Zypern. Zu diesen Themen hat er zahlreiche Publikationen vorgelegt.
Als Herausgeber des Schwerpunktthemas über die Energiequellen im östlichen Mittelmeerraum und die Beziehungen der Region zu den globalen Mächten verfasst Heinz-Jürgen Axt diesen einführenden Beitrag, in dem er auch die eingereichten und veröffentlichten Artikel zu diesem Thema bewertet.
Kritik Bakış
Konflikte und globale Mächte im östlichen Mittelmeer: Eine Einführung
Heinz-Jürgen Axt
11. Oktober 2022
Zusammenfassung
Die Konflikte im östlichen Mittelmeerraum haben eine lange Geschichte, und in jüngerer Zeit haben vermutete Energiereserven zu neuen Spannungen geführt. Zahlreiche Studien analysieren vor allem die Strategien der Anrainerstaaten des Mittelmeers. Dieser Themenschwerpunkt erweitert die Perspektive, indem er auch die globalen Mächte – die Europäische Union (EU), die Vereinigten Staaten (USA), Russland und China – in die Analyse einbezieht. Die Rolle der Regionalmacht Türkei steht dabei ebenfalls im Fokus. Von besonderer Bedeutung ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Da der russische Präsident Gas als Waffe einsetzt und insbesondere Europa unter Druck zu setzen versucht, muss die Relevanz der Energiereserven im östlichen Mittelmeer neu bewertet werden.
Nach dem Ende des Kalten Krieges hatten die Akteure auf globaler politischer Ebene eine regelbasierte Weltordnung versprochen. Dieses Versprechen ist jedoch mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine massiv infrage gestellt worden, was eine Neubewertung der Beziehungen zwischen den globalen Mächten und den Mittelmeerländern erforderlich macht.
Ein „Epochenbruch“ (Zeitenwende) ereignete sich am 24. Februar 2022. Während sich geopolitische Auseinandersetzungen bis dahin auf Bereiche wie Wirtschaft, Finanzen, Energie oder Technologie konzentrierten, zeigte die russische Invasion in der Ukraine, dass Präsident Wladimir Putin nicht davor zurückschreckt, militärische Mittel einzusetzen – nicht nur in Georgien oder Syrien, sondern auch in Europa. Zuvor hatte Russland die Aufständischen in der Ostukraine unterstützt und die Krim annektiert. Damit zerstörte Russland die seit dem Ende des Kalten Krieges etablierte Weltordnung. Die Demokratisierung der Ukraine sollte rückgängig gemacht werden. Beim Vorbereiten seines Angriffskrieges ging Russland davon aus, dass der Westen schwach sei, die transatlantische Zusammenarbeit brüchig und die EU gespalten. Aus russischer Sicht existierten nur drei Weltmächte: die USA, Russland und China. Die EU wurde dabei nicht berücksichtigt. Doch Moskau hat sich womöglich verrechnet: Das offensive Vorgehen Russlands hat Differenzen innerhalb der EU in den Hintergrund gedrängt, die Verteidigungsbereitschaft gestärkt und die transatlantische Kooperation gefestigt.
Dieser Themenschwerpunkt beschäftigt sich mit der Frage, welche Interessen die globalen Mächte im östlichen Mittelmeer verfolgen. In jüngerer Vergangenheit hat sich der Streit um vermutete Energieressourcen verschärft und alte Rivalitäten sind wieder aufgebrochen. Die EU, die USA, Russland und China werden behandelt. Eine Studie zur Türkei rundet die Analyse ab. Als Gasteditor hatte ich zwei Wissenschaftler eingeladen, Beiträge zu Griechenland zu verfassen – leider wurden diese nicht eingereicht. Bei der Untersuchung der Interessen und Ambitionen globaler Mächte muss die veränderte Weltlage infolge des russischen Angriffskrieges berücksichtigt werden. Die Autorinnen und Autoren konnten diese neue Lage – soweit möglich – einbeziehen, wobei einige Einschätzungen zwangsläufig vorläufig bleiben mussten.
Die Konflikte im östlichen Mittelmeer haben eine lange Vorgeschichte. Bereits in den 1950er und 1970er Jahren standen sich Griechenland und die Türkei in Fragen der Seegrenzen gegenüber. Diese Konflikte gerieten in der öffentlichen Wahrnehmung in Vergessenheit, bis die Türkei und Libyen 2019 eine Vereinbarung zur Abgrenzung maritimer Einflusszonen trafen. Griechenland und Zypern sahen ihre Rechte verletzt. Auch wenn es zunächst um die Erkundung und Ausbeutung von Energieressourcen ging, kann ein gewaltsames Aufflammen der Auseinandersetzungen nicht ausgeschlossen werden. Forschungsschiffe werden von Kriegsschiffen begleitet – Zusammenstöße und militärische Zwischenfälle könnten eine Eskalation der Konflikte schnell herbeiführen.
In den letzten Jahren konzentrierten sich viele Studien auf die Rivalitäten zwischen den Mittelmeeranrainern und vernachlässigten dabei die Interessen und Strategien globaler Akteure. Heute jedoch müssen Konflikte im Kontext der sich wandelnden Weltordnung analysiert werden. Daher verfolgt dieser Themenschwerpunkt das Ziel, die Interessen der globalen Mächte EU, USA, Russland und China im östlichen Mittelmeerraum zu klären:
Welcher Art sind ihre Interessen? In welchem Ausmaß sind sie an den Energieressourcen des östlichen Mittelmeers interessiert? Hat die Region strategischen Wert, und wenn ja, welchen? Unterstützen die globalen Mächte bestimmte Mittelmeerstaaten? Sind sie bereit, zu intervenieren, oder ziehen sie es vor, Konflikte einzudämmen? Könnte es sein, dass sich der Fokus globaler Akteure vollständig in den Pazifik verlagert, wo Chinas Aufstieg seinen Ausgang nahm und wo die USA diesen einzudämmen versuchen?
Neben den globalen Akteuren stellt sich auch die Frage nach den Absichten regionaler Mächte. Eine Weltmacht ist ein Staat, der aufgrund seiner Fähigkeit zur (militärischen) Machprojektion bedeutenden Einfluss auf internationale Angelegenheiten hat. Eine Regionalmacht hingegen kann Macht nur innerhalb einer Region projizieren (Kegley und Wittkopf 2000). Die Türkei wird als eine solche Regionalmacht wahrgenommen.
Wenn in dieser Einführung die Rolle und Strategien der globalen Mächte thematisiert werden, könnte man annehmen, dies geschehe auf Grundlage der realistischen Theorie der internationalen Beziehungen (Morgenthau 1954). Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr wird ein empirisch-analytischer Ansatz verfolgt, der offen für unterschiedliche theoretische Perspektiven ist.
Der Realismus geht davon aus, dass im anarchischen Staatensystem – also in einer Welt ohne übergeordnete Weltregierung – Staaten nicht mit der ihnen gegebenen Macht zufrieden sind, sondern aus Sicherheitsgründen nach Hegemonie streben. Die Schwächen der realistischen Theorie wurden zuletzt durch die Einschätzung des russischen Kriegs gegen die Ukraine durch den amerikanischen Politikwissenschaftler John J. Mearsheimer deutlich. Bereits 2014 und erneut 2022 interpretierte er den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht nur als Folge der NATO-Osterweiterung, sondern sprach Russland auch das Recht zu, sich auf Kosten ehemaliger Sowjetrepubliken eine eigene Einflusssphäre zu sichern. Die Ukraine verbleibt in diesem Weltbild nur die Rolle eines Puffers zwischen dem Westen und Russland (Mearsheimer 2014; Mearsheimer 2022).
Dass die Ukraine selbstständig darüber entscheiden kann, ob sie sich zu einer demokratischen Ordnung entwickelt oder zum abhängigen Satellitenstaat Russlands wird, ist mit den Grundannahmen des Realismus nicht vereinbar. Als Gegenmodell zum Realismus postuliert der Liberalismus, dass die Anarchie des Staatensystems durch Verhandlungen, Abkommen und internationale Institutionen eingehegt werden kann (Axt 2022).
Umstrittene Seezonen als Casus Belli
Das östliche Mittelmeer ist eine Region tief verwurzelter Konflikte. Die Anrainerstaaten Griechenland, Türkei, Zypern, Syrien, Libanon, Israel, Ägypten und Libyen sind sich uneinig über ihre maritimen Rechte zur Ausbeutung von Energieressourcen. Zugleich konkurrieren historische Erinnerungen und Narrative nationaler Souveränität; eingefrorene Konflikte behindern die Zusammenarbeit selbst bei gemeinsamen Interessen. Die Konflikte im östlichen Mittelmeer betreffen vor allem Energiefragen; maritime Rechte entzweien Griechenland und die Türkei sowie Zypern und die Türkei. Ähnliche Souveränitätskonflikte bestehen auch zwischen der Türkei und Syrien, dem Libanon und Israel sowie zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde (Axt 2021).
Die Forschung in den internationalen Beziehungen unterscheidet verschiedene Konflikttypen: ethnische, religiöse, ideologische, territoriale, staatsbezogene oder wirtschaftliche Konflikte (Axt, Schwarz und Wiegand 2008, S. 43–45). Die Konflikte in Syrien, im Irak oder in Libyen lassen sich als staatsbezogen einordnen, während der israelisch-palästinensische Konflikt stark territoriale und religiöse Elemente aufweist.
Betrachtet man die Anrainerstaaten des östlichen Mittelmeers, so spielen wirtschaftliche Interessen – vor allem in Bezug auf Energie – eine herausragende Rolle: Die Nachfrage nach Energiequellen ist hoch. Nur Libyen und in geringerem Maße Ägypten sind Nettoenergieexporteure, da sie mehr Energie produzieren als sie verbrauchen. Dagegen sind Zypern, die Türkei, Griechenland und Israel Nettoenergieimporteure (Schenk et al. 2010).
Angesichts der hohen Energieabhängigkeit ist es für die beteiligten Staaten entscheidend, welche Meereszonen sie als ihre eigenen deklarieren – genauer gesagt: ihre „Ausschließlichen Wirtschaftszonen“ (AWZ). In diesen Zonen haben die Küstenstaaten souveräne Rechte zur Erkundung, Ausbeutung, Bewirtschaftung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen. Derzeit lassen sich im östlichen Mittelmeer drei Konfliktcluster unterscheiden:
Erster Konfliktcluster: Türkei und Libyen
Der erste Konfliktkomplex ist vergleichsweise neu. Er wurde durch ein Abkommen zwischen der Türkei und Libyen Ende 2019 über die Abgrenzung maritimer Zonen zur Ausbeutung von Energieressourcen ausgelöst (Axt 2021). Die Vereinbarung räumt beiden Ländern exklusive Rechte zur Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in diesen Zonen ein. Griechenland und Zypern kritisierten, dass die Abgrenzung auf Kosten Dritter erfolgte, da das Memorandum Seegebiete nahe den griechischen Inseln Dodekanes und Kreta für die Türkei beansprucht – Gebiete, die Griechenland seiner eigenen AWZ zurechnet.
Darüber hinaus intervenierte die Türkei im innerlibyschen Bürgerkrieg zwischen der international anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fayez Mustafa al-Sarraj und dem Warlord Feldmarschall Khalifa Belqasim Haftar.
Zweiter Konfliktcluster: AWZ und Inselrechte in der Ägäis
Der zweite Konfliktkomplex betrifft die Frage, ob Inseln das Recht haben, ausschließliche Wirtschaftszonen zu beanspruchen (UN-Seerechtsübereinkommen von 1982, Art. 40–49). Diese Frage ist besonders für die Ägäis relevant, da dort zahlreiche griechische Inseln nahe der türkischen Küste liegen. Griechenland besteht auf dem völkerrechtlichen Grundsatz, dass auch Inseln AWZ beanspruchen dürfen.
Die Türkei hingegen bestreitet dies und argumentiert, dass die griechischen Inseln auf dem Festlandsockel des anatolischen Festlands lägen, was der Türkei das Recht zur Exploration und Ausbeutung verleihe (Siousiouras und Chrysochou 2014). Diese Frage ist umso relevanter, da in der Region Energieressourcen – insbesondere Erdgas – vermutet werden. Die Türkei entsendet Erkundungsschiffe, was Griechenland als Verletzung seiner Souveränität betrachtet. Zudem droht die Türkei mit einem Casus Belli, falls Griechenland seine maritimen Zonen ausweitet – insbesondere die Hoheitsgewässer, in denen Staaten uneingeschränkte Souveränität ausüben.
Dritter Konfliktcluster: Zypern
Der dritte Konfliktbereich betrifft Zypern, eine seit 1974 geteilte Insel mit einem griechischen Teil (Republik Zypern) und einem türkischen Teil (Türkische Republik Nordzypern). Der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei ist ohne die Zypern-Frage nicht zu verstehen. Türkische Forschungsschiffe führen südwestlich der Insel Erkundungen in Gebieten durch, die die Republik Zypern als Teil ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone deklariert. Auch hier werden Forschungsschiffe von Kriegsschiffen begleitet.
2011 schloss die Türkei ein Abkommen mit den Vertretern der türkischen Zyprioten und begann mit Erkundungsarbeiten. Das Abkommen definierte einen ursprünglichen Festlandsockel sowie eine ausschließliche Wirtschaftszone von 200 Seemeilen für Nordzypern – ein Schritt, der als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Republik Zypern gewertet werden muss (Axt 2012).
Die Staatengemeinschaft erkennt ausschließlich die Republik Zypern als legitime Vertretung der Insel an. Griechenland und Zypern verurteilten die türkischen Aktivitäten gemeinsam als „illegal“ und drängen ihre Partner in der EU zu Sanktionen gegen die Türkei.
Die Konflikte im östlichen Mittelmeer beschränken sich nicht allein auf die Anrainerstaaten, sondern bergen das Potenzial für sogenannte „Spill-over-Effekte“ auf benachbarte Regionen – etwa Südosteuropa, den Schwarzmeerraum, den konfliktreichen Nahen Osten (Iran, Irak) oder die nordafrikanischen Staaten. Streitfragen, die geografisch weit vom östlichen Mittelmeer entfernt liegen – wie etwa die Pipeline Nord Stream 2, ein intern gespaltenes Russland, aber auch Differenzen innerhalb der EU und mit den USA – erschweren zusätzlich die Kooperation in der Region.
Energie im östlichen Mittelmeer: Streit um eine wertlose Ressource?
Angesichts der massiven Konflikte im östlichen Mittelmeer liegt eine gewisse Ironie darin, dass sich die Energiequellen in der Region womöglich als wertlos erweisen könnten (Ellinas 2020). Doch Russlands Krieg gegen die Ukraine könnte die bisherigen Annahmen grundlegend verändert haben. Besonders ins Gewicht fällt hierbei, dass Russland Gas als Waffe einsetzt, um auf westliche Sanktionen zu reagieren, die nach der Invasion verhängt wurden.
Unabhängig davon, ob Russland weiterhin eine verlässliche Gasversorgung – insbesondere für EU-Staaten – sicherstellt, bestehen bzw. bestanden vier zentrale Hindernisse für die Erschließung von Erdgas- und Erdölvorkommen im Mittelmeerraum:
-
Anhaltende Konflikte zwischen den Mittelmeerstaaten lassen Investitionen als zu risikoreich erscheinen.
-
Es ist fraglich, ob der Preis für Gas und Öl aus dem östlichen Mittelmeer wettbewerbsfähig ist, wenn andere Anbieter – etwa Russland oder arabische Staaten – zu niedrigeren Preisen liefern können. Das neu entdeckte Sakarya-Gasfeld im Schwarzen Meer könnte die Türkei künftig selbst versorgen.
-
Sollten mediterrane Energiequellen auf europäischen Märkten verkauft werden, stehen dem klare Grenzen entgegen, wenn die EU an ihrem Plan festhält, die Nutzung fossiler Energien drastisch zu reduzieren. Gleichwohl benötigen viele europäische Länder Gas als Brückentechnologie, wenn sie Klimaziele erreichen und nicht wie Frankreich auf Kernenergie setzen wollen.
-
Bis vor Kurzem galt Energieknappheit in der EU nicht als zentrales Problem, da Pipelines wie Nord Stream 1 und TurkStream 2 ausreichend Gas aus Russland lieferten. Die Annahme war, dass insbesondere Länder südlich und östlich des Mittelmeers einen höheren Gasbedarf hätten – nicht aber die EU.
Hinzu kommt: Die Nachfrage nach grüner Energie steigt. Wissenschaftler:innen und politische Entscheidungsträger:innen in Europa, im Nahen Osten und im östlichen Mittelmeer plädieren zunehmend für den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. Energie gilt also nicht primär als Ursache, sondern vielmehr als Auslöser der Konflikte.
Kooperation als Ausweg?
Einige Analyst:innen sind der Ansicht, dass eine Kooperation und gemeinsame Ausbeutung der Energiequellen durch die Mittelmeerstaaten eine Möglichkeit sein könnte, Differenzen zu überwinden. In diesem Zusammenhang wird häufig auf den Schuman-Plan verwiesen, der die Grundlage für die europäische Integration bildete.
Könnte ein vergleichbarer „Schuman-Plan“ für das östliche Mittelmeer, vielleicht unter Einbezug internationaler Akteure, zur Konfliktbewältigung beitragen? Welchen Beitrag könnten globale Mächte leisten? Sind sie bereit und fähig, zur Deeskalation beizutragen, den Dialog zu fördern und Vertrauensbildung sowie Kooperation in der Region zu unterstützen?
Da amerikanische und europäische Unternehmen nicht staatlich kontrolliert werden, stellt sich die Frage, ob gerade private Akteure eine positive Wirkung auf die Befriedung der Region ausüben könnten. Und was ist mit Russland und China? Verfolgt Russland ausschließlich das Ziel, eigene Energieressourcen zu vermarkten? Könnte Chinas „Neue Seidenstraße“ (Belt and Road Initiative) eine Rolle bei der Förderung der Kooperation im östlichen Mittelmeer spielen?
Blockbildungen statt Zusammenarbeit
Bislang zeigt sich ein anderes Bild: Die Anrainerstaaten bilden konkurrierende Allianzen. Griechenland, Zypern, Israel, Libanon und Ägypten definierten 2010 ihre exklusiven Wirtschaftszonen, wobei die Türkei bewusst ausgeschlossen wurde. Ankara erkannte, dass seine Rolle als Energiedrehscheibe für russisches Gas nach Europa gefährdet war – und schloss daraufhin ein Memorandum mit Libyen.
Das Abkommen erlaubte es der türkischen Marine, in libyschen Gewässern zu operieren und eine unsichtbare Barriere zu errichten, die den Gastransport per Pipeline von Zypern nach Europa blockieren könnte (Memorandum of Understanding zwischen der Republik Türkei und der libyschen Einheitsregierung, 2019).
Athen intensivierte die Beziehungen zu Abu Dhabi. Am 16. Januar 2020 gründeten Griechenland, Zypern, Israel, Ägypten, Jordanien und Palästina das EastMed Gas Forum mit Sitz in Kairo. Frankreich stellte einen offiziellen Antrag auf Beitritt, und die USA erklärten, dass sie ständiger Beobachter sein möchten. Ebenfalls im Januar 2020 unterzeichneten Griechenland, Israel und Zypern ein Abkommen über eine geplante Pipeline zur Gaslieferung nach Europa durch das östliche Mittelmeer.
Auch wenn die Realisierbarkeit des Projekts fraglich ist, so zeigt es doch: Die Türkei ist von der intensivierten Zusammenarbeit der Mittelmeerstaaten ausgeschlossen. Athen näherte sich Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter an. Im Mai 2021 besuchte eine hochrangige türkische Delegation Kairo, um die bilateralen Beziehungen zu verbessern. Nach dem Militärputsch gegen die islamistische Regierung 2013 hatten sich die Beziehungen massiv verschlechtert. Nun scheint eine Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen möglich.
Zeitenwende auch in der Energiepolitik
Russlands Invasion in der Ukraine stellt nicht nur in sicherheitspolitischer, sondern auch in energiepolitischer Hinsicht eine Zäsur dar. Wenn ich in dieser Einführung argumentiere, dass sich die Gasressourcen im östlichen Mittelmeer nur schwer erschließen und vermarkten lassen, so könnte Russlands Krieg gegen die Ukraine einen Kurswechsel erzwingen. Der Bedarf an alternativen Energiequellen zum Ausgleich des russischen Lieferausfalls ist gestiegen.
Schon in der Phase der Kriegsvorbereitung zeigte sich dies an den stark gestiegenen Gas- und Ölpreisen – mit gravierenden Folgen für Privathaushalte und Industrie. Offenbar wollte Russland Europas Verletzlichkeit in der Energiefrage demonstrieren, um damit massive Sanktionen abzuwenden.
Das allgegenwärtige Argument, dass der Weg zur Verringerung der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl über die Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien führt, ist im Grunde unumstritten. Doch die entscheidende Frage bleibt, in welchem Tempo, zu welchen Kosten und mit welchen Instrumenten Fortschritte erzielt werden können. Vieles deutet darauf hin, dass schnelle Erfolge schwer zu erreichen sind. Je mehr sich dies in der Praxis bestätigt, desto mehr geraten bisherige Planungen ins Wanken.
Der ursprüngliche Plan, russisches Gas als Brückentechnologie zur Förderung erneuerbarer Energien zu nutzen, steht auf wackeligen Füßen. Um die Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland zu reduzieren, wird mittlerweile über eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken und eine Verzögerung des Ausstiegs aus fossilen Energieträgern diskutiert. Auch Deutschland erwägt eine Verschiebung des Kohleausstiegs.
Folgen für die Energiequellen im östlichen Mittelmeer
Welche Auswirkungen ergeben sich daraus für die vermuteten Energieressourcen im östlichen Mittelmeer? Die Ausbeutung von Gasvorkommen könnte profitabler werden, wenn diese nicht mehr im Preiskonkurrenzverhältnis zu russischen Lieferanten stehen. Die EU könnte sich gezwungen sehen, ihre ursprünglich geplante, aber zuletzt nur halbherzig verfolgte Unterstützung für die Erschließung mediterraner Gasquellen wiederzubeleben.
Der Beitrag von Emile Badarin und Tobias Schumacher in dieser Ausgabe gibt nähere Informationen über die Finanzhilfen der EU im Rahmen des „Projects of Common Interest“ (PCI) im Kontext des Southern Gas Corridor. Wenn sich – trotz der veränderten Weltlage – der Transport von Gas über Pipelines weiterhin als problematisch erweist, könnte der Transport von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus dem Mittelmeerraum attraktiver werden, da innerhalb der EU die Unterstützung für diese Technologie wächst. Entsprechend sollen Transportkapazitäten und Hafeninfrastrukturen ausgebaut werden.
Neuberechnung von Energieoptionen
Mit der dynamischen Entwicklung der Situation können sich bisherige Berechnungen als überholt erweisen. Gas aus dem Mittelmeer könnte somit eine neue Zukunft bekommen – und der Wettbewerb um den Zugang zu diesen Ressourcen würde sich verschärfen.
Was für das östliche Mittelmeer gilt, trifft auch auf andere Regionen Europas zu: So diskutieren die Niederlande derzeit – trotz des Risikos von Erdbeben – eine Verschiebung des geplanten Ausstiegs aus der Gasförderung, der ursprünglich für Ende 2022 vorgesehen war (Kotkamp 2022).
Eine regelbasierte Weltordnung: Niedergang oder Wiederbelebung des Westens?
Die Entwicklungen im östlichen Mittelmeerraum dürfen nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen in den globalen Kontext eingeordnet werden. Die historische Entwicklung Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs lässt sich in drei Phasen unterteilen. Die erste Phase war der Kalte Krieg, in dem die Abschreckung dominierte. Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 1975 leitete die zweite Phase ein, in der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Entspannungspolitik vorherrschte. Diese Phase fand mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ihr Ende. Die ersten beiden Phasen lassen sich auch mit Blick auf den östlichen Mittelmeerraum beschreiben.
Die Bipolarität nach 1945 beruhte auf dem Prinzip der Abschreckung. Die westlichen und östlichen Blöcke waren überzeugt, dass ein Atomkrieg keine Sieger kennen würde. Die Supermächte beschränkten sich daher auf Stellvertreterkriege, etwa in Korea (1950–1953), Vietnam (1955–1975) oder Afghanistan (1979–1989). Die Bipolarität wurde stabiler, als die gegensätzlichen Blöcke erkannten, dass es von Vorteil war, gemeinsame bindende Regeln und Institutionen zu schaffen. Immanuel Kant entwickelte 1795 in seinem Werk Zum ewigen Frieden die Idee, dass eine Friedensordnung möglich sei, wenn sich die Staatenwelt auf gemeinsame rechtliche Normen und entsprechende Institutionen einigt (Kant 2003). Die 1945 gegründeten Vereinten Nationen griffen diese Prinzipien auf, indem sie die Unterzeichnerstaaten zur Gewaltverzicht und zur Achtung der territorialen Integrität und politischen Unabhängigkeit anderer Staaten verpflichteten. Das Recht über die Macht zu stellen – das war Kants Vision. Es gelang, ein weltweit anerkanntes normatives Prinzip zu etablieren, auch wenn es die internationalen Beziehungen nicht grundlegend prägte. Das Vetorecht der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ließ das Eigeninteresse dominieren. Dennoch wurden zentrale Prinzipien einer geregelten Konfliktlösung verankert, auf die sich Staaten berufen und mit denen Bürger ihre Führungen mahnen konnten. Eine ideale Weltordnung wäre regelbasiert und multilateral.
Die Anliegen der Vereinten Nationen wurden 1975 mit der KSZE in Europa aufgenommen. Die Sowjetunion und der Westen konnten sich auf ein „Paket“ einigen: Während für die Sowjetunion und ihre Verbündeten die Anerkennung der Nachkriegsgrenzen zentral war, lag der Fokus des Westens auf Gewaltverzicht und der Verpflichtung zu den Menschenrechten. Auch wenn die Zahl der Teilnehmerstaaten wuchs und die Institutionen ausgebaut wurden, konnte sich die KSZE nicht zu einem System kollektiver Sicherheit im Sinne des philosophischen Idealismus entwickeln, auf dem Kants Vision beruhte. Das machtbasierte Konzept des Realismus blieb dominant: Staaten verfolgen Eigeninteressen und streben aus Sicherheitsgründen nach Hegemonie.
Die Existenz der sich antagonistisch gegenüberstehenden Militärblöcke erlaubte nicht die Entwicklung von Mechanismen und Instrumenten zur friedlichen Konfliktlösung. Doch die KSZE war in Zeiten des Kalten Krieges von hoher politischer Relevanz (Axt 1993). Wenn der politische Wille – insbesondere der Supermächte – vorhanden war, wurden in Verhandlungen Fragen zu Sicherheit, Abrüstung, Menschenrechten, vertrauensbildenden Maßnahmen, wirtschaftlicher Zusammenarbeit und der „menschlichen Dimension“ behandelt. Als sich die Staatsoberhäupter im November 1990 in Paris trafen, um die „Charta von Paris für ein neues Europa“ zu verabschieden, waren die Erwartungen groß, dass Frieden, gegenseitiges Verständnis und Fortschritt in Europa gesichert werden könnten. 1995 wurde die KSZE in die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) überführt – als eine ständige Staatenkonferenz, die gemäß Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen als regionale Sicherheitsorganisation dienen sollte.
Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde 1997 die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet, um eine Partnerschaft zu etablieren und gegenseitiges Misstrauen zu überwinden. Die veränderten Rahmenbedingungen wurden anerkannt, ein gemeinsamer Stabilitätsraum sollte durch Gewaltverzicht und Respekt gegenüber der Souveränität und Selbstbestimmung der Völker geschaffen werden (Velickovic 2009). Ein NATO-Russland-Rat sollte bei Spannungen Lösungen ermöglichen. Doch mit der zunehmenden Entfremdung zwischen den NATO-Staaten und Russland, gegenseitigen Vertragsbruchsvorwürfen, neuen Rüstungsprogrammen anstelle von Abrüstung und dem Verzicht auf Rüstungskontrolle konnte der Rat die Spannungen nicht mit den vereinbarten Regeln und Mechanismen überwinden.
Die Bemühungen um eine globale Sicherheitsarchitektur wurzeln im sogenannten normativen Projekt des Westens. Die Amerikanische Revolution von 1776 und die Französische Revolution von 1789 verankerten Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, unabhängige Justiz, Demokratie und Volkssouveränität (Winkler 2015, 15–18). Von den Vereinten Nationen bis zur NATO-Russland-Grundakte wurden diese Prinzipien in den Ost-West-Beziehungen aufgegriffen. Das Ende des Kalten Krieges nährte die Hoffnung, dass das normative Projekt des Westens weltweit tragendes Prinzip werden könnte. Marktwirtschaft und Demokratie waren in allen relevanten Erklärungen als Selbstverpflichtungen enthalten. Heute zeigt sich jedoch, dass der Wunsch nach Freiheit an der Realität imperialer Großmachtpolitik Russlands in Ländern wie der Ukraine oder Georgien scheitert. Angesichts der zahlreichen Krisenherde und Machtkonflikte weltweit und der Konkurrenz zwischen den Großmächten erscheint es fraglich, ob sich die internationalen Beziehungen stabilisieren lassen. Der Begriff der „multipolaren Weltordnung“ ist in diesem Kontext eher ein Euphemismus. Eine „Weltordnung ohne den Westen“, wie sie der deutsche Politiker Gernot Erler 2018 in seinem gleichnamigen Buch beschreibt, gibt Anlass zur Sorge. Besonders deutlich wird dies in der Ablehnung der westlich-liberalen Demokratie durch die aufstrebenden Mächte Russland und China, die stattdessen autoritäre Präsidialsysteme etabliert haben (Erler 2018, 147).
In den letzten Jahren wurde der Westen zunehmend Gegenstand politischer Debatten. Der überhastete Rückzug aus Afghanistan im Jahr 2021 hinterließ ein Vakuum, das viele Fragen aufwarf: Kann die EU diese Lücke füllen und strategische Autonomie erreichen – oder werden Russland und China einspringen? Ist etwas dran an der chinesischen Erzählung vom Niedergang des Westens und Aufstieg des Ostens? Hat der unilateral initiierte Rückzug der USA das Vertrauen der Verbündeten in die amerikanischen Sicherheitsgarantien erschüttert? Ist die EU sich nun selbst überlassen – und kann sie geschlossen und kohärent handeln? Wurden die Risiken lokaler und regionaler Konflikte noch realistisch eingeschätzt? Haben die Nachrichtendienste die Eskalationsgeschwindigkeit und die Machtverschiebungen zuverlässig eingeschätzt? Kurz gesagt: Markierte der Afghanistan-Rückzug das Ende der Idee des Westens, dass universelle Werte wie Demokratie, Pluralismus, Toleranz oder „Nation Building“ weltweit umsetzbar sind? Bewegen wir uns hin zu einer reinen Realpolitik, die nur eigene Interessen kennt und multilaterales Handeln ablehnt? Falls ja, wären die Konflikte im östlichen Mittelmeerraum nur Ausdruck nationalstaatlicher Interessen, und der Wille zur Konfliktreduktion würde sinken. Deshalb ist es entscheidend, dass die damit verbundenen Fragen unter Einbeziehung der globalen Akteure analysiert werden.
Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat die dritte Phase der Nachkriegsordnung endgültig eingeläutet. Der russische Präsident folgte Carl von Clausewitz’ berühmtem Diktum, dass der Krieg „eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ sei (Clausewitz 1968). Die Entwicklung eines demokratisch-liberalen Systems in einem ehemaligen Staat der Sowjetunion wurde von Putin als Bedrohung wahrgenommen (Axt 2022) und stand seinen imperialen Ambitionen entgegen. Am 24. Februar 2022 erhielten russische Panzer den Befehl zum Einmarsch in die Ukraine. Russland ging offensichtlich davon aus, dass der Westen zu schwach sei, um sich gegen die Aggression zu wehren. Der überstürzte Rückzug aus Afghanistan, die Fixierung der USA auf China und die divergierenden Interessen innerhalb der EU könnten Putin in seinem Vorgehen bestärkt haben.
Doch Russland könnte sich verkalkuliert haben. Das Gegenteil dessen, was Putin erwartet hatte, ist eingetreten: Die Geschlossenheit des Westens wurde gestärkt, die transatlantische Partnerschaft gefestigt, inner-europäische Differenzen in den Hintergrund gedrängt. Der Westen hat sich als abschreckungsfähig erwiesen. Deutschland ist ein paradigmatisches Beispiel. Lange Zeit galt die Devise, dass Frieden nur mit Russland möglich sei, dass Entspannung keine Abschreckung benötige. Als nach der Invasion klar wurde, dass der russische Präsident daran kein Interesse hatte, erfolgte in Deutschland ein radikaler Kurswechsel. Nichts zeigt dies deutlicher als die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag vom 27. Februar 2022. Deutschland wolle demnach die Verteidigungsausgaben auf über zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr bereitstellen, bewaffnete Drohnen beschaffen, Panzerabwehrwaffen und Flugabwehrraketen an die Ukraine liefern und gemeinsame europäische Rüstungsprojekte beschleunigen (Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz, 27. Februar 2022). Inzwischen jedoch wachsen die Zweifel, ob die Bundesregierung ihren Ankündigungen auch entsprechende Taten folgen lässt. Nicht nur die Opposition in Deutschland, sondern auch viele EU-Partner, insbesondere in Osteuropa, drängen die Berliner Regierung zu entschlossenem Handeln – vor allem bei der Unterstützung der Ukraine mit angefordertem militärischem Material.
Eine Region in Abhängigkeit von den globalen Mächten?
Eine fundierte Einschätzung der Interessen der globalen Mächte im Hinblick auf die Entwicklungen im östlichen Mittelmeerraum ist nur möglich, wenn ihr gegenwärtiger Geisteszustand und ihre gesellschaftliche Ausrichtung berücksichtigt werden. Dazu zählen sowohl die wirtschaftliche und politische Lage als auch die Bestrebungen der führenden Eliten sowie die Rolle der Akteure der Zivilgesellschaft. Die internationale Politik spiegelt mehr wider als das im Fokus des realistischen Ansatzes stehende Konzept einer Staatenwelt vermuten lässt.
Um die Interessen der globalen Mächte in der Region des östlichen Mittelmeers beschreiben zu können, ist es sinnvoll, die gegenseitigen Abhängigkeiten näher zu erläutern. In den 1970er-Jahren entstand in der Entwicklungspolitik und der internationalen Beziehungen die Debatte, ob Entwicklungsländer nicht nur von den Industriestaaten abhängig seien, sondern ob man vielmehr von einer Beziehung der Interdependenz sprechen könne. Robert O. Keohane und Joseph S. Nye brachten in die wissenschaftliche Debatte die Perspektive ein, dass die Ölpreiskrise von 1973 deutlich gemacht habe, wie stark auch die industrialisierten ölimportierenden Länder von den Produzentenländern abhängig seien (Keohane und Nye 1977). Dieses Paradigma lässt sich mit gewissem Nutzen auch auf das Verhältnis der Mittelmeerstaaten zu den globalen Mächten anwenden. Es kann davon ausgegangen werden, dass gegenseitige Abhängigkeit die Beziehungen zwischen Staaten stabilisieren kann. Diese Annahme wird jedoch infrage gestellt, wenn politische Führer ihre Entscheidungen nicht mehr auf Basis rationaler Abwägungen treffen und unkalkulierbar werden – wie es derzeit beim russischen Präsidenten der Fall ist.
Hier kann eine Analogie zur Theorie des Neofunktionalismus gezogen werden. In den 1960er- und 1970er-Jahren ging man davon aus, dass die europäische Integration nach 1945 quasi automatisch durch schrittweise Übertragung von Zuständigkeiten und sogenannte Spill-Over-Prozesse voranschreite (Haas 1968). Je mehr sich die Integration als vorteilhaft für alle Beteiligten erwies, desto eher waren sie bereit, Kompetenzen an ein vereintes Europa abzugeben. In der Realität wurde diese Entwicklung jedoch bereits 1965 gestoppt, als der dezidiert nationalistisch agierende französische Präsident Charles de Gaulle die sogenannte „Politik des leeren Stuhls“ verfolgte, was den Integrationsprozess zurückwarf. Da sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) nicht auf eine von Frankreich gewünschte Erhöhung der Agrarpreise einigen konnten, blieb der französische Vertreter für ein halbes Jahr den Sitzungen des Ministerrats fern (Bomberg, Peterson und Stubb 2008, 33–35). Die EWG war entscheidungsunfähig. Wissenschaftler wie Haas passten daraufhin ihre neofunktionalistische Theorie an (Haas 1975). Bezogen auf das heutige Verhältnis zwischen Russland und dem Westen kann festgestellt werden, dass westliche Politiker gute Gründe hatten, auf interdependente Beziehungen mit Russland zu setzen – die Energieabhängigkeit des Westens von Russland und die Technologieabhängigkeit Russlands vom Westen galten als stabilisierende Faktoren. Doch mit der zunehmenden Machtfülle eines extrem nationalistischen, neo-imperialistischen und autoritären Führers wie Präsident Putin erwies sich diese Annahme als trügerisch. Dies mündete schließlich im Krieg gegen die Ukraine im Jahr 2022. Somit eröffnet Interdependenz zwar Stabilisierungsperspektiven, stößt jedoch zugleich an klare Grenzen.
Wie ist also der Stand der Beziehungen zwischen den Mittelmeerstaaten und den Vereinigten Staaten? Betrachtet man nur die drei Kontrahenten Griechenland, Türkei und Zypern, so stellt man fest, dass Griechenland traditionell stark von den USA abhängig war – innenpolitisch, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Bürgerkriegs in Griechenland (1946–1949), war es die USA, die die „kommunistische Gefahr“ eindämmte (Couloumbis und Iatridis 1980). Der wirtschaftliche Wiederaufbau des Landes war stark auf amerikanische Unterstützung angewiesen. Dies änderte sich mit dem wachsenden Engagement der Europäischen Union in der Entwicklung Griechenlands einerseits und der Wirksamkeit der Entspannungspolitik im sicherheitspolitischen Bereich andererseits. Mit dem Zerfall der Sowjetunion verlor Griechenland als Teil des westlichen Schutzschilds an sicherheitspolitischer Relevanz. Als die USA begannen, China als größte Herausforderung zu betrachten, sank die Bedeutung Griechenlands in der amerikanischen Sicherheitsstrategie. Athen wurde weniger abhängig von den USA, konnte jedoch kaum eine für sich vorteilhafte Interdependenz aufbauen.
Russlands Invasion der Ukraine veränderte das Verhältnis zwischen den Mittelmeerstaaten und den globalen Mächten grundlegend. Die Beziehungen zu Russland wurden auf eine harte Probe gestellt. Griechenland und Zypern schlossen sich den von Westen verhängten Sanktionen an. Alle Staaten prüfen Möglichkeiten, ihre Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu reduzieren. Die westliche Verteidigungsallianz erlangte neue Wertschätzung – ebenso wie die EU, von der aktive wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung erwartet wurde.
Ein Blick auf die NATO: Für die USA war NATO in der Vergangenheit zentrales Element zur Eindämmung des Kommunismus sowie zur mäßigenden Einflussnahme auf die Kontrahenten Griechenland und Türkei. Noch in den Jahren 1995–1996 waren es die USA und die NATO, die im Konflikt um die kleine Felseninsel Imia/Kardak Athen und Ankara von einer militärischen Eskalation abhalten konnten (Axt, Schwarz und Wiegand 2008, 177–178). Eine Politik der Äquidistanz Washingtons gegenüber beiden Kontrahenten machte dies möglich. Diese Fähigkeit der USA und der NATO, zwischen Mitgliedern im Mittelmeerraum zu vermitteln, ist heute kaum noch gegeben. Athen sucht zunehmend Allianzen mit Israel und den Golfstaaten. Die Beziehungen Ankaras zu den USA kühlten sich im Zuge der Kriege im Nahen Osten erheblich ab. Die Türkei warf den USA vor, im Nahen Osten mit Gruppen wie der kurdennahen YPG (Yekîneyên Parastina Gel, Volksverteidigungseinheiten) militärisch zu kooperieren, die die Sicherheit der Türkei gefährdeten. Die Türkei fühlt sich vom Westen zu wenig unterstützt, möchte den westlichen Einfluss in eigenen Interessensgebieten beschränken (Bardakçı 2021). Wo möglich, versucht Ankara, den Rückzug der USA aus dem Nahen Osten zu eigenem Vorteil zu nutzen. Zum gestiegenen Selbstbewusstsein der Türkei siehe den Beitrag von Mehmet Bardakçı in diesem Themenheft. Dass die Türkei auf russische Raketentechnologie – anstelle der amerikanischen – setzte, schadete den bilateralen Beziehungen erheblich (Tol und Taşpınar 2019). Ankara reduzierte somit seine Abhängigkeit von den USA, konnte jedoch keine wechselseitige Abhängigkeit etablieren. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine könnte sich das Verhältnis der Türkei zum Westen wieder annähern (Seufert 2022). Die Türkei pflegt gute wirtschaftliche Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine. Daher ist es nachvollziehbar, dass sich Ankara als Vermittler zwischen beiden Parteien anbietet (Malsin 2022). Die Türkei unternahm bereits erste Schritte gegen Russland: Die Meerengen von Bosporus und Dardanellen wurden für Kriegsschiffe gesperrt – ein symbolischer Akt, da russische Kriegsschiffe bereits stationiert waren. Ankara bezeichnete den Konflikt als Krieg und widersprach damit der russischen Narrative einer „militärischen Spezialoperation“. Der Einmarsch Russlands wurde als inakzeptabel bezeichnet. Rhetorisch betont die Türkei ihre Loyalität zur NATO, verweigert sich jedoch westlichen Wirtschaftssanktionen mit dem Hinweis auf nationale Interessen. Aus geografischen und historischen Gründen möchte Ankara nicht, dass Moskau wieder Kontrolle über Odessa und das Schwarze Meer erlangt (vgl. Beitrag von Zaur Gasimov in diesem Heft). Es bedarf nur geringer Anlässe, um die jahrhundertealten Rivalitäten zwischen dem Osmanischen und dem Russischen Reich wieder aufleben zu lassen.
Während sich die Beziehungen der Türkei zu den USA in den letzten zwei Jahrzehnten abgekühlt haben, waren die Beziehungen der Republik Zypern zu den USA stets eher distanziert (Laipson 1992). Obwohl Washington und Nikosia sich der gleichen Wertegemeinschaft verpflichtet fühlen, hat Zypern immer einen eigenen Weg in der Sicherheitspolitik eingeschlagen und der NATO nicht beigetreten (Kadritzke und Wagner 1976). Nikosia fühlte sich von den USA nicht ausreichend unterstützt, wenn es um die „nationale Frage“, d. h. die Teilung der Insel und die Ablehnung türkischer Ansprüche gegenüber den griechischen Zyprioten, ging. Im Streit um die Energieressourcen im östlichen Mittelmeer sucht Zypern weniger Unterstützung von den USA als von den südlichen Anrainerstaaten des östlichen Mittelmeers (Israel und Ägypten), ähnlich wie Griechenland. Die Republik Zypern und Russland unterhalten politische und finanzielle Verbindungen, aber das zyprische Parlament verabschiedete einstimmig eine Resolution, die die russische Invasion in der Ukraine verurteilte. Dass russische Touristen die zweitgrößte Gruppe der Touristen in Zypern ausmachen und die Insel den Ruf eines Zufluchtsorts für russisches Geld hat, stand dieser Haltung nicht im Weg. Lange Zeit galt Zypern als das „einmal hochgepriesene ‚Offshore-Tor‘ für die russische Oberschicht“ (Adkisson 2013). In der Vergangenheit gab es wiederholt Zweifel daran, ob Zypern Russland nicht zu nachsichtig gegenüberstand. Dies war der Fall, als Zypern sich 2014 von den EU-Sanktionen gegen Russland in Bezug auf die Annexion der Krim distanzierte und als 2015 bekannt wurde, dass Zypern seine Häfen für russische Kriegsschiffe öffnen wollte (Axt 2015a).
Was die Beziehungen Russlands zu den Mittelmeerstaaten betrifft, so kann festgehalten werden, dass sich sowohl die Türkei als auch Griechenland als NATO-Mitglieder während des Kalten Krieges von der Sowjetunion distanzierten. Diese Haltung wurde nach 1989/90 zumindest teilweise auch gegenüber Russland beibehalten. Allerdings hinderten diese Differenzen nicht daran, dass Politiker der politischen Linken in Griechenland Vorteile in einer Annäherung an Moskau sahen, und in einigen Fällen auch heute noch sehen, und dass die Türkei versuchte, die NATO auszuspielen, indem sie sich von 1964 bis 1979 Russland annäherte (Axt 2015b; Steinbach 1979, 98–196). Unbestreitbar erhöhte sich die Abhängigkeit der Türkei von Russland durch ihre Entwicklung zu einem Energie-Drehkreuz, vor allem im Transport von russischem Gas, und Ankara förderte diese Entwicklung durch den Kauf russischer Militärtechnologie. Man kann auch von einer konfliktbeladenen türkisch-russischen Zusammenarbeit in Syrien sprechen. Was die Abhängigkeit vom russischen Gas für den Transport betrifft, würde diese nur verringert, wenn die Türkei erheblichen Zugang zu eigenen Energiequellen im östlichen Mittelmeer gewinnen könnte und somit russisches Gas durch eigenes Gas ersetzen könnte. Soweit bekannt, erscheint dies jedoch kaum als realistische Perspektive (Schenk et al. 2010). Es ist wahr, dass auch Russland gewissermaßen von Ankara abhängig ist, da die Türkei als Korridor für den Gastransport nach Europa benötigt wird. Griechenland kauft zwar auch Erdgas aus Russland, agiert jedoch nicht als Energie-Drehkreuz, was einerseits zu einem Verlust von Einnahmen führt, andererseits aber die Abhängigkeit verringert. Obwohl Griechenlands Beziehungen zu den USA in der Vergangenheit abgekühlt sind, widerstand Athen der Versuchung, sich mehr Unterstützung von Washington zu sichern, indem es sich Russland näherte. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat diese Haltung gefestigt. Griechenland intensiviert derzeit seine sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit den USA. Im Mai 2022 ratifizierte Griechenland ein neues Abkommen zur gegenseitigen Verteidigungskooperation (MDCA) mit den USA. Der Hafen von Alexandroupolis spielt eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung von US-Waffenlieferungen an die Ukraine. Darüber hinaus liefert die USA moderne Kampfjets an Griechenland (Michalopoulos 2022).
Da China sich politisch oder sogar sicherheitspolitisch im östlichen Mittelmeer zurückhält und sich auf wirtschaftliche Aspekte konzentriert, könnte man annehmen, dass sich eine Beziehung der Interdependenz zwischen China und den Mittelmeerstaaten entwickelt hat. Doch das würde der Realität kaum gerecht werden. Zwar bietet die wirtschaftliche Zusammenarbeit gegenseitige Vorteile, aber chinesische Investitionen in oft kritische Infrastruktursektoren vieler Mittelmeerstaaten sind zu bedeutend, um von einer reinen Geberabhängigkeit zu sprechen. Diese Abhängigkeit wird jedoch durch die Tatsache gemildert, dass China derzeit der Versuchung widersteht, Abhängigkeitsverhältnisse über die wirtschaftliche Dimension hinaus auszubauen. Die Zukunft wird zeigen, ob dies auch langfristig der Fall bleibt. Dass finanzielle Abhängigkeit kritisch sein könnte, wird in den Empfängerländern chinesischer Investitionen weniger oft gehört, doch führende NATO-Vertreter wie der Generalsekretär Jens Stoltenberg betonen den Aspekt des Systemwettbewerbs, wenn Chinas Investitionen in kritische Infrastruktur als besorgniserregend erklärt werden. Stoltenberg sagte am 30. November 2021:
„Aber gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass China in vielerlei Hinsicht weit entfernt ist, aber China für unsere Sicherheit wichtig ist […]. Sie investieren massiv in unsere kritische Infrastruktur, um in unsere Gesellschaften einzugreifen. Und sie nutzen unsere Abhängigkeit von essentiellen Lieferungen, um ihre eigenen Interessen zu fördern.“ (Rede des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg, 2021)
Das im Juni 2022 verabschiedete Strategische Konzept der NATO hat die kritische Haltung gegenüber China bekräftigt (NATO Strategisches Konzept 2022, 5). Der weltweite Anstieg der Zinssätze, der massive Anstieg der Energiepreise und das schwächere Wachstum erschweren es bereits vielen Entwicklungsländern, die aufgenommenen Kredite von China zu bedienen. Sollte der Ruf nach einer Schuldenreduzierung lauter werden, könnte dies schwerwiegende Konsequenzen für das gesamte internationale Finanzsystem haben (Horn, Reinhart und Trebesch 2022). Die wirtschaftliche Zusammenarbeit kann die Konkurrenz zwischen den westlichen Systemen und dem chinesischen Modell nicht ignorieren. Dass China den russischen Krieg gegen die Ukraine nicht eindeutig kritisierte und eine entsprechende Verurteilung Russlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit seinem Veto verhinderte, zeigt die Annäherung der beiden autoritären Mächte. Der chinesische Vertreter enthielt sich in der Abstimmung in der UN-Generalversammlung. China hat die Erzählung Moskaus übernommen, dass die Ursache des Krieges die NATO-Osterweiterung sei, und will die strategische Partnerschaft mit Russland aufrechterhalten und den Folgeschaden des russischen Krieges für die Wirtschaftsbeziehungen mit Europa begrenzen. 2021 belief sich Chinas Export an Russland auf 59,5 Milliarden US$, an die USA auf 521 Milliarden US$ und an Deutschland auf 103 Milliarden US$ (Workman 2022). Es ist nicht im Interesse Chinas, sich langfristig mit Russland gegen den Westen zu konfrontieren. Andererseits wird der russische Präsident immer mehr zum Juniorpartner Chinas, je mehr er auf dessen Unterstützung angewiesen ist.
Im Fall der EU kann davon ausgegangen werden, dass viele Staaten im östlichen Mittelmeer in einer Abhängigkeitsbeziehung stehen. Der Zugang zum EU-Markt ist für sie von grundlegender Bedeutung. Dies gilt auch für die verschiedenen Unterstützungsmassnahmen, die von der EU angeboten werden: im Fall von Mitgliedstaaten beispielsweise in Form von Agrar- und Strukturpolitik-Transfers, und im Fall von Nicht-Mitgliedstaaten durch Sonderprogramme (Europäische Kommission 2021). Immer wieder jedoch bricht diese Abhängigkeit auf. Während der Schuldenkrise erhielt Griechenland auch finanzielle Hilfe von der Eurozone, weil die Währungsunion selbst in Gefahr war, wenn die griechische Schuldenlast nicht verringert werden konnte. Auch wenn Demonstranten in Athen das Gefühl hatten, von Brüssel und vor allem von Deutschland „Befehle“ zu erhalten, lässt sich die Interdependenz kaum leugnen. Und im Fall von Nicht-EU-Mitgliedern wie der Türkei hat die Massenmigration gezeigt, dass deren Bewältigung ohne Ankara kaum möglich ist. 2016 schlossen der Europäische Rat und die Türkei ein Abkommen, das darauf abzielte, den Fluss irregulärer Migration über die Türkei nach Europa zu stoppen. Laut der EU-Türkei-Erklärung sollten alle neuen irregulären Migranten und Asylbewerber, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln kamen und deren Asylanträge für unzulässig erklärt wurden, in die Türkei zurückgeführt werden (Corrao 2022). Die Rückübernahmevereinbarung zwischen der EU und der Türkei belegt interdependente Elemente.
Wird diese Interdependenz zunehmen, wenn die Erdgasproduktion im östlichen Mittelmeer Fortschritte macht und Europa von diesen Ressourcen abhängig wird? Angesichts des bisher Bekannten ist Skepsis bezüglich der tatsächlichen (!) Vermarktungsmöglichkeiten der Ressourcen gerechtfertigt. Die EU ist sich bewusst, dass Konflikte in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft auch ihre eigene Stabilität und Sicherheit bedrohen. Aus diesem Grund wurden verschiedene Nachbarschaftsinitiativen ins Leben gerufen; grundsätzlich wird dabei der Ansatz kopiert, dass Integration Gleichgewicht und Stabilität fördert, wie es seit den frühen 1950er Jahren in Westeuropa der Fall war (Europäische Kommission 2022). Inzwischen muss jedoch eingestanden werden, dass das Kopieren der westeuropäischen Integration im Fall der Mittelmeerländer wenig positiven Effekt hatte. Was die Konflikte im östlichen Mittelmeer betrifft, so fordern einzelne EU-Staaten wie Frankreich, Italien oder Spanien eine entschlossenere EU-Position zugunsten der betroffenen EU-Mitglieder, aber bislang konnte keine Einigung erzielt werden. Vielleicht ist dies ein Hinweis darauf, dass der Mittelmeerraum in sicherheitspolitischer Hinsicht keine Priorität hat (Lippert 2021).
Eine vorsichtige Schlussfolgerung lässt sich ziehen: Die Region ist von den globalen Mächten abhängig, aber durch zwei Faktoren begrenzt: Erstens gleichen die Interessen der globalen Mächte einander aus, sodass einzelne Mächte keinen dominanten Einfluss ausüben können. Zweitens ist die Region zwar für die globalen Mächte wichtig, jedoch nicht in dem Maße, dass sie bereit wären, dort in Konflikt mit anderen globalen Mächten zu treten. China expandiert seinen Einfluss, indem es Angebote macht, die kaum abgelehnt werden können. Russland befindet sich in der Position des aufmerksamen Beobachters, dessen Hauptsorge darin besteht, den Einfluss des Westens einzudämmen. Obwohl die Vereinigten Staaten dem wachsenden Einfluss von China und Russland entgegentreten, sehen sie kaum die Notwendigkeit oder Möglichkeit, diesen Einfluss im östlichen Mittelmeer abzulehnen. Im Fall von China konzentrieren sich die USA auf die Pazifikregion, und im Fall von Russland sehen die USA viele andere Konfliktquellen, etwa im Nahen Osten, im Schwarzmeerraum, in Südosteuropa oder im Baltikum, wo der „Russische Bär“ seine Ansprüche geltend macht. Das östliche Mittelmeer steht daher nicht weit oben auf der Agenda der USA, um die Ambitionen Russlands einzudämmen. Die USA arbeiten jedoch daran, Russland und China daran zu hindern, das regionale Gleichgewicht im Mittelmeer zu ihren Gunsten zu verschieben, wie Mehmet Yegin in seinem Beitrag hervorhebt. Damit bleibt die EU. Während die EU erkennt, dass sie sich nicht nur auf „weiche Macht“ beschränken kann, sind die Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten an den Mittelmeerländern zu komplex, sodass die EU in ihrer Herangehensweise an das Konfliktmanagement nicht durchsetzungsfähig ist. Dass Staaten wie die Türkei die EU als voreingenommen wahrnehmen, weil Griechenland und Zypern Mitglieder der EU sind und damit gewissermaßen automatisch Solidarität von der EU erhalten, erschwert es der EU natürlich, die Rolle eines unparteiischen Vermittlers zu übernehmen. Doch dies erklärt nicht hinreichend die beobachtete Passivität der EU. Es ist die Heterogenität der Interessen der Mitgliedstaaten, die eine zentrale Rolle spielt.
Je mehr sich die USA auf China konzentrieren, desto mehr schafft dies eine neue Situation in Europa: Es ist nicht auszuschließen, dass dies Russland dazu ermutigt hat, zumindest eine teilweise Umstrukturierung der politischen Architektur Europas herbeizuführen. Inwieweit die Staaten der EU in einer solchen Situation in der Lage sein werden, die Ambitionen Russlands zurückzuweisen, hängt vor allem von der Fähigkeit der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU ab. Die EU, die lange Zeit verkündet hat, sie wolle ein globaler Akteur sein, wird ihre Ankündigungen mit Taten untermauern müssen. Dies wird auch die innenpolitisch heikle Frage betreffen, welche Rolle das nukleare Potenzial von Frankreich sowie das von Großbritannien spielen sollte, wenn der nukleare Schutzschirm der USA zurückgezogen wird. In der neuen Sicherheitsstrategie, die die Version von 2016 ersetzen soll, wird die EU solche Fragen beantworten müssen. Dass das strategische Konzept von 2016 nicht mehr dienlich ist, zeigt sich daran, dass 2016 erklärt wurde, „die EU und Russland sind interdependent“ (Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe 2016, 33). In Fragen der Sicherheit wird die EU sich mit der unmittelbaren Nachbarschaft im Kontext der weltpolitischen Machtkonstellation befassen müssen, deren Quadrangle durch die Pole USA, Russland, China und die EU definiert ist. Die EU wird eine Chance haben, ihren Willen zu engerer Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit zu erfüllen – was mit Russlands Krieg gegen die Ukraine bekräftigt wurde – nur, wenn die Bedingungen dafür in den Mitgliedstaaten nachhaltig geschaffen werden. Dann wird die russische Wahrnehmung, dass die EU aufgrund ihrer divergierenden Interessen kein ernstzunehmender Akteur ist, beseitigt werden.
Was für Europa gilt, gilt natürlich auch für die Region des östlichen Mittelmeers. Hier hat der bereits eingeleitete Rückzug der USA ein Vakuum geschaffen, das es Russland und China ermöglichen wird, mehr Einfluss zu gewinnen. Russland hält sich noch zurück und „beobachtet“ die Situation eher, wie Zaur Gasimov in seinem Beitrag anmerkt. China konzentriert sich mehr auf Investitionen und Handel, was zwar seine Grenzen in der begrenzten Öffnung des Marktes in China findet. Auch wenn Jens Bastian in seiner Analyse eher beruhigend ist und argumentiert, dass China sich in erster Linie auf wirtschaftliche Ziele konzentriert, bleibt die Frage, inwieweit chinesische Investitionen und die daraus resultierende Verschuldung der Mittelmeerländer China in Zukunft mehr Möglichkeiten für politischen Einfluss verschaffen werden. Was die Energiereserven im östlichen Mittelmeer betrifft, sind die Wünsche von China und Russland begrenzt. Russland möchte den Wettbewerb von Mittelmeerländern als Energieanbieter eindämmen, aber Russland und China wissen auch, dass die Ausbeutbarkeit der Energiequellen im östlichen Mittelmeer bis jetzt begrenzt ist. Doch wie bereits mehrfach erwähnt, hat Russlands Krieg gegen die Ukraine die Karten neu gemischt und vor allem die Einheit des Westens gestärkt und die Reihen geschlossen.
Über den Autor:
Heinz-Jürgen Axt
Heinz-Jürgen Axt, Gasteditor des thematischen Abschnitts in dieser Ausgabe, ist emeritierter Professor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen und Gastprofessor am Europäischen Institut für fortgeschrittenes Verhaltensmanagement der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Er war Vizepräsident der Vereinigung Südosteuropa, München. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die europäische Integration, die EU-Erweiterung, die EU-Strukturforschungspolitik, Südosteuropa, Griechenland, die Türkei und Zypern. Seine Arbeiten zu diesen Themen wurden vielfach veröffentlicht.
Quellenangaben:
Axt, H.-J. 1993. “Auf dem Weg zur kollektiven Sicherheit? Die KSZE nach Erweiterung und Institutionalisierung.” Europäische Rundschau 21 (1): 83–99. Search in Google Scholar
Axt, H.-J. 2012. “Zypern.” In Jahrbuch der europäischen Integration, edited by W. Weidenfeld and W. Wessels, 509–10. Baden-Baden: Nomos.10.5771/9783845245027-509. Search in Google Scholar
Axt, H.-J. 2015a. “Zypern.” In Jahrbuch der europäischen Integration, edited by W. Weidenfeld and W. Wessels, 527–8. Baden-Baden: Nomos.10.5771/9783845260549_527. Search in Google Scholar
Axt, H.-J. 2015b. “Regierung Tsipras fordert Gläubiger heraus. Verhandlungen im Zeichen akuter Finanznot Griechenlands.” Südosteuropa-Mitteilungen 55 (2): 20–35. Search in Google Scholar
Axt, H.-J. 2021. “Troubled Water in the Eastern Mediterranean. Turkey Challenges Greece and Cyprus Regarding Energy Resources.” Comparative Southeast European Studies 69 (1): 133–52.10.1515/soeu-2021-2006. Search in Google Scholar
Axt, H.-J. 2022. “Neuer Kalter Krieg. Oder: Warum fürchtet Putin die EU mehr als die NATO.” Südosteuropa-Mitteilungen (62) 2: 33–42. Search in Google Scholar
Axt, H.-J., O. Schwarz, and S. Wiegand. 2008. Konfliktbeilegung durch Europäisierung? Zypernfrage, Ägäis-Konflikt und griechisch-mazedonischer Namensstreit. Baden-Baden: Nomos.10.5771/9783845209678. Search in Google Scholar
Bardakçı, M. 2021. “Is a Strategic Partnership Between Turkey and Russia Feasible at the Expense of Turkey’s Relations with the EU and NATO?” Comparative Southeast European Studies 69 (4): 535–59.10.1515/soeu-2021-0001. Search in Google Scholar
Clausewitz, C. von. 1968. On War. London: Penguin Books. Search in Google Scholar
Corrao, I. 2022. “EU–Turkey Statement & Action Plan.” European Parliament. 23 June. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-action-plan (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Couloumbis, T. A., and J. O. Iatridis, eds. 1980. Greek–American Relations: A Critical Review. New York: Pella Publishers. Search in Google Scholar
Ellinas, C. 2020. “Changing Priorities Threatens Viability of EastMed Gas Pipeline.” Cyprus Mail. 6 January. https://cyprus-mail.com/2020/01/06/changing-priorities-threatens-viability-of-eastmed-gas-pipeline/ (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Erler, G. 2018. Weltordnung ohne den Westen. Freiburg im Breisgau: Herder. Search in Google Scholar
European Commission. 2021. “Southern Neighbourhood: EU Proposes New Agenda for the Mediterranean.” 9 February. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_426 (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
European Commission. 2022. “Southern Neighbourhood.” https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/southern-neighbourhood_en (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Adkisson, J. 2013. “Cyprus And The Death Of An Offshore Haven.” Forbes. 25 March. http://www.forbes.com/sites/jayadkisson/2013/03/25/cyprus-and-the-death-of-an-offshore-haven/ (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Bomberg, E., J. Peterson, and A. Stubb. 2008. The European Union: How Does It Work? New York: Oxford University Press. Search in Google Scholar
Haas, E. B. 1968. The Uniting of Europe. Stanford: Stanford University Press. Search in Google Scholar
Haas, E. B. 1975. The Obsolescence of Regional Integration Theory. Berkeley: University of California. Search in Google Scholar
Horn, S., C. M. Reinhart, and C. Trebesch. 2022. “Hidden Defaults.” Kiel Working Paper, No. 2208. January. https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/-ifw/Kiel_Working_Paper/2022/KWP_2208_Hidden_Defaults/KWP_2208.pdf (accessed 10 August 2022).
10.1596/1813-9450-9925. Search in Google Scholar
Kadritzke, N., and W. Wagner. 1976. Im Fadenkreuz der NATO: Ermittlungen am Beispiel Cypern. Berlin: Rotbuch. Search in Google Scholar
Kant, I. 2003. To Perpetual Peace. Indianapolis: Hacket. Search in Google Scholar
Kegley, C. W., and E. R. Wittkopf. 2000. World Politics: Trend and Transformation. New York: St. Martin’s Press. Search in Google Scholar
Keohane, R. O., and J. S. Nye. 1977. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston: Little, Brown. Search in Google Scholar
Kotkamp, L. 2022. “The Netherlands’ Earthshaking Gas Deal with Germany 2022.” Politico. 27 January. https://www.politico.eu/article/the-netherlands-earthshaking-gas-deal-with-germany/ (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Laipson, E. 1992. “The United States and Cyprus: Past Policies, Current Concerns.” In Cyprus: A Regional Conflict and its Resolution, edited by N. Salem, 90–9. New York: St. Martin’s Press.
10.1007/978-1-349-12781-8_7 Search in Google Scholar
Lippert, B. 2021. “Europäische Nachbarschaftspolitik.” In Jahrbuch der Europäischen Integration, edited by W. Weidenfeld and W. Wessels, 379–88. Baden-Baden: Nomos.
10.5771/9783748912668-379 Search in Google Scholar
Malsin, J. 2022. “Turkey Offers Again to Host Russian-Ukrainian Peace Talks.” The Wall Street Journal. 30 May. https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-28/card/turkey-offers-again-to-host-russian-ukrainian-peace-talks-7ZiiQCjHKjuNs8vJhxSm (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Mearsheimer, J. J. 2014. “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin.” Foreign Affairs (93) 5: 77–84. Search in Google Scholar
Mearsheimer, J. J. 2022. “John Mearsheimer on Why the West is Principally Responsible for the Ukrainian Crisis.” The Economist. 19 March. https://www.economist.com/by-invitation/2022/03/11/john-mearsheimer-on-why-the-west-is-principally-responsible-for-the-ukrainian-crisis (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
“Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Turkey and the Government of National Accord-State of Libya on Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas in the Mediterranean 2019.” United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/Turkey_11122019_%28HC%29_MoU_Libya-Delimitation-areas-Mediterranean.pdf (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Michalopoulos, S. 2022. “Greece Ratifies Defence Deal with US.” Euractiv. 12 May. https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/greece-ratifies-defence-deal-with-us/ (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Morgenthau, H. W. 1954. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Knopf. Search in Google Scholar
North Atlantic Treaty Organization. “NATO Strategic Concept 2022.” Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Madrid 29 June 2022. E-Library. Official Texts. Press Release 095. 29 June. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
North Atlantic Treaty Organization. “Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg.” 2021. “Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Event: NATO’s Outlook Towards 2030 and Beyond.” Newsroom. Speeches and Transcripts. 30 November. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_189089.htm (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
“Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022.” 2022. Die Bundesregierung (website of the German federal government). 27 February. https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-scholz-am-27-februar-2022-2008356 (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Schenk, C. J., M. A. Kirschbaum, R. R. Charpentier, T. R. Klett, M. E. Brownfield, J. K. Pitman, T. A. Cook, and M. E. Tennyson. 2010. “Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean.” U.S. Geological Survey Fact Sheet 2010–3014. 12 March. https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/ (assessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Seufert, G. 2022. “Erdoğan’s Tightrope Act: In the Conflict on Ukraine, Turkey is Moving Cautiously Toward the West.” Stiftung Wissenschaft und Politik. 9 March. https://www.swp-berlin.org/publikation/erdogans-tightrope-act-in-the-conflict-on-ukraine-turkey-is-moving-cautiously-toward-the-west (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
“Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy 2016.” European Union Global Strategy. European External Action Service. June. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Siousiouras, P., and G. Chrysochou. 2014. “The Aegean Dispute in the Context of Contemporary Judicial Decisions on Maritime Delimitation.” Laws 3 (1) 12–49, https://www.mdpi.com/2075-471X/3/1/12 (accessed 10 August 2022).
10.3390/laws3010012
Search in Google Scholar
Steinbach, U. 1979. Kranker Wächter am Bosporus. Freiburg: Ploetz. Search in Google Scholar
Tol, G., and Ö. Taşpınar. 2019. “Turkey’s Russian Roulette.” In The Mena Region. A Great Power Competition, edited by K. Mezran and A. Varvelli, 107–25. Milano: Le edizioni. Search in Google Scholar
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (accessed 10 August 2022).
10.18356/22186018-2022-108-1
Search in Google Scholar
Velickovic, E.-M. 2009. Der institutionelle Wandel der KSZE/OSZE nach dem Ende des Ost-West-Konflikts. Münster: Lit. Search in Google Scholar
Winkler, H. A. 2015. Geschichte des Westens. Munich: C. H. Beck.
10.17104/9783406669873
Search in Google Scholar
Workman, D. 2022. “China’s Top Trading Partners.” World’s Top Exports. https://www.worldstopexports.com/chinas-top-import-partners/ (accessed 10 August 2022). Search in Google Scholar
Online veröffentlicht: 11. Oktober 2022
In gedruckter Form veröffentlicht: 27. September 2022