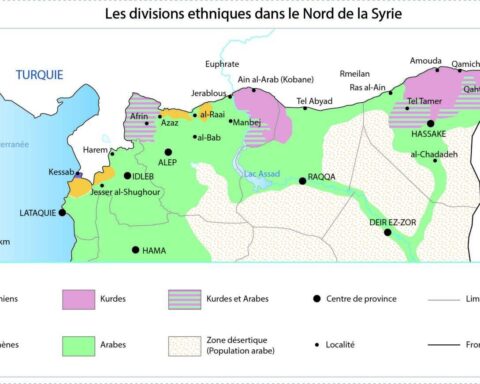Gleich zu Beginn möchte ich eines klarstellen, damit aus meinem einleitenden Satz keine falschen Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf des Textes gezogen werden:
Auch wenn ich im Folgenden betone, dass in der aktuell vereinbarten 90-tägigen Phase zwischen China und den USA derzeit eindeutig die USA im Vorteil ist, sehe ich den Ausgang dieses geopolitischen Spiels auf lange Sicht ganz anders.
Ich gehöre zu denen, die – ganz im Sinne der berühmten Thukydides-Falle – überzeugt sind, dass der wirtschaftliche wie auch möglicherweise militärische Konflikt zwischen zwei aufstrebenden Großmächten, wann auch immer er enden mag, letztlich mit einem Sieg Chinas ausgehen wird. Ja, ich halte einen heißen Krieg zwischen beiden Mächten eines Tages für unausweichlich.
Der Punkt, an dem ich mich jedoch von jenen unterscheide, die glauben, China werde kurzfristig die globale Vorherrschaft erringen, ist mein düsterer Ausblick: Ich befürchte, dass der neue Hegemon den alten vermissen lassen wird – und dass die Welt in eine Krise stürzen könnte, wie wir sie zuletzt allenfalls zu Zeiten der Mongoleninvasionen erlebt haben.
Trotz allem muss man in Bezug auf den aktuellen Prozess festhalten: Die USA ist kein leichter Gegner. Sie verfügt nach wie vor über technologische und kulturelle Überlegenheit. Auch wenn China eines Tages die „stärkste“ Macht der Welt werden mag, ist es doch ein langer Weg, bis es wie die USA von der Mehrheit der Welt als Führungsmacht akzeptiert wird. Und genau hier liegt ein entscheidender Unterschied: Es ist etwas ganz anderes, die stärkste zu sein – oder die führende Nation der Welt.
Ja, die USA steckt in Schwierigkeiten – das stimmt.
Aber dieses Spiel wird auf dem asiatischen Rasen von tonnenschweren Elefanten gespielt. Ein Spiel in der eigenen Region, auf dem eigenen Kontinent, zu akzeptieren, ist äußerst schwierig. Auch wenn beide Weltkriege in Europa ausbrachen, litten am Ende die Asiaten am meisten. Und wie sie litten!
China – aufgrund seiner Rolle als „Fabrik der Welt“ existenziell abhängig von Energieimporten – importiert heute mit Angst und Zittern seine Energie durch die Straße von Malakka, die durch eine US-indisch dominierte Blockade gefährdet ist. Seit Jahren kämpft China deshalb in Pakistan, um sich dort einen eigenen Zugang zum Meer zu sichern – im Wettstreit mit den USA.
Ein solcher Zugang wäre ein magisches Tor für China zur ganzen Welt. Doch der Durchbruch will nicht gelingen. Seit dem Start der „Neuen Seidenstraße“ im Jahr 2012 und nach Investitionen in Höhe von 60 Milliarden Dollar gelang es China mit Mühe und Not, die Regierung des Nachbarlands Pakistan zu beeinflussen und sich vorerst der US-Einmischung zu entledigen. Doch nun wurde dieses mühsam befreite Land durch seinen endlosen Blutkonflikt mit Indien direkt wieder in den geopolitischen Ring gezerrt.
Zwar mögen manche einwenden: „China hat immerhin Russland an seiner Seite – das gleicht zumindest einige Bedingungen aus.“ Aber selbst dem ist nicht vorbehaltlos zuzustimmen.
Zwar haben die beiden Staatschefs insgesamt 40 Mal miteinander gesprochen, davon elf Mal unter vier Augen, und schicken sich gegenseitig zum Geburtstag Eiscreme – die Handelsbeziehungen haben 200 Milliarden Dollar überschritten. Doch eines ist sicher: Die Russen werden niemals bis zur letzten Minute echte Verbündete der Chinesen sein. Die Katze weiß am Ende immer, dass der Tiger sie fressen könnte.
Russland, durch den Ukraine-Krieg in seiner Schwäche entblößt, verfügt zwar über riesige, nahezu menschenleere Flächen und enorme Rohstoffreserven, die China in eine neue Ära katapultieren könnten – doch es fehlt ihm an Kraft, sie zu verteidigen. In diesem Zustand möchte Russland unter keinen Umständen in seiner eigenen Geografie allein mit China zurückbleiben. Sein Ziel inmitten dieses gewaltigen geopolitischen Kampfes ist es vielmehr, das altersschwache, von Fremden durchdrungene und machtlose Europa zu zerschlagen – oder zumindest Zeit zu gewinnen, um an allen Fronten gleichzeitig Kräfte zu sammeln.
Die Amerikaner wissen das natürlich. Und sie versuchen heute das, was sie schon einmal erfolgreich getan haben. Damals verhinderten sie mit den teuflischen Plänen eines Henry Kissinger ein Bündnis zwischen China und der Sowjetunion. Heute drehen sie das Spiel um – diesmal wollen sie Russland von China lösen. Doch das damalige Amerika war dem heutigen an Macht und Einfluss um ein Vielfaches überlegen. Ob das heute noch gelingt, ist fraglich. Trump jedenfalls versucht, was er kann.
Doch lassen wir an dieser Stelle die langen geopolitischen Rechenspiele hinter uns und richten den Fokus meines Textes nun auf die Köpfe hinter dem Krieg – auf die eigentlichen Strategen.
Wie Sie sich erinnern, hatte ich in einer unserer letzten Ausgaben bereits ausführlich über den gewieften ökonomischen General der USA in diesem globalen Krieg geschrieben: über Bessent – einen der wichtigsten Strippenzieher hinter Trumps Theaterinszenierung.
Heute möchte ich dagegen all jenen, deren Herz und Verstand eher auf der Seite Chinas stehen – oder die zumindest daran interessiert sind, in diesem weltgeschichtlichen Ringen der beiden Supermächte den strategischen Kopf hinter Chinas Zügen kennenzulernen –, die Figur auf der anderen Seite des Schachbretts vorstellen: den „geduldigen Adler“ HE LIFENG.
Fangen wir an.
Manche Menschen betreten die Bühne der Geschichte nicht plötzlich. Sie erscheinen erst nach Jahren unsichtbarer Arbeit, geduldiger Vorbereitung und strategischer Loyalität – genau dann, wenn das System eine solche Figur dringend benötigt. Die Geschichte von He Lifeng ist genau das Porträt eines solchen Profils.
Als er 2023 zum Vizepremier Chinas aufstieg, war er schon längst zu einer der zentralen Figuren nicht nur in der chinesischen Innenpolitik, sondern auch auf der globalen wirtschaftlichen Bühne geworden. Ihn lediglich als einen weiteren aufgestiegenen Technokraten zu betrachten, hieße, das große Ganze zu verkennen. Denn der Aufstieg von He Lifeng ist zugleich Ausdruck eines tiefergehenden Wandels: des chinesischen Versuchs, die Rolle des Staates in seiner wirtschaftlichen Entwicklung neu zu definieren.