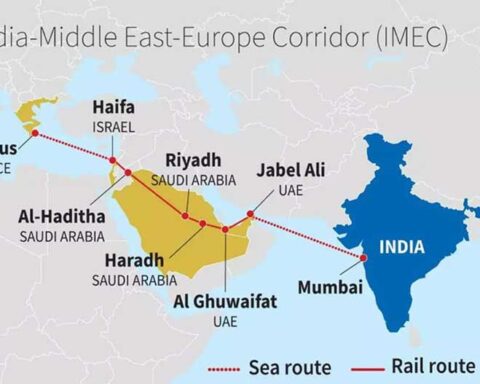Die Entstehung einer unipolaren Weltordnung nach dem Kalten Krieg, die ab den frühen 2000er Jahren von einigen als „Schurken-Supermacht“-Ära bezeichnet wurde, war geprägt von den unilateralen militärischen Interventionen der USA und der Erosion des internationalen Rechts. In diesem Zeitraum versuchten die USA, basierend auf ihrer militärischen Kapazität, technologischen und wirtschaftlichen Überlegenheit sowie ihrer entscheidenden Rolle in internationalen Institutionen, unilateral eine neue Ordnung auf globaler Ebene zu schaffen. Der Beginn dieses Prozesses war die Invasion Afghanistans im Jahr 2002 und des Iraks im Jahr 2003, die durch militärische Operationen in Jemen, Pakistan und Sudan erweitert wurden, wodurch die USA ihre „Schurken-Supermacht“-Identität eindeutig unter Beweis stellten.
Während Donald Trumps zweiter Amtszeit übte die USA nicht nur durch Handelskriege rechtswidrigen Druck auf alliierte und rivalisierende Staaten aus, sondern zeigte auch klar revisionistische Tendenzen durch ihre Politik der Annexion von Kanada, Grönland und Panama. Die bedingungslose Unterstützung der israelischen Völkermordpolitik, die jüngst ausgeweiteten direkten militärischen Angriffe auf den Jemen und die ständige Aufrechterhaltung der Option einer militärischen Intervention im Iran verstärkten den Status der USA als „Schurken-Supermacht“, die systematisch internationales Recht missachtet und zur globalen Instabilität beiträgt.
Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, die strukturellen, strategischen und ideologischen Dynamiken zu analysieren, die die USA in die Position der „Schurken-Supermacht“ geführt haben, und diese Position innerhalb eines konzeptionellen Rahmens zu diskutieren. Das zentrale Argument der Arbeit besagt, dass ein möglicher militärischer Eingriff der USA in den Iran nicht nur die militärischen und wirtschaftlichen Kapazitäten herausfordern würde, sondern auch die strukturelle Unmöglichkeit der Nachhaltigkeit der „Schurken-Supermacht“-Position aufzeigt. Dies würde sowohl die Legitimationskrise der USA auf internationaler Ebene vertiefen als auch das Risiko einer strategischen Überdehnung erhöhen.
Das Konzept der „Schurken-Supermacht“ und die Transformation der US-Außenpolitik
In der internationalen Beziehungen-Literatur wird der Begriff „Schurkenstaat“ verwendet, um Staaten zu bezeichnen, die internationales Recht verletzen, globale Normen herausfordern und das bestehende System bedrohen. Wenn dieser Begriff auf eine Supermacht angewendet wird, wird er zu „Schurken-Supermacht“ erweitert. Eine „Schurken-Supermacht“ bezeichnet einen Staat, der systematisch internationales Recht verletzt, internationale Normen instrumentalisiert und den Einsatz von Gewalt über die Legitimität stellt. Diese Akteure nutzen ihre militärische, wirtschaftliche und diplomatische Überlegenheit, um die globale Ordnung nach ihren eigenen Interessen zu gestalten, wodurch sie ernsthafte Legitimationskrisen und systemische Instabilität schaffen.
Im Zeitraum nach 2000 spielten drei grundlegende Dynamiken eine entscheidende Rolle bei der Transformation der USA zur „Schurken-Supermacht“:
Erstens, mit dem Ende des Kalten Krieges und der Entstehung eines unipolaren Systems erhielten die USA eine absolute Machtasymmetrie, die die Notwendigkeit für die USA verringert, an internationales Recht und Institutionen gebunden zu sein. Diese strukturelle Lücke, die nach dem Zerfall der Sowjetunion entstand, führte dazu, dass es keine Gegenkraft für die Interventionen der USA gab, was einseitige Gewaltanwendung förderte.
Zweitens, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 definierte die USA ihre Sicherheitsprioritäten radikal neu und legalisierte international rechtswidrige Strategien wie die „Doktrin der präventiven Angriffe“. Die Invasionen in Afghanistan (2002) und im Irak (2003) waren nicht nur die ersten Anwendungen dieser neuen Strategie, sondern führten auch zu erheblichen Wahrnehmungen der USA als internationalem Normverletzer. Ebenso verstärkten groß angelegte militärische Operationen im Jemen, Sudan und Pakistan diese strategische Ausrichtung.
Schließlich, die USA versuchten ihre globale Mission durch die Ideologie des „Exports von Freiheit und Demokratie“ zu legitimieren, was die hegemoniale Überlegenheit der USA auf ideologischer Ebene verstärkte. Diese Rhetorik mit der Verletzung internationalen Rechts in Einklang zu bringen, führte jedoch zu einem immer größer werdenden Widerspruch zwischen dem normativen Führungsanspruch der USA und ihren tatsächlichen Handlungen. Diese ideologische Doppelmoral wurde besonders unter der Trump-Administration durch offene revisionistische Politiken (z.B. Annexion von Kanada, Grönland und Panama) noch sichtbarer.
Die USA entwickelten sich auf Grundlage struktureller Machtüberlegenheit, strategischer Chancen und ideologischer Mission zu einer „Schurken-Supermacht“. Doch die jüngsten Veränderungen in den internationalen und regionalen Gleichgewichten verdeutlichen die Grenzen dieser Position. Insbesondere ein möglicher militärischer Eingriff der USA im Iran zeigt, dass die Kluft zwischen den militärischen Kapazitäten der USA und der Realität des internationalen Systems immer weiter wächst, wodurch die Nachhaltigkeit der „Schurken-Supermacht“-Position zunehmend fraglich wird. Ein solcher Eingriff würde nicht nur die Rechtsverletzungen der USA verstärken, sondern auch die zunehmende Isolation und den Legitimitätsverlust auf globaler Ebene vertiefen.
Der Schwächende Verteidigungsfähigkeit Irans und die Begründungen
Während Trumps zweiter Amtszeit nahmen die militärischen Druckmaßnahmen gegen den Iran im Rahmen der US-israelischen Achse merklich zu. Trump und israelische Quellen brachten kürzlich die Möglichkeit einer militärischen Operation gegen den Iran stark zur Sprache. Diese Entwicklung zeigt, dass die USA und Israel in einer Zeit zunehmender geopolitischer Spannungen in der Region bereit sind, eine aggressivere Strategie gegen den Iran zu verfolgen. Obwohl nach vielen Jahren direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran aufgenommen wurden und bedeutende Fortschritte erzielt wurden, bleibt die Option einer militärischen Operation gegen den Iran immer noch in einigen Bereichen der US-Regierung stark präsent.
Es gibt grundsätzlich drei Faktoren, die die militärische Option gegen den Iran auf dem Tisch halten:
Erstens, Iran hatte in den frühen 2000er Jahren in seiner neuen Sicherheitsdoktrin als strategische Priorität festgelegt, potenzielle Angriffe auf seine nationalen Grenzen außerhalb des Landes abzuwehren. Allerdings haben die erweiterten Angriffe Israels nach dem 7. Oktober die iranischen Stellvertreterkräfte, insbesondere in der Levante, erheblich geschwächt, was den Iran in eine verletzliche Position versetzte. Der Verlust dieser Stellvertreterkräfte, die eines der strategischen Ziele Irans darstellen, hat die Verteidigungsfähigkeit des Landes in der Region ernsthaft erschüttert und Iran anfälliger gemacht.
Zweitens, die von Iran seit den frühen 2000er Jahren verfolgte Strategie der Stellvertreterkriege und die Politik des „Schiitischen Halbmonds“ haben bei den konservativen Regimen der Region tiefes Misstrauen ausgelöst. Da diese Regime nicht über ausreichende militärische und industrielle Kapazitäten verfügen, um den Iran auszugleichen, haben sie sich entschlossen, ihre Sicherheit durch eine Annäherung an Israel zu stärken. Durch verschiedene Vereinbarungen mit Israel sind diese Regime dazu übergegangen, Israel, den größten Feind des Irans, zu einem wichtigen Bestandteil ihrer eigenen Sicherheitsstrategie zu machen. Diese Allianz hat es Israel ermöglicht, seine Bewegungsfreiheit im Golfraum und in anderen strategischen Gebieten erheblich zu erweitern.
Schließlich, mit Trumps zweiter Amtszeit ist in den USA ein Falkenflügel an die Macht gekommen. Die hochrangigen Beamten der aktuellen US-Regierung zeigen sich, ähnlich wie nach den Anschlägen vom 11. September, äußerst bereit, im gesamten Nahen Osten auf Interventionismus zurückzugreifen, gestützt auf die militärische und industrielle Kapazität der USA. Diese Haltung verdeutlicht die Bereitschaft, die militärische Überlegenheit der USA weiterhin als Instrument zu nutzen, um globale strategische Ziele zu erreichen.
Der Iran-File und die Grenzen der „Schurken-Supermacht“
Obwohl die militärische Option gegen den Iran in den USA und Israel nach wie vor stark diskutiert wird, schwächen die regionalen und globalen Dynamiken diese Option bei einer Analyse der gegenwärtigen globalen und regionalen Situation erheblich. Angesichts der regionalen und globalen Faktoren wird die Möglichkeit einer groß angelegten militärischen Operation gegen den Iran durch mehrere wesentliche Elemente ernsthaft geschwächt.
Erstens, Irans militärische Kapazitäten haben einen direkten Einfluss auf die regionalen Machtverhältnisse. Besonders die asymmetrischen Kriegführungsfähigkeiten Irans, seine Raketenkapazitäten und das strategische Netzwerk aus lokalen Stellvertreterkräften, das trotz der jüngsten Schwächung weiterhin existiert, bieten eine erhebliche Verteidigungslinie gegen eine mögliche militärische Intervention. Dies würde jede äußere Intervention erheblich komplexer und kostenintensiver machen.
Zweitens, Irans demografische Struktur trägt erheblich dazu bei, eine langwierige Kriegsführung aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Region verfügt Iran über eine große und junge Bevölkerung, was bedeutet, dass es eine weitreichende menschliche Ressource gibt, um die militärischen Kapazitäten des Landes kontinuierlich zu unterstützen. Dieser demografische Vorteil stärkt die Fähigkeit des Landes, im Falle eines militärischen Konflikts langfristig Widerstand zu leisten. Darüber hinaus wird Irans ideologischer und politischer Einfluss auf schiitische Minderheiten, die in der gesamten Region von konservativen Regimen marginalisiert wurden, die Fähigkeit des Landes, auf äußere Interventionen zu reagieren und Widerstand zu leisten, noch deutlicher machen.
Am wichtigsten ist jedoch Irans geopolitische Tiefe, die die strategische Position des Landes in der Region erheblich stärkt. Im Herzen des Nahen Ostens gelegen, hat Iran nicht nur innerhalb seiner eigenen Grenzen, sondern auch in kritischen geografischen Regionen wie dem Golf, der Levante, dem Kaukasus und Zentralasien einen großen strategischen Einfluss. Diese weite geografische Reichweite bedeutet, dass jede militärische Operation gegen Iran nicht nur auf dessen Grenzen beschränkt wäre, sondern auch die geopolitischen Dynamiken in diesen Regionen direkt beeinflussen würde. Diese Tatsache zeigt, dass eine mögliche Intervention viel komplexere und weitreichendere Auswirkungen auf andere Akteure, Allianzen und Sicherheitsstrukturen in der Region haben würde. All diese Faktoren schwächen die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Intervention gegen den Iran und erfordern zugleich die Berücksichtigung der Reaktionen globaler Mächte und regionaler Akteure auf eine solche Intervention.
Zusätzlich zu den genannten Faktoren hat die jüngste Politik der USA als „Schurken-Supermacht“ das Land in komplexe militärische Operationen in eine Position der Isolation geführt. Insbesondere die Invasionen in Afghanistan (2002) und im Irak (2003) bieten in dieser Hinsicht wichtige Lehren für die USA. Während die traditionellen Verbündeten der USA wie Deutschland und Frankreich sowie regionale Partner wie die Türkei und Saudi-Arabien den Irakkrieg und den Sturz des Saddam-Regimes vehement ablehnten, führten diese Interventionen trotz des starken Widerstandes der US-Verbündeten zu einer erheblichen internationalen Isolation der USA. Diese Ereignisse haben das Land sowohl militärisch als auch wirtschaftlich und diplomatisch vor erhebliche Herausforderungen gestellt.
Mit der Trump-Ära verschlechterten sich die Beziehungen der USA zu traditionellen Verbündeten wie Kanada und Großbritannien erheblich, und mit europäischen Ländern begann ein intensiver wirtschaftlicher Wettbewerbsprozess. Diese Entwicklungen führten dazu, dass die USA im internationalen Bereich im Vergleich zu früheren Zeiten einer deutlich stärkeren Isolation gegenüberstanden. In einem solchen politischen Umfeld würde eine intensive militärische Intervention gegen den Iran die USA nicht nur militärisch, sondern auch diplomatisch und wirtschaftlich in eine äußerst schwierige Situation bringen. Eine Intervention, die weitgehend ohne die Unterstützung von Verbündeten durchgeführt würde, könnte sowohl die operativen Fähigkeiten vor Ort als auch die globale Legitimität erheblich schwächen und die USA mit einer vielschichtigen Krise konfrontieren.
Gleichzeitig fördern die immer offensichtlicher werdenden revisionistischen Tendenzen der USA China dazu, sich im Südchinesischen Meer freier zu bewegen, und Russland dazu, in Osteuropa mehr Spielraum zu gewinnen. Die polarisierenden Politiken der USA gegenüber der internationalen Ordnung schaffen einen Raum, in dem Akteure wie China und Russland ihre historischen revisionistischen Ansprüche offener und mutiger zur Sprache bringen, was die geopolitischen Spannungen in diesen Regionen weiter anheizt. Diese Entwicklung schwächt ernsthaft die Bemühungen der USA, das globale Machtgleichgewicht zu ihren Gunsten aufrechtzuerhalten, und trägt schnell zur Formierung einer multipolaren internationalen Ordnung bei.
Die Transformation der USA zur „Schurken-Supermacht“ hat sich auf der Grundlage struktureller Machtvorteile, strategischer Chancen und ideologischer Rhetorik entwickelt, jedoch begrenzen Veränderungen in den globalen und regionalen Dynamiken ernsthaft die Nachhaltigkeit dieser Position. Eine mögliche militärische Intervention der USA im Iran würde die Kluft zwischen den aktuellen Kapazitäten der USA und den Realitäten des internationalen Systems noch deutlicher machen und neue Krisen in militärischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Bereichen aufwerfen. Darüber hinaus wird die Isolierung der USA von ihren Verbündeten und die Beschleunigung geopolitischer Manöver durch Akteure wie China und Russland die Führungsansprüche Washingtons weiter schwächen. In diesem Kontext wird die Option einer militärischen Intervention im Iran, auch wenn sie kurzfristige taktische Gewinne bringt, langfristig den Zerfall des „Schurken-Supermacht“-Status beschleunigen. Vor diesem Hintergrund werden US-amerikanische Entscheidungsträger, die sich dieses Realitätsbewusstseins bewusst sind, eine diplomatische Lösung einer umfassenden militärischen Operation gegen den Iran vorziehen.
Necmettin Acar, Dozent, Dr., Leiter der Abteilung für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen, Mardin Artuklu Universität, [email protected].