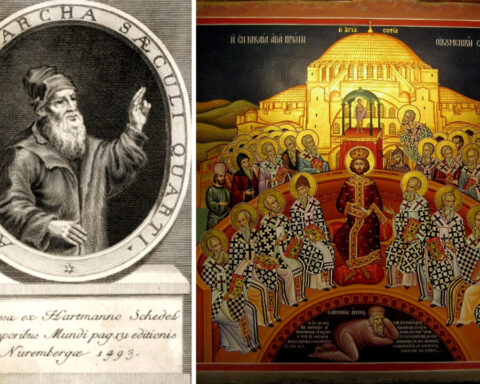Es war ein dramatisches Pontifikat – eines, das sowohl Konservative als auch Progressive enttäuschte. Von den Gläubigen geliebt, hinterließ Papst Franziskus eine tief gespaltene Kirche.
Nur wenige Wochen vor seinem Tod tat Franziskus das, was er am besten konnte: Konservative verärgern.
Mit einem außergewöhnlichen Eingreifen Mitte Februar stellte sich der Papst direkt gegen die neue US-Regierung. Er bezeichnete Präsident Donald Trumps Pläne, Millionen undokumentierter Migranten abzuschieben, als „Verletzung der Würde“ und warf Vizepräsident JD Vance vor, einen unklaren theologischen Begriff falsch zu verwenden. Washington reagierte mit vorhersehbarer Empörung – doch der Heilige Stuhl wich keinen Schritt zurück.
Es war ein typisch franziskanischer Zug: impulsiv, instinktiv schützend gegenüber den Armen und Verwundbaren – und glücklicherweise nicht überladen mit theologischen Fachausdrücken. Zugleich zeigte dieses Verhalten aber auch, wie bereit der Papst war, diplomatische Feinheiten beiseite zu lassen und in einer zunehmend zersplitterten Zeit eine konfrontative und offene Haltung einzunehmen.
Papst Franziskus starb am Ostermontag im Alter von 88 Jahren und hinterließ ein komplexes Erbe.
Er wurde 2013 zum Papst gewählt, nachdem sein Vorgänger Benedikt XVI. im Zuge des sogenannten „Vatileaks“-Skandals überraschend zurückgetreten war – mit dem Auftrag, die Kirche zu reformieren. Als erster lateinamerikanischer und erster jesuitischer Papst wählte er als Erster den Namen Franziskus – in Anlehnung an Franz von Assisi, den Anwalt der Armen im 13. Jahrhundert. Trotz seines scheinbaren Engagements für die Entrechteten und Ausgeschlossenen hinterlässt er jedoch eine Institution, die wenig unternommen hat, um mit den Skandalen um sexuellen Missbrauch und Misswirtschaft im Vatikan ernsthaft aufzuräumen.
Jorge Mario Bergoglio wurde 1936 in Buenos Aires als Sohn eines italienischen Eisenbahnarbeiters namens Mario und einer Hausfrau namens Regina geboren. Man sagt, er sei intelligent, frech und fußballbegeistert gewesen. Bevor er ein Chemiestudium begann, arbeitete er als Türsteher und Reinigungskraft in einem Nachtclub und später als Labortechniker in einem Lebensmittelbetrieb. Eine schwere Lungenentzündung im Jahr 1957 führte dazu, dass ihm ein Teil eines Lungenflügels entfernt werden musste. Kurz darauf trat er den Jesuiten bei, nachdem ihn ein inspirierender Besuch bei einem örtlichen Priester tief bewegt hatte.
Anfangs hatte Bergoglio Schwierigkeiten, seine weltlicheren Instinkte mit seiner Berufung zu vereinen – später gestand er, dass ihn eine junge Frau, die er im Priesterseminar kennengelernt hatte, „blenden“ ließ. Dennoch stieg er schnell in der argentinischen Kirche auf, erlangte den Ruf großer Großzügigkeit und erhielt den Spitznamen „Villen-Bischof“, weil er die Zahl der Priester in den armen Vierteln von Buenos Aires verdoppelte.
Doch schon damals war er eine polarisierende Figur: Während des blutigen „schmutzigen Krieges“ in den 1970er Jahren, als Bergoglio an der Spitze der mächtigen Jesuiten Argentiniens stand, wurde ihm vorgeworfen, geschwiegen zu haben – also Mittäterschaft – als zwei unter seiner Autorität stehende regimekritische Geistliche von der Armee entführt wurden. Andere hingegen behaupteten, er habe versucht, sie zu schützen.
In der Ewigen Stadt
Als Franziskus im Jahr 2001 von Papst Johannes Paul II. zum Kardinal ernannt wurde, nahm er jene heute bekannte Identität der Demut und Schlichtheit an: Er machte sich einen Namen, indem er prunkvolle kirchliche Traditionen mied, bescheiden lebte und öffentliche Verkehrsmittel benutzte. Nach dem Rücktritt Benedikts XVI. erschien er in einer nach Wandel verlangenden Kirche als Vertreter reformorientierter Ideale – und wurde zum ersten Papst außerhalb Europas seit Gregor III., einem Syrer aus dem 8. Jahrhundert.
Sein Pontifikat markierte einen klaren Bruch mit dem distanzierten, akademischen Stil Benedikts. Franziskus bemühte sich, die Kirche eher wie ein „Feldlazarett“ zu gestalten; er setzte Prioritäten bei den Armen und trat dafür ein, die Bedeutung von Sexualität in der kirchlichen Lehre zurückzustellen. 2013 antwortete er auf die Frage eines Journalisten, ob ein homosexueller Mann Priester werden könne, mit dem berühmten Satz: „Wer bin ich, um zu urteilen?“
Diese in seinem typischen, kühnen Stil formulierte Botschaft war der Auftakt zu seinem jahrelangen Versuch, die fortschrittlichen Ziele des Zweiten Vatikanischen Konzils – das die Kirche in den 1960er-Jahren mit den liberalen Umwälzungen der Zeit in Einklang bringen wollte – umzusetzen. Von Anfang an predigte Franziskus Toleranz, verteidigte Migranten und übte scharfe Kritik an den Exzessen des Kapitalismus, versuchte dabei aber stets, die Werte der wachsenden konservativen katholischen Gemeinschaften in Afrika, Asien und Lateinamerika auszubalancieren.
Zum Teil gelang es ihm, die jahrtausendealten Strukturen der Kirche aufzubrechen: Er öffnete hohe Ämter im Vatikan für Frauen und Laien.
Doch oft verärgerte sein chaotischer Reformkurs die Konservativen und enttäuschte die Liberalen. So hielt er beispielsweise an der Unzulässigkeit weiblicher Priester fest und sah sich gezwungen, ein wegweisendes Dokument zur Segnung homosexueller Paare abzuschwächen – unter dem Druck erzürnter Bischöfe aus Afrika.
Auch international war Franziskus eine polarisierende Figur. Seine dringlichen Appelle für Frieden in der Ukraine, sein Schweigen zur Unterdrückung religiöser Minderheiten in China und seine scharfe Kritik an Israels Invasion im Gazastreifen brachten ihm Bewunderung im globalen Süden ein, führten jedoch zu Kritik bei Unterstützern im Westen – ein Spiegelbild seiner komplexen Weltsicht, die im linksgerichteten Peronismus Argentiniens geprägt wurde. Auch sein Führungsstil war unberechenbar: Er sagte Pläne ab oder brach Versprechen, wenn Informationen an die Presse durchgesickert waren.
All dies trug dazu bei, dass in den USA ein zunehmend radikalisierter konservativer Flügel an Einfluss gewann.
Der inoffizielle Anführer der Opposition gegen Franziskus war der ultrakonservative Kardinal Raymond Burke. Bekannt für seine übertriebenen Gewänder, die an fiktive Bischofskostüme erinnern, behauptete Burke, die katholische Kirche sei „zu verweiblicht“ worden, und machte die Einführung von Ministrantinnen für den Priestermangel verantwortlich. Er stellte sich wiederholt gegen die angeblich „woke“ Agenda des Papstes – etwa in einer besonders bizarren Auseinandersetzung über Berichte, dass der Malteserorden Kondome nach Myanmar geliefert habe. Burkes wütende Angriffe zogen sich über Jahre hin. Er widersetzte sich Franziskus’ Bemühungen, wiederverheirateten Geschiedenen den Zugang zur Kommunion zu ermöglichen, und war empört über das Vorgehen gegen die lateinische Messe. Der Papst konterte still: Er entmachtete Burke und entzog ihm schließlich seine subventionierte Vatikan-Wohnung.
Franziskus war keineswegs schüchtern. Trotz seines offenen, zugänglichen Auftretens verfügte er über ein Talent, Rivalen gegeneinander auszuspielen und sie in unerwarteten Momenten in die Falle zu locken. Offen gesagt, genoss er es, sie zu demütigen – so sehr, dass er sogar die geistige Gesundheit seiner hochmütigen konservativen Kritiker öffentlich infrage stellte.
Gleichzeitig dienten diese konservativen Gegner, solange Benedikt noch lebte, ihm als Symbol für ihre Werte. Sie behaupteten, dass der Stuhl Petri unter Franziskus leer sei – einige nannten ihn sogar den „Antichrist“.
Diese Haltung wurde noch durch Franziskus’ eigene Fehler begünstigt. Seine Bemühungen, die vatikanischen Finanzen zu ordnen, blieben unzureichend und inkonsequent. 2017 wurde ein leitender Prüfer auf mysteriöse Weise entlassen – eine Entwicklung, die zu einem gescheiterten Immobiliengeschäft in London und zur Verurteilung und Inhaftierung des ehemaligen Kardinals Angelo Becciu führte. Während des Prozesses traf sich der Papst privat mit Becciu – was Fragen zur Unabhängigkeit der Justiz aufwarf.
Auch der Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen enge Mitarbeiter des Papstes war problematisch. Franziskus schien enge Freunde, die schwerer sexueller Übergriffe beschuldigt wurden, zu schützen – und sogar zu fördern. Dazu gehörte der Jesuitenpater und Mosaikkünstler Marko Rupnik, gegen den Vergewaltigungsvorwürfe erhoben wurden, der jedoch weiterhin vatikanische Aufträge für Mosaikarbeiten erhielt.
Widersprüchlichkeit war womöglich das Markenzeichen seiner Amtszeit. Statt einer reformierten Kirche hinterlässt Franziskus vor allem ein Chaos – und ein theologisches Minenfeld.
Da die Konservativen nun die Messer wetzen, ist klar: Der bevorstehende Machtkampf wird erbittert.
Einerseits veränderte Franziskus im Laufe der Jahre die geografische Zusammensetzung der kirchlichen Elite grundlegend: 110 der 138 Kardinäle, die seinen Nachfolger wählen werden – die meisten von ihnen stammen nicht aus Europa – wurden von ihm selbst ernannt. Doch Quellen aus Rom betonen, dass Allianzen im Vatikan selten über ein Pontifikat hinaus Bestand haben, was keine Garantie dafür ist, dass seine Vision fortgeführt wird.
Dennoch spielte sich ein Großteil des Dramas rund um sein Pontifikat innerhalb der Eliten ab: Zum Zeitpunkt seines Todes genoss Franziskus unter den 1,4 Milliarden Gläubigen weltweit Zustimmungswerte, die viele Politiker neidisch machen würden.