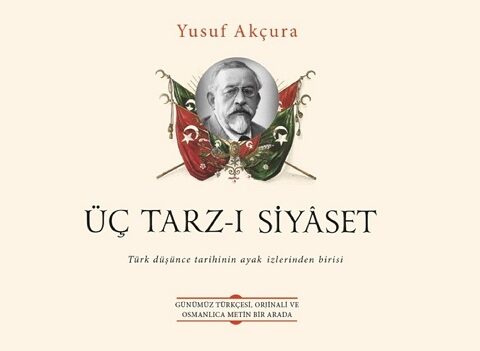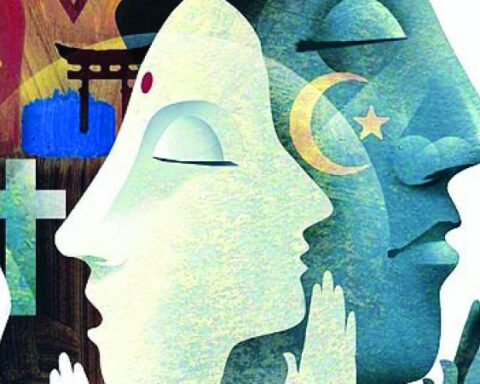Lester Thurow war in den 1990er Jahren ein ziemlich bekannter Ökonom.
Seine Bücher „Head to Head“ (auf Türkisch: Kıran Kırana) und „The Future of Capitalism“ (Kapitalizmin Geleceği) wurden ins Türkische übersetzt, und er besuchte sogar unser Land für eine Konferenz. Seine Arbeiten konzentrierten sich vor allem darauf, wie das kapitalistische Weltsystem funktioniert und wohin es sich entwickelt.
In „The Future of Capitalism“ erzählte er ein chinesisches Sprichwort, um den Zustand unserer Welt zu beschreiben:
„Wir sind wie ein Fisch, der aus dem Wasser geworfen wurde und sich verzweifelt windet, um zurückzukehren. Der Fisch fragt sich in diesem Zustand nicht, wohin ihn seine nächste Bewegung bringen wird. Er spürt nur, dass seine aktuelle Lage unerträglich ist und er etwas anderes versuchen muss …“
Thurow versuchte Überlegungen darüber anzustellen, wohin eine Welt steuert, in der die Kluft zwischen Nord und Süd sowie die Ungleichheit der Einkommen – sowohl weltweit als auch innerhalb einzelner Länder – immer größer wird.
Liberalismus und Demokratie sind nicht dasselbe
In der Türkei erkennen viele von uns, die im Bildungssystem der alten Vormundschaft erzogen wurden, kaum den grundlegenden Unterschied zwischen Liberalismus und Demokratie. Wir betrachten sie als untrennbare Konzepte. Heute sind westliche Islamophobe, die anderen Gesellschaften kaum Respekt entgegenbringen und ihnen Demokratie nicht gönnen, in einem noch schlechteren Zustand als wir – und doch konnten in akademischen Kreisen vor dreißig Jahren wenigstens noch Diskussionen darüber geführt werden, wie sich die Spannungen zwischen Liberalismus und Demokratie überwinden ließen.
Denn Liberalismus basiert auf dem Individuum, dem Unternehmertum und dem Eigennutz, während Demokratie notwendigerweise auf die Gesellschaft, Solidarität und kollektive Organisation angewiesen ist – Unterschiede, die sich bereits auf den ersten Blick erkennen lassen. Thurows Sichtweisen formten sich auf diesem Spannungsfeld zwischen Liberalismus und Demokratie.
Wer kämpft hier auf Leben und Tod?
Thurow schrieb: „Der ökonomische Wettbewerb zwischen Kommunismus und Kapitalismus ist vorbei; nun zeichnet sich ein neuer Wettstreit zwischen zwei Formen des Kapitalismus ab … Der individualistische angelsächsische Kapitalismus Großbritanniens und Amerikas wird sich dem kommunitären Kapitalismus der Deutschen und Japaner stellen müssen.“
In „Kıran Kırana“ beschrieb er ausführlich den Wirtschaftskrieg zwischen Japan, Amerika und Europa:
„Amerika und Großbritannien preisen individualistische Werte: glänzende Unternehmer, Nobelpreisträger, privilegierte Gehälter, individuelle Verantwortung, einfache Kündigungsmöglichkeiten, Gewinnmaximierung, feindliche Übernahmen. Ihre Helden sind die ‚einsamen Cowboys‘.
Demgegenüber stehen Deutschland und Japan mit ihren kommunitären Werten: Arbeitsgruppen, soziale Verantwortung, Teamarbeit, absolute Loyalität, Industriepolitik und Strategien für wirtschaftliches Wachstum. Anglo-amerikanische Unternehmen streben nach Gewinnsteigerung; japanische Firmen spielen ein Spiel, das als ‚strategischer Wettbewerb‘ bekannt ist. Amerikaner glauben an eine ‚Konsumwirtschaft‘; Japaner an eine ‚Produktionswirtschaft‘.“
Thurow war ein Befürworter des gemeinschaftsorientierten Kapitalismus in der EU und in Japan. Für ihn bedeutete jede Privatisierung zwangsläufig Arbeitslosigkeit.
Wahrer wirtschaftlicher Erfolg könne nur durch soziale Investitionen in Talent, Bildung und Wissen entstehen – also sei es entscheidend, wie man das Geld verwendet.
Freihandelszonen würden letztlich verschwinden; erfolgreiche Modelle wären solche, bei denen sich Länder gegenseitig unterstützen – wie etwa das europäische Modell, in dem mit in Brüssel gesammelten Geldern Autobahnen in Spanien gebaut werden.
Natürlich könnten wir – wenn wir die philosophische Tiefe in Thurows Überlegungen außer Acht lassen – sagen, dass die Entwicklungen der letzten 30 Jahre seine Thesen nicht bestätigt haben.
Er hat weder den Aufstieg Chinas noch die geopolitischen Schritte Russlands, die Rolle Israels als Krisenherd noch die Entwicklungen in Südostasien vorhergesehen. Und wir hätten mit dieser Kritik nicht Unrecht.
Nicht nur haben Deutschland und Japan nicht – wie Thurow hoffte – „gewonnen“, sie sind sogar dem individualistischen amerikanischen Kapitalismus gefolgt. Thurow hat sich gewaltig geirrt.
Aber ich persönlich habe Thurows Aussagen nie nur als Beschreibung eines Wettbewerbs zwischen Volkswirtschaften verstanden – er versuchte, auf eine ganz andere, tiefere Wirklichkeit hinzuweisen.
Sehen Sie, wie der große Soziologe Zygmunt Bauman die sozioökonomischen Prozesse seit dem 18. Jahrhundert beschreibt:
Nach Max Webers Analyse, der die prägenden Umwälzungen des 18. und 19. Jahrhunderts zusammenfasste, war der entscheidende Geburtsmoment des modernen Kapitalismus die Trennung des Unternehmens vom Haushalt. So begann die erste große Trennung in der Transformation zur modernen Gesellschaft. Das 19. Jahrhundert wurde zu einer Ära, in der – infolge harter Kämpfe – Gewerkschaften entstanden und der Kapitalismus mit seinem gnadenlosen Gewinnstreben, das den Arbeitern das Leben zur Hölle machte, durch Regulierungen eingeschränkt wurde. Durch den Staat und das Recht wurde Kinderarbeit verboten, die Arbeitszeit reduziert, Regelungen zu Sicherheit und Hygiene eingeführt. Man bemühte sich, die Schwachen vor den Starken zu schützen.
„Der Prozess, den wir heute durchlaufen, ist der zweite Akt der ‚großen Trennung‘,“ sagt Bauman. Das Kapital hat es geschafft, dem rechtlichen/moralischen Wächterstaat zu entfliehen – einem staatlichen Korsett, das es als einengend, schmerzhaft und lästig empfand – und sich in eine neue „neutrale Zone“ zu retten. In diesem neuen Raum – sofern überhaupt Regeln existieren – werden wirtschaftliche Aktivitäten kaum noch eingeschränkt oder reguliert.
Das neue Territorium, in das die neuen (globalen) Unternehmen ausgewandert sind, ist im Lichte der letzten zweihundert Jahre tatsächlich grenzüberschreitend.
Die Geschichte wiederholt sich – doch diesmal in viel größerem Maßstab. Und mit der Entbindung des Wirtschaftslebens von politischer und moralischer Kontrolle kehren Elend und Not mit voller Wucht zurück.
Erneut hat sich die Geschäftswelt von lokalen Bindungen befreit – diesmal nicht vom Haushalt, sondern vom Nationalstaat. Und wieder hat sie sich einen nahezu regel- und grenzenlosen Raum geschaffen, in dem sie ihre eigenen Regeln frei definieren kann. Es scheint, dass das derzeitige alte Regime – repräsentiert durch souveräne Nationalstaaten – nicht nur unfähig ist, diese von demokratischer Kontrolle befreite Geschäftswelt zu stoppen, sondern sie nicht einmal zu verlangsamen vermag.
(Aus: „Die belagerte Gesellschaft“, übers. von A. E. Pilgir, Ayrıntı Verlag, 2018)
Ausgehend von diesem Panorama denke ich, dass der von Thurow als „Kampf auf Leben und Tod“ beschriebene Konflikt in Wirklichkeit ein Kampf zwischen dem demokratischen Staat, als Vertreter kollektiver Vernunft, und den riesigen monopolistischen Konzernen ist, die den individuellen Ehrgeiz verkörpern.
Ich verstehe das von Thurow befürwortete Modell eines kommunitären Kapitalismus nicht als Eingreifen des Staates in die Produktion, sondern in die Verteilung – zur Schaffung von Gerechtigkeit und einer funktionierenden Demokratie. In einer Welt, in der Demokratie wirklich einen Wert hätte, müsste sich der Staat – ohne sich in den freien Markt einzumischen – für eine gerechte Verteilung einsetzen, um Ungerechtigkeiten zu verhindern. Doch die Monopole, die einzig an Profitsteigerung denken, würden das nicht zulassen.
Der Kampf war unvermeidlich – und er war global.
Dieser Kampf auf Leben und Tod dauert bis heute an, in neuen Formen, weltweit – und bildet den eigentlichen Hintergrund vieler regionaler oder konjunktureller Spannungen.
Aus meiner Sicht ist es inzwischen sinnvoller, diesen Konflikt nicht mehr anhand der Kapitalismusformen zu beschreiben, sondern die Kontrahenten beim Namen zu nennen: Der eigentliche Kampf tobt zwischen dem Globalismus – der den Nationalstaat in jeder politischen und wirtschaftlichen Ordnung zerschlagen will – und den Nationalstaaten selbst.
Erst als die Internationalisierung des Kapitals und die Ausbreitung des Kapitalismus auf die gesamte Welt abgeschlossen waren, wurde die Spannung zwischen dem Staatensystem und dem absoluten Machtanspruch des Finanzkapitals deutlich sichtbar.
Es wurde klar: Der „Kampf auf Leben und Tod“ findet genau zwischen diesen beiden statt…
Wenn wir diesen Konflikt nicht tiefgründig analysieren und verstehen, werden wir keine der aktuellen politischen oder sozialen Entwicklungen wirklich begreifen.
In diesem erbitterten Kampf wechseln die Kräfte – mal die eine, mal die andere Seite liegt vorn – ein endgültiger Sieger ist noch nicht absehbar.
Doch wenn unsere Analyse einen realen Kern trifft, müssen wir ein weiteres Missverständnis korrigieren, das tief in unseren Denkmustern verankert ist:
Das ist das begriffliche System der bipolaren Welt und die Rolle derjenigen Intellektuellen, die sich selbst als „Linke“ bezeichnen… Schauen wir mal genauer hin…
Während die Begriffe Imperialismus und Klassenkampf verblassen – die alten Kämpfer wechseln im Dunkeln die Seiten
Früher standen die Linken – zumindest dem Anschein nach – auf der Seite des Volkes. Was ihre Aussagen einigermaßen plausibel erscheinen ließ, war ihr Bekenntnis zu den Unterdrückten und ihre Solidarität mit dem Kampf der entrechteten Nationen gegen den Imperialismus.
Doch mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch des sozialistischen Blocks begannen – fast wie durch eine unsichtbare Kraft – die Begriffe „Imperialismus“ und „Klassenkampf“ allmählich zu verblassen.
Einst sahen sie den Staat als „Unterdrückungsinstrument der herrschenden Klassen“ und erklärten, das Ziel aller Kämpfe sei das „Absterben des Staates“.
Die Staaten bestehen weiter – aber jene Begriffe und Theorien, für die einst Tausende ihr Leben gaben, haben vor unseren Augen ihren Glanz verloren – wie Sterne, die sich zu weißen Zwergen zusammenziehen.
Nicht nur der Sozialistische Block ist zerfallen – mit der plötzlichen Ausbreitung poststrukturalistischer und postmoderner Theorien wurde endgültig verkündet, dass Karl Marx nicht nur gegen Nietzsche, sondern auch gegen Hegel verloren habe.
Während die Reichen immer reicher wurden und die Beschränkungen durch Nationalstaaten zunehmend zu umgehen suchten, wurde immer klarer, dass der Staat eher Ausdruck kollektiver Vernunft ist als bloßes Instrument der herrschenden Klasse.
Einige der einstigen Linken erkannten bewusst ihren Verlust und stellten sich – gewollt oder nicht – auf die Seite der Superreichen, angeblich weiterhin „gegen den Staat“ kämpfend, doch nicht mehr im Sinne von Klassenkampf oder Antiimperialismus.
Diejenigen, die sich für Gerechtigkeit und das Gemeinwohl einsetzten, vertraten – freilich ohne ihn zu idealisieren – den Staat als Ausdruck kollektiver Vernunft und bemühten sich um seine Demokratisierung.
Die marxistische Linke hingegen geriet – im Namen des Widerstands gegen Despotismus – mehr und mehr in die Lage, die Interessen des Finanzkapitals und der monopolistischen Bourgeoisie zu vertreten. Die Ursachen dafür liegen genau in dem Prozess, den ich hier zu beschreiben versuche.
Von Zeit zu Zeit schreibe ich Texte zur politischen Philosophie – vor allem über das Wesen des Staates und die Möglichkeiten, in einer muslimischen Gesellschaft eine starke Demokratie aufzubauen.
Ich spreche auch über das große Trauma, das die marxistische Linke zu verdrängen scheint: die psychologische Verweigerung, den Zusammenbruch des sozialistischen Blocks überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.
In einer Welt, in der die Ereignisse und Perspektiven einem rasanten Wandel unterliegen, konzentriere ich mich in letzter Zeit zunehmend darauf, diese Entwicklungen zu verstehen und existenzielle sowie spirituelle Probleme des Menschen zu thematisieren.
Doch während ich über die Dynamiken der heutigen „technomediatischen“ Welt und den Hintergrund der Realpolitik nachdenke, versuche ich stets, den tödlichen Konflikt zwischen dem Staatensystem und dem globalen Herrschaftsanspruch des Finanzkapitals im Blick zu behalten.
Ich kann es auch Ihnen nur empfehlen.