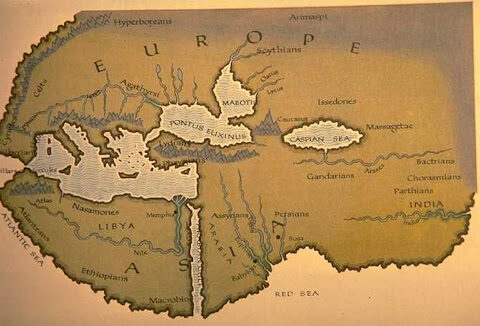Quelle: DÎVÂN Wissenschaftliche Forschungen Nr. 15 (2003/2), S. 1–51
Islamwahrnehmungen im 19. Jahrhundert: Vom christlichen Pilger zum Orientalisten
Außerhalb der Welt der Theologie, Philosophie und Literatur gab es viele Europäer, die ihre Neugier auf die östliche Welt nicht allein durch das Lesen von Büchern stillen konnten. Genau dieser Umstand erklärt, weshalb zahlreiche von ihnen Reisen in die islamische Welt unternahmen und eine große Menge an Reiseberichten verfassten, in denen sie die von ihnen besuchten muslimischen Länder, deren Städte, Bevölkerung und Traditionen beschrieben. Burton, Scott, Kinglake, Disraeli, Curzon, Warburton, Nerval, Chardin, Chateaubriand, Flaubert, Lamartine, Pierre Loti und Tavernier gehören zu den bedeutendsten europäischen Reisenden des 17., 18. und 19. Jahrhunderts. Der enorme Informationsreichtum, der durch diese Reisenden nach Europa floss, führte – wenn auch nicht im akademischen Bereich – dazu, dass sich unter der Bevölkerung zahlreiche neue Vorstellungen über die islamische Welt und die Muslime verbreiteten. Dank der oft mit kräftiger Vorstellungskraft geprägten Darstellungen der Reisenden gelang es den Europäern, in die Welt der Muslime und Orientalen, also in eine zuvor als unzugänglich geltende Sphäre, einzudringen. Merkwürdigerweise hatten diese Reiseberichte Wirkungen, die jenen ähnelten, die beinahe sieben Jahrhunderte zuvor die Kreuzzüge hinterlassen hatten: Ersthandinformationen über den Orient wurden dem westlichen Publikum zugänglich gemacht, und die Europäer begannen, diese nicht mehr als religiöse Bedrohungen oder als Angriffe auf die christliche Theologie wahrzunehmen. So wurde in der Kolonialzeit die mission civilisatrice als neues Selbstverständnis der westlichen Welt (Occident), den Osten (Orient) zu zivilisieren, endgültig verfestigt. Der kunstvollste und radikalste Ausdruck dieser Sichtweise stammt vom französischen Dichter und Schriftsteller André Gide, der 1947 den Nobelpreis erhielt. In seinen berühmten Journals berichtet Gide über seine Reise in die Türkei im Jahr 1914, die für ihn in jeder Hinsicht eine große Enttäuschung darstellte:
„Istanbul vereint sich mit Venedig in meiner persönlichen Hölle, indem es all meine Vorurteile bestätigt. Immer wenn ich mich im Begriff fühle, ein Teil seiner Architektur zu bewundern – etwa das Äußere einer Moschee –, erfahre ich sofort (wie ich bereits vermutet hatte), dass diese Architektur von albanischen oder persischen Einflüssen geprägt ist. Und die Kleidung ist noch schlimmer, als man es sich vorstellen könnte. Wie ich schon lange glaubte und – abgesehen von der Liebe zum Exotischen, der Angst vor dem chauvinistischen Selbstvertrauen und wahrscheinlich einer gewissen Bescheidenheit – ebenso lange dachte, gibt es mehr als nur eine Zivilisation, mehr als nur eine Kultur, die unsere Aufmerksamkeit verdient und zu Recht unsere Zuneigung erbitten könnte. (…) Doch jetzt weiß ich ganz genau, dass unsere westliche Welt (Occidental) nicht nur die schönste ist – nein, ich glaube und weiß nun, dass sie die einzig wahre ist; ja, wir sind die einzigen Erben der großen griechischen Zivilisation.“
Wie ihre Vorgänger des 17. und 18. Jahrhunderts interessierten sich die meisten dieser Reisenden lediglich für die „weltlichen“ Aspekte des Islams. Mit diesem Verhalten verfolgten sie vermutlich das Ziel, jene Zweifel zu zerstreuen, die sie über lange Jahre hinweg gegenüber einer Welt gehegt hatten, der sie nun großes Interesse entgegenbrachten. Von schwer verständlichen, trockenen Aufzählungen von Namen und Orten bis hin zu lebendigen Beschreibungen und phantasievollen Darstellungen standen die Berichte dieser Reisenden weit davon entfernt, ein echtes Anliegen zu sein, um sich vollständig in die Kenntnisse über die islamische Welt zu vertiefen oder diese aus der Perspektive eines hochgebildeten europäischen Schriftstellers darzustellen und zu formen. Ein grobes Beispiel hierfür ist, dass viele dieser Reisenden – mit der bemerkenswerten Ausnahme von Richard Burton – keine der islamischen Sprachen beherrschten und, abgesehen von den in Europa verbreiteten Ansichten, keinerlei ernsthafte Anstrengung unternahmen, um zuverlässige Informationen über den Glauben und die religiösen Praktiken der Muslime zu erlangen.
Das berühmte Reisewerk Travels in Persia 1673–1677 (Reisen in Persien 1673–1677) von Sir John Chardin enthält zahlreiche Beobachtungen über das persische Volk und bringt ihnen gegenüber ambivalente Gefühle zum Ausdruck. Chardin äußert sich über das „Temperament, die Haltung und die Sitten“ der Perser wie folgt:
„Die Perser sind höfliche, kultivierte und wohlgeborene Menschen; ihrer Natur nach sind sie der Sinnlichkeit, dem Luxus, dem Überfluss und der Verschwendung zugeneigt. Sparsamkeit liegt ihnen fern, und im Handel verstehen sie sich wenig. Kurz gesagt: Sie kommen mit ebenso vielen natürlichen Vorzügen zur Welt wie andere Menschen, aber nur wenige missbrauchen diese so sehr wie sie. (…)
(…) Neben den moralischen Verfehlungen, denen sie verfallen sind, sind die Perser äußerst verlogen; sie sprechen unter Eid, sie leihen sich Geld, zahlen es jedoch nicht zurück, und wenn sich die Gelegenheit zum Betrug ergibt, lassen sie sie nur selten ungenutzt. Auch in anderen Diensten sind sie wenig zuverlässig; sie sind weder pünktlich noch ehrlich im Geschäftsverkehr und täuschen die Menschen mit solcher Geschicklichkeit, dass ihr Gegenüber hilflos zurückbleibt. Sie sind habgierig nach Reichtum und tragen einen hochmütigen Prunk zur Schau; jede Gelegenheit, Ansehen und Ruhm zu erlangen, nutzen sie nach Kräften.“
Das wichtigste Ergebnis dieser Literatur ist jener Zustand, den Edward Said als die „Orientalisierung des Orients“ bezeichnet – ein Phänomen, das sich in einer übersteigerten Romantisierung und zugleich Verteufelung der muslimischen Völker äußert. Darüber hinaus verstärkte der Orientalismus auf künstlerische und literarische Weise das Geheimnis des Orients durch festgelegte Identitäten und stereotype Darstellungen wie den exotischen Harem, den gefühlvollen Osten, den orientalischen Mann und seine Konkubinen sowie die Straßenszenen orientalischer Städte. All diese Themen lassen sich anschaulich in der naturalistischen europäischen Malerei des 19. Jahrhunderts wiederfinden, die die orientalische Welt darzustellen suchte.
Diese Eindrücke vom Orient behalten ihre Lebendigkeit noch immer im europäischen Bewusstsein und bilden in den USA einen reichen Fundus für Hollywood-Filme über Muslime und den Islam. Filme wie True Lies (1994) und Executive Decision (1996), die Araber als gedankenlose Verbrecher und wilde Psychopathen darstellen, gehören zum kollektiven Gedächtnis unserer jüngeren Vergangenheit und gründen historisch auf dem im 19. Jahrhundert in Europa geschaffenen Verständnis vom „Geheimnis“ des Islams. Es wäre nicht falsch zu behaupten, dass das 19. Jahrhundert die längste und prägendste Epoche in der gemeinsamen Geschichte des Islams und des Westens darstellt. Die akademische Beschäftigung Europas mit dem Islam nahm in diesem Jahrhundert in einem Maße zu, das zuvor kaum vorstellbar war. Dieses Interesse hängt eng mit den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie – und vor allem – mit den kolonialen Erfahrungen des 19. Jahrhunderts zusammen, in deren Verlauf eine Handvoll Europäer einen bedeutenden Teil der islamischen Welt besetzte. Wie die langen Listen der Orientalisten zeigen, war das 19. Jahrhundert Zeuge eines plötzlichen und dramatischen Aufschwungs der Islamstudien.
Die Werke, die in einem Zeitraum von siebzig Jahren entstanden, übertrafen sowohl qualitativ als auch quantitativ all das, was im Verlauf des vorherigen Jahrtausends hervorgebracht worden war: Silvestre de Sacy (1758–1838), der Vater des französischen Orientalismus; E. W. Lane (1801–1876), Autor des bis heute klassischen Arabic–English Lexicon; Karl Pfander, bekannt durch seine Missionsarbeiten in Indien und durch seine Debatten mit muslimischen Gelehrten des Subkontinents; J. von Hammer-Purgstall (1774–1856), berühmt für seine akribischen Studien zur osmanischen Geschichte sowie zur arabischen, persischen und türkischen Dichtung; der bereits erwähnte William Muir; F. D. Maurice (1805–1872), ein bedeutender Theologe der anglikanischen Kirche und Autor des für das Verständnis der christlichen Perspektive auf den Islam im 19. Jahrhundert grundlegenden Werkes The Religions of the World and Their Relations with Christianity; sowie Ernest Renan (1823–1892), dessen umstrittene Vorlesungen über Islam und Wissenschaft an der Sorbonne heftige Reaktionen der muslimischen Intellektuellen seiner Zeit, darunter Cemaleddin Afgānī und Namık Kemal, hervorriefen – all dies sind nur einige der herausragenden Namen.
Wie die oben genannten Persönlichkeiten, die im 19. Jahrhundert über den Islam und die islamische Welt schrieben, eröffneten auch zahlreiche weitere Namen der Islamforschung ein neues Feld und trugen zur Entstehung neuer Verständnismuster gegenüber der islamischen Welt bei. Der Beitrag dieser Gelehrten zur Herausbildung des modernen westlichen Islambildes ist vielschichtig. Erstens halfen sie dabei, die Neugier der Europäer hinsichtlich des Islams zu stillen – einer Religion, die heute politisch, militärisch und wirtschaftlich unter westlicher Vorherrschaft steht, die jedoch einst für den Westen eine bedrohliche Macht darstellte und erstaunliche Erfolge erzielt hatte. Der in den Arbeiten dieser Gelehrten thematisierte Islambegriff ist unvermeidlich eng mit der neuen kolonialen Identität Westeuropas verbunden. Zweitens förderte der Informationsstrom über die Geschichte, den Glauben, die Denktraditionen, Sprachen und Geographie der muslimischen Welt die wissenschaftliche Entwicklung dieses Forschungsbereichs mindestens ebenso sehr wie die politische Unterstützung durch die koloniale Macht. Es entgeht uns kaum, dass im 19. Jahrhundert eine beträchtliche Anzahl von Gelehrten, Reisenden und Übersetzern in ihren jeweiligen Fachgebieten beauftragt und mit klar formulierten sowie detaillierten Aufgabenlisten als Kolonialbeamte in den Orient entsandt wurden. Drittens besteht das für uns bedeutendste Erbe dieser Epoche darin, dass die Grundlagen für jene neuen Kategorien, Typologien, Klassifikationen und Terminologien geschaffen wurden, die man heute unter dem Namen Orientalismus kennt – ebenso wie für die Methoden, die für das Verständnis des Islams und des Orients notwendig geworden sind.
Der Orientalismus erreichte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und im ersten Teil des 20. Jahrhunderts seinen Höhepunkt, und an westlichen Universitäten begannen zahlreiche europäische Gelehrte mit aufrichtiger Bemühung moderne Islamstudien als Lehrfach zu etablieren. Mit großer Leidenschaft, Begeisterung, wissenschaftlichem Einsatz und einer unverkennbar westlichen Identität wurden Ignaz Goldziher (1850–1921), Snouck Hurgronje (1857–1936), Duncan Black Macdonald (1863–1943), Carl Becker (1876–1933), David Samuel Margoliouth (1858–1940), Edward Granville Browne (1862–1926), Reynold Alleyne Nicholson (1868–1945), Louis Massignon (1883–1962) und Sir Hamilton A. R. Gibb (1895–1971) zu den herausragenden Gestalten der orientalistischen Forschung über den Islam. Die Orientalisten veröffentlichten zahlreiche Bücher, Zeitschriften, Artikel, Übersetzungen, kritische Editionen und Vorträge; sie eröffneten akademische Lehrstühle, formten die Parameter der modernen Islamforschung und der Wahrnehmung der muslimischen Welt und hinterließen ein bis heute reichendes wissenschaftliches Erbe. Doch die orientalistischen Bemühungen, den Islam darzustellen, trugen nur sehr wenig dazu bei, das vor der Moderne geerbte Bild des Orients und des Islams zu verändern. Manche westlichen Gelehrten, die über den Islam arbeiteten, interessierten sich nicht für ein solches Projekt und konzentrierten sich ausschließlich auf ihre eigenen Studien. In anderen Fällen wurde das düstere Bild eines in Verruf geratenen, im Sterben liegenden, rückständigen, unvernünftigen und lasterhaften „Zivilisationswesens“ Islam weiter gefestigt und durch Romane, Fernsehsendungen, Hollywood-Filme und die Medien unter der westlichen Bevölkerung verbreitet. In diesem Zusammenhang blieb die Idee einer Vermittlungsrolle – „bewusst oder unbewusst unser Fachwissen dazu einzusetzen, um eine Brücke zwischen den Völkern Asiens und Europas zu bauen“ –, die Arberry in seinem Werk Oriental Essays im Hinblick auf sieben britische Orientalisten (einschließlich seiner selbst) anspricht, ein unvollendetes Projekt und ein unerfüllter Wunsch. Wenn wir von den persönlichen Neigungen einzelner orientalischer Gelehrter absehen, bleibt festzustellen, dass der Orientalismus mit zahlreichen strukturellen und methodologischen Problemen behaftet ist, von denen einige in der heutigen Darstellung des Islams weiterhin wirksam sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Gründe dafür zu bestimmen, warum der Islam im günstigsten Fall als „der Andere“ und im ungünstigsten Fall als „der Feind“ bezeichnet wird. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit können wir einige dieser Probleme kurz benennen.
In seinen frühen Phasen erfüllte der Orientalismus im Kontext des europäischen Denkens des 19. Jahrhunderts eine bestimmte Funktion. Die Geistesströmungen, die die westlichen Humanwissenschaften und die neue koloniale Ordnung formten – von Romantik und Rationalismus bis hin zu historischer Kritik und Hermeneutik – spielten eine tatsächliche Rolle bei der Neubildung des Islambildes. Doch die Orientalisten interessierten sich kaum dafür, die Beschränkungen zu überwinden, die sich daraus ergeben, eine andere Kultur mit den Kategorien des Westens zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wurde die Suche nach „Entsprechungen“ zwischen der islamischen Tradition und anderen Kulturen, das Bestreben, homogene Strukturen zu finden und „Orthodoxie“ zu konstruieren, zu einem Kennzeichen der orientalistischen Tradition – gleichgültig, ob das Interesse eines Orientalisten dem populären Sufismus, der politischen Geschichte, der Wissenschaft oder der Rechtsgelehrsamkeit galt. Dies führt zwangsläufig zu einer fragwürdigen Verallgemeinerung, etwa die „islamische Orthodoxie“ dem Volksislam gegenüberzustellen oder den „high Islam“ beziehungsweise den Sufismus gegen die Scharia auszuspielen. Das in der abstrakten Sprache akademischer Darstellung entworfene Islambild ist nicht weniger essentialistisch als das mittelalterliche Islamverständnis und wirkt bis heute an der Gestaltung der populären westlichen Wahrnehmung des Islams mit. Zweitens neigen orientalistische Ansätze – oder zumindest viele westliche Forscher, die über den Islam arbeiten – dazu, die islamische Welt als eine Zivilisation zu analysieren, die trotz ihrer verschlungenen Texttradition und trotz der vielfältigen Antworten muslimischer Intellektueller auf die Herausforderungen der Moderne im Niedergang begriffen sei. So herrschte unter den bedeutenden Gestalten des klassischen Orientalismus Einigkeit darüber, dass die islamische Philosophie und Wissenschaft im Wesentlichen die Funktion eines „Durchgangshafens“ gehabt hätten, über den das griechische Wissen nach Europa gelangte. Lieste man etwa Salomon Munks Mélanges de philosophie juive et arabe (1859) oder De Boers Geschichte der Philosophie im Islam (1903), so konnte man sich kaum des Eindrucks erwehren, dass die islamische Philosophie – sofern diese Bezeichnung überhaupt angemessen ist – lediglich ein langer arabischer Kommentar zu griechischem und hellenistischem Denken sei, das durch Aristotelismus und Neuplatonismus geprägt wurde. Wie von Grunebaum es formulierte, sei das größte Kompliment, das man der islamischen Gelehrsamkeit machen könne, sie als eine „kreative Anleihe“ zu bezeichnen. Vor diesem Hintergrund war die nahezu obsessive Suche danach, die „Originalität“ des islamischen Denkens zu widerlegen, von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
So wurde der Islam, seiner universellen Anziehungskraft und Lebendigkeit beraubt, nicht mehr als eine mit der Menschheit mitlebende Tradition betrachtet, sondern als ein Forschungsgegenstand, der historisiert und relativiert werden sollte. An diesem Punkt ist festzuhalten, dass im 19. Jahrhundert und in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das Interesse der Islamforscher vor allem jenen islamischen Bewegungen und Persönlichkeiten galt, die in intellektueller und politischer Hinsicht mit der modernen westlichen Welt in Kontakt standen. Es lässt sich jedoch sagen, dass die in diesem Zeitraum entstandenen Studien den größten Teil der islamischen Welt – nämlich die traditionelle Gelehrsamkeit, die Sufis und ihre Anhänger, die keinerlei Bedürfnis verspürten, dem Westen in einer Weise zu antworten, die die Aufmerksamkeit westlicher Gelehrter auf sich gezogen hätte – vernachlässigten oder schlicht ignorierten. Seit den 1960er und 1970er Jahren, als der klassische Orientalismus zunehmend kritisch hinterfragt wurde, erleben wir zwar Untersuchungen, die sich mit der traditionellen islamischen Welt des 18. und 19. Jahrhunderts befassen. Doch besitzen wir bis heute nur eine begrenzte Zahl an neueren Studien über eine lange Liste bedeutender Gestalten, darunter Šayḫ ʿAbd al-Qādir al-Ğazāʾirī, Šayḫ Aḥmad al-ʿAlawī, Aḥmad b. Idrīs, Ḥāǧǧī Mullā Sabzavārī, Bābanzāde Aḥmed Naʾīm sowie der letzte osmanische Scheichülislâm Mustafa Sabri Efendi. Vor diesem Hintergrund blieb das orientalistischen Unternehmungen zugrunde liegende Ziel, die islamische Welt in all ihren Einzelheiten darzustellen, ein unerfülltes Projekt. Denn das von ihnen gezeichnete Bild der islamischen Welt und ihrer vielfältigen Geschichte war notwendig unvollständig und übermittelte den westlichen Lesern lediglich ein fragmentarisches Abbild.