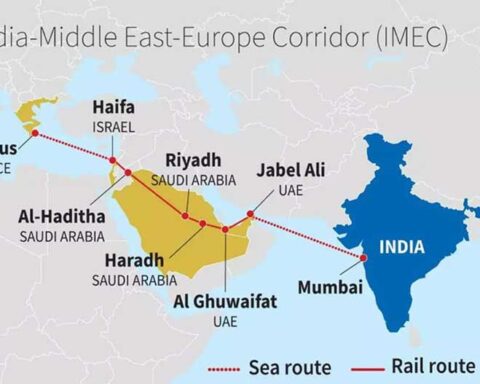Die Vereinigten Staaten müssen ihre Atlantik- und Pazifikstrategien vereinen
Am 28. Oktober 2024 informierte eine Gruppe südkoreanischer Geheimdienstbeamter die NATO-Mitglieder sowie die drei weiteren indo-pazifischen Partner des Bündnisses – Australien, Japan und Neuseeland – über eine bemerkenswerte Entwicklung im Krieg in der Ukraine: Nordkorea hatte Tausende Soldaten in die russische Region Kursk entsandt, um Moskaus Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Dass Seoul seine ranghöchsten Geheimdienstanalysten eigens zu diesem Briefing nach Brüssel schickte, war ebenso aufsehenerregend wie Nordkoreas Entscheidung, sich in den Ukrainekrieg einzumischen.
Beide Ereignisse wiesen auf eine neue Realität hin: Die Gegner der Vereinigten Staaten koordinieren sich in nie dagewesener Weise und schaffen so in Eurasien eine zunehmend integrierte Bühne des Wettbewerbs. Gleichzeitig rücken auch die Verbündeten der USA enger zusammen – eine Entwicklung, die in den letzten Jahren wesentlich von Washington selbst vorangetrieben wurde. 2021 gründeten die Vereinigten Staaten zusammen mit Australien und dem Vereinigten Königreich das Sicherheitsabkommen AUKUS. 2022 begann die NATO, asiatische Staaten zu ihren jährlichen Gipfeln einzuladen. Und 2024 bildeten Japan, Südkorea, die USA und die Europäische Union eine Koalition, um Chinas Dominanz in den pharmazeutischen Lieferketten zu schwächen.
Heute jedoch scheint Washington von einem transregionalen Ansatz im Wettbewerb der Großmächte abzurücken. Im Mai versuchte der für Verteidigungspolitik zuständige US-Unterstaatssekretär Elbridge Colby, britische Entscheidungsträger davon zu überzeugen, auf eine geplante Entsendung eines Flugzeugträgers in den Indopazifik zu verzichten. Laut einem anonymen Insider, der mit Politico sprach, war Colbys Haltung eindeutig: „Wir wollen euch dort nicht.“ Stattdessen empfahl er, sich auf Bedrohungen näher an der eigenen Region – also auf Russland – zu konzentrieren.
Derzeit rät Washington seinen Verbündeten in Asien und Europa, sich auf ihre unmittelbaren Umfelder zu beschränken – ein anachronistischer außenpolitischer Ansatz, der in die Gegenwart kaum passt. China und Russland synchronisieren ihre Verstöße, teilen Waffen und Technologien. Gemeinsam stellen sie eine weitaus ernstere Bedrohung dar als alles, womit die USA in den letzten Jahrzehnten konfrontiert waren. Die Grenzen zwischen Asien und Europa verschwimmen; eine Krise auf einem Kontinent zieht Wellen auf dem anderen nach sich. Statt zu versuchen, die neuen Netzwerke seiner Verbündeten zu behindern, sollte Amerika versuchen, sie zu gestalten. Andernfalls riskiert Washington, am Rand der entstehenden neuen Weltordnung zu stehen.
Gemeinsam handeln
Amerikas Überlegenheit hängt von der Sicherheit in Asien und Europa ab. Bereits in den 1940er-Jahren wies der Politikwissenschaftler Nicholas Spykman auf die Bedeutung der Kontrolle über die Küstenzonen Eurasiens – den sogenannten „Rimland“ – hin. Er schrieb:
„Wer das Rimland kontrolliert, beherrscht Eurasien. Wer Eurasien beherrscht, bestimmt das Schicksal der Welt.“
Seitdem hat jeder US-Präsident – mit Ausnahme von Donald Trump – Spykmans Überzeugung geteilt. Alle waren sich einig, dass die Vereinigten Staaten niemals das Wiederaufleben eines mächtigen eurasischen Blocks zulassen dürfen, der ihre Interessen bedrohen könnte. Eine koordinierte Ausrichtung regionaler Mächte – ob als Verbündete oder Gegner der USA – birgt stets ein potenzielles Risiko für die amerikanische Vormachtstellung. Als solche Konstellationen in den 1910er- und erneut in den 1930er-Jahren entstanden, wurden die Vereinigten Staaten in zwei verheerende Weltkriege hineingezogen.
Deshalb verpflichteten sich die amerikanischen Führungen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur dauerhaft der Sicherheit sowohl Europas als auch Asiens, sondern verbrachten auch den Großteil der folgenden fünf Jahrzehnte damit, die Feinde der USA zu spalten und ihre Verbündeten voneinander getrennt zu halten.
Dieser Ansatz sicherte über Jahrzehnte hinweg die amerikanische Dominanz – doch heute erfüllt er seinen Zweck nicht mehr. Die Vereinigten Staaten stehen nun vor der Aussicht auf einen eurasischen militärisch-industriellen Block. China, gemessen an der Kaufkraftparität die größte Volkswirtschaft der Welt, baut eine faktisch unbenannte Allianz mit Russland auf. Beide Länder verfügen über starke Streitkräfte und langjährige Erfahrung in hybriden Operationen – von Cyberangriffen über Störungen des Seehandels bis zu Desinformationskampagnen.
Im vergangenen Jahr unterzeichnete Russland ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen mit Nordkorea. China wiederum führte gemeinsame Militärübungen mit Belarus und Serbien durch. Zudem nutzen China und Russland Organisationen wie die Shanghai Cooperation Organisation (SCO) und die BRICS-Gruppe – deren Name sich aus den Anfangsbuchstaben von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zusammensetzt –, um ihren Plänen den Anschein von Legitimität zu verleihen.
Auch wenn diese lockere Gemeinschaft von Gegnern eher von gemeinsamen Ressentiments als von gemeinsamen Interessen zusammengehalten wird, kann Washington diese Entwicklungen nicht ignorieren. Die Vereinigten Staaten müssen in interregionale Verbindungen investieren und ihre Bündnisse enger miteinander verknüpfen.
Präsident Joe Biden hat diesen Bedarf erkannt und versucht, die „Muskeln der demokratischen Allianzen“ zu stärken. Das AUKUS-Abkommen war etwa ein ambitioniertes Projekt, das darauf abzielte, grundlegende Verbindungen zwischen den Verteidigungsindustrien der atlantischen und pazifischen Verbündeten zu schaffen.
In einer Welt, in der chinesische Technologien und nordkoreanische Soldaten die Kriegsanstrengungen in der Ukraine unterstützen, wissen die europäischen Partner, dass sie sich gegenüber der asiatischen Geopolitik nicht länger neutral verhalten können. Die indo-pazifischen Partner wiederum haben erkannt, dass die Entwicklungen in der Ukraine unmittelbare Auswirkungen auf Chinas künftigen Umgang mit Taiwan haben könnten.
Japans ehemaliger Außenminister Yoshimasa Hayashi brachte es auf den Punkt: Die Sicherheit Europas und die Sicherheit im Pazifik seien „untrennbar miteinander verbunden“.
In den letzten sieben Jahren haben Frankreich, Deutschland, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union neue Indo-Pazifik-Strategien formuliert, die die Zusammenarbeit mit asiatischen Demokratien betonen – mit dem Ziel, widerstandsfähige Lieferketten aufzubauen und die Freiheit der Seefahrt zu wahren. 2021 entsandten Deutschland und die Niederlande erstmals seit Jahrzehnten Fregatten in den Indo-Pazifik. Laut dem in Kiel ansässigen Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat Japan Finnland, Frankreich und Polen bei bilateraler wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe für die Ukraine bereits übertroffen.
Seit Januar jedoch zeigt sich Washington zunehmend widerständig gegenüber der wachsenden Verflechtung seiner Partner in Asien und Europa. Im September erklärte Donald Trump, er sei „überhaupt nicht besorgt“ über eine mögliche Achse zwischen China und Russland gegen die USA. Auf dem Shangri-La-Dialog 2025, der größten jährlichen Sicherheitskonferenz Asiens, betonte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, die europäischen Verbündeten sollten ihre „vergleichenden Vorteile auf ihren eigenen Kontinenten maximieren“ und erinnerte daran, dass das „N“ in NATO für Nordatlantik stehe.
In den Protokollen der Treffen zwischen Pentagon-Beamten und europäischen Partnern taucht das Thema indo-pazifische Sicherheit kaum noch auf – obwohl es in den vergangenen Jahren regelmäßig diskutiert wurde. Ebenso wird in Gesprächen zwischen den USA und asiatischen Ländern die Bedeutung des Friedens in der Ukraine nicht mehr thematisiert. Im Juni nahmen zum ersten Mal seit drei Jahren keine Indo-Pazifik-Staats- und Regierungschefs am NATO-Gipfel teil – obwohl ihre Länder entscheidende Beiträge zur europäischen Verteidigung geleistet hatten.
Die Regierung Trump scheint ihre europäischen Verbündeten dazu drängen zu wollen, in ihrer „eigenen Hinterhofregion“ zu bleiben und mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit zu übernehmen. Die USA selbst konzentrieren sich offenbar darauf, Ordnung in der westlichen Hemisphäre zu wahren, ihr eigenes Territorium zu schützen und ihre globalen Verpflichtungen zu reduzieren.
Doch die Gegner Amerikas teilen ihre technologischen und militärischen Ressourcen auf eine Weise, die die Stärke einzelner Verbündeter erschöpfen und regionale Konflikte verlängern kann. Darüber hinaus setzen China und Russland weltweit Instrumente wie Cyber- und Weltraumoperationen ein – was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass eine Krise auf eine einzige geografische Region beschränkt bleibt.
Die Isolierung asiatischer und europäischer Verbündeter voneinander würde die Vereinigten Staaten und ihre Partner schwächen.
Die Wahrscheinlichkeit einer Mehrfrontenkrise wächst stetig. Washington und seine Verbündeten müssen darauf vorbereitet sein, mehrere Gegner in verschiedenen Regionen gleichzeitig abzuschrecken. Die Fähigkeit dieser Staaten, eine gemeinsame Front zu bilden – oder ihre Unfähigkeit dazu – wird die Kalkulationen der Entscheidungsträger in Peking und Moskau maßgeblich beeinflussen. Amerikas Freunde und Feinde ordnen ihre Positionen neu. Washington kann sich entscheiden, am Rand zu bleiben – oder versuchen, die sich formende Ordnung aktiv zu gestalten.
Das doppelte Problem
China und Russland arbeiten auf eine Weise zusammen, auf die die Vereinigten Staaten nicht vorbereitet sind. Beide Länder nutzen ihre bilaterale Beziehung sowie ihre jeweiligen Partnerschaften mit Nordkorea und Iran, um Unruhe zu stiften. In Asien und Europa führen Peking und Moskau sogenannte Grauzonenoperationen durch, um die Verbündeten der USA einzuschüchtern, ihre militärischen Fähigkeiten zu schwächen und die Einheit und Wirksamkeit demokratischer Strukturen wie der EU, der G7 und der NATO infrage zu stellen.
So versuchten China und Russland beispielsweise, Japan und Südkorea durch gemeinsame Luftpatrouillen zu provozieren. Europäische Behörden untersuchten Schiffe mit chinesischen und russischen Verbindungen, die im Verdacht standen, Unterseekabel in der Ostsee sabotiert zu haben. Laut dem European Policy Centre überschneiden sich Chinas und Russlands Desinformationskampagnen im Internet zunehmend „sowohl in ihren Taktiken als auch in ihren Zielsetzungen“.
Die staatlichen Medien beider Länder verstärken einander gegenseitig, indem sie Narrative verbreiten, die der NATO die Schuld am Krieg in der Ukraine zuschreiben oder Verschwörungstheorien über die COVID-19-Pandemie streuen.
Gleichzeitig integrieren China und Russland ihre militärischen Kapazitäten auf eine Weise, die künftige Kriege entscheidend prägen könnte. Die anhaltenden Bombardierungen der Ukraine durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin wären ohne Waffen, Technologien und Personal aus China, Iran und Nordkorea gar nicht möglich. Nach Angaben amerikanischer Regierungsvertreter revanchiert sich Moskau für diese Unterstützung, indem es bislang streng gehütete Technologien – etwa für U-Boote, Raketen- und Satellitensysteme – nun an Peking und Pjöngjang weitergibt.
Die jüngste Bedrohungsanalyse der US-Geheimdienste warnt, dass diese wachsende Allianz die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Krise oder ein Konflikt mit einem dieser Länder auch die anderen hineinziehen könnte. Eine parteiübergreifende Kommission ehemaliger hochrangiger ziviler und militärischer US-Beamter kam 2024 zu einem ähnlichen Schluss: Sollte die Vereinigten Staaten in einen direkten Konflikt mit Russland, China, Iran oder Nordkorea geraten, müsse Washington davon ausgehen, dass dieses Land ökonomische und militärische Unterstützung von den anderen erhalten würde.
China und Russland entwickeln zunehmend die Fähigkeit, regionale Konflikte über längere Zeiträume hinweg aufrechtzuerhalten. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten können dieser Bedrohung nur dann begegnen, wenn sie selbst enger militärisch zusammenarbeiten. Glücklicherweise haben Washingtons Partner bereits damit begonnen. Während Russland seine Offensive in der Ukraine mit Hilfe aus China und Nordkorea fortsetzt, konnte die NATO die ukrainische Verteidigung nur deshalb aufrechterhalten, weil Australien, Japan und Südkorea im Stillen die US-Bestände an 155-Millimeter-Artilleriemunition und Patriot-Raketen wieder auffüllten.
Ebenso halfen die begrenzten europäischen Entsendungen in den Indopazifik dabei, die Präsenz der Alliierten im Südchinesischen Meer und in der Straße von Taiwan aufrechtzuerhalten – insbesondere in einer Phase, in der US-Schiffe in den Nahen Osten und andere Regionen verlegt wurden.
Diese Initiativen sind ein guter Anfang, doch die Vereinigten Staaten und ihre Partner müssen weit mehr tun, um China und Russland entgegenzutreten. Die gegenseitige Unterstützung dieser beiden Mächte erhöht zugleich das Risiko eines Mehrfrontenkriegs.
Im Juli warnte NATO-Generalsekretär Mark Rutte, dass China im Falle einer Krise um Taiwan Russland auffordern könnte, „durch Angriffe auf NATO-Gebiet“ in Europa abzulenken, um Washington und seine Partner zu beschäftigen. Moskau könnte darüber hinaus auf nicht-kinetische Mittel wie Cyberangriffe gegen europäische Energieinfrastrukturen zurückgreifen, um Länder von einer Unterstützung Taiwans abzuschrecken.
Die Streitkräfte und Verteidigungsplaner der Verbündeten müssen die Möglichkeit eines Krieges auf mehreren Schauplätzen gemeinsam in Betracht ziehen. Die Vereinigten Staaten und ihre Partner sollten damit beginnen, den Echtzeit-Informationsaustausch zwischen ihren Hauptstädten zu intensivieren, Schwachstellen in kritischer Infrastruktur zu verringern, sich auf Schocks auf den Energiemärkten vorzubereiten und ihre Weltraum- und Cyberkapazitäten stärker zu integrieren.
Darüber hinaus sollten die Vereinigten Staaten und ihre Freunde ihre Rüstungsproduktion koordinieren, um Lücken in den jeweiligen Arsenalen zu schließen. Die gemeinsame Produktion von weitreichenden Offensivwaffen, Munition und Drohnen muss innerhalb der nächsten fünf Jahre verdoppelt werden.
Wenn die USA und ihre Verbündeten ihre Ressourcen nicht bündeln, drohen ihnen in einem zukünftigen Konflikt gravierende Engpässe bei entscheidender Munition. Kriegssimulationen des Center for Strategic and International Studies (CSIS) haben gezeigt, dass Amerika in einem Krieg mit China um Taiwan bereits nach acht Tagen seine wichtigsten Munitionsvorräte aufgebraucht hätte.
Um überhaupt mit Chinas militärisch-industrieller Kapazität Schritt halten zu können, müssen die Vereinigten Staaten und ihre Partner ihre Mittel vereinen. Sollte Russland China zusätzlich mit Munition beliefern, wäre die Notwendigkeit, auf kollektive Ressourcen zurückzugreifen, umso größer.
Washington sollte daran arbeiten, Munitionsfabriken in Europa und im indo-pazifischen Raum aufzubauen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Nachschublinien der Vereinigten Staaten von ihren Gegnern unterbrochen werden. Gleichzeitig sollten in den Partnerländern mehr Instandhaltungs-, Reparatur- und Überholungszentren (MRO) für US-Plattformen entstehen; solche Einrichtungen würden im Krisenfall die Einsatzbereitschaft und Abschreckungsfähigkeit der amerikanischen Streitkräfte erhöhen. Washington und seine Partner sollten außerdem üben, ihre Fähigkeiten schnell zwischen den Regionen zu verlegen. So sollte die Vereinigten Staaten beispielsweise mehr europäische und indo-pazifische Verbündete in die alle zwei Jahre abgehaltene Übung Mobility Guardian einbeziehen, an der derzeit Australien, Kanada, Frankreich, Japan, Neuseeland, das Vereinigte Königreich und die USA teilnehmen. In dieser Übung werden Truppen und Waffen über große Entfernungen transportiert, um Verlegungsszenarien zu testen.
Aus dem Gruppengespräch ausgeschlossen
Die Verbündeten der USA sind sich inzwischen bewusst, dass sie engere Zusammenarbeit benötigen. Tatsächlich wenden sich die Partner in Asien und Europa schon seit Längerem einander zu – gewissermaßen als gegenseitige Versicherung gegen die Vereinigten Staaten selbst. Immer dann, wenn Washington unzuverlässig oder unberechenbar wird, neigen die Verbindungen zwischen Asien und Europa dazu, sich zu stärken. Der Rückzug der ersten Trump-Regierung aus dem freien Handel führte dazu, dass die Europäische Union umfassende Handelsabkommen mit Japan und Vietnam unterzeichnete. Unter der zweiten Trump-Regierung steht die EU kurz davor, neue Handelsabkommen mit Indien und Indonesien abzuschließen. Im Juli erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neben dem indonesischen Präsidenten Prabowo Subianto: „Wenn wirtschaftliche Unsicherheit auf geopolitische Turbulenzen trifft, müssen Partner wie wir einander noch näherkommen.“
Durch die chinesisch-russische Zusammenarbeit und die inkonsistente Außenpolitik der Vereinigten Staaten stimmen sich die Länder im Atlantik- und im Pazifikraum in Sicherheitsfragen in bisher beispielloser Weise ab. 2023 unterzeichneten Japan und das Vereinigte Königreich ein Abkommen, das gemeinsame Ausbildung und rotierende Stationierungen ermöglicht. Frankreich und die Philippinen prüfen ein ähnliches Abkommen. Im selben Jahr wurde Australien das erste Nicht-NATO-Land, das der europäischen Logistikorganisation Movement Coordination Centre Europe beitrat, die die gemeinsame Nutzung von See- und Lufttransportkapazitäten für militärische Operationen erleichtert. Im November 2024 unterzeichnete die Europäische Union neue Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaften mit Japan und Südkorea – das erste Mal, dass Brüssel eine solche Zusammenarbeit mit asiatischen Partnern eingeht.
Washington sollte nicht versuchen, diese Kooperationen zu behindern oder herabzusetzen, sondern vielmehr eine führende Rolle einnehmen. Europäische Staats- und Regierungschefs haben offen erklärt, dass sie langfristig dem Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) beitreten wollen. Dies birgt für Washington das Risiko, von einem Handelsblock ausgeschlossen zu werden, der etwa 30 % des globalen BIP ausmacht. Die Vereinigten Staaten können jedoch weiterhin eine führende Rolle bei der Gestaltung des internationalen Handels spielen – etwa durch attraktive Alternativen in Bereichen wie Datenschutzbestimmungen oder KI-Regulierung oder durch die Angleichung von Standards mit den Partnern.
Ein stärker integrierter Block befreundeter Länder könnte für Washington tatsächlich von Vorteil sein. Die Verbündeten der USA beginnen endlich, Verantwortung bei der globalen Lastenteilung zu übernehmen. So arbeiten Frankreich, Indien und die Europäische Union gemeinsam daran, die maritime Überwachung im Indischen Ozean zu verstärken. Deutschland bietet den Philippinen, die sich der Aggression Chinas im Südchinesischen Meer gegenübersehen, maritime Ausbildung an. Und australische Soldaten beteiligen sich im Vereinigten Königreich an der Ausbildung ukrainischer Streitkräfte.
Einige andere Formen der Koordinierung zwischen den Verbündeten könnten jedoch riskant für die Vereinigten Staaten sein. Italien, Japan und das Vereinigte Königreich entwickeln gemeinsam ein neues Kampfflugzeug – ein Testfeld für künftige gemeinsame Projekte. Jahrzehntelang beruhte die Interoperabilität der Verbündeten weitgehend auf amerikanischer Technologie. Wenn asiatische und europäische Partner eigene Systeme entwickeln, könnte eine solche Integration schwieriger werden. Zudem könnten diese verbündeten Fähigkeiten ohne amerikanisches Fachwissen im globalen Wettbewerb weniger wirksam bleiben.
Wenn die Vereinigten Staaten sich weigern, den neuen Gruppen und Institutionen beizutreten, die ihre Verbündeten gründen, werden sie die Chance verlieren, die Regeln des internationalen Handels und der Sicherheit mitzugestalten. Die Europäische Union und die CPTPP-Mitgliedstaaten zeigen bereits Interesse daran, die Regeln des digitalen Handels in Asien und Europa ohne Beteiligung der USA zu harmonisieren. Solche Netzwerke könnten sich mit der Zeit so entwickeln, dass sie der US-Politik direkter entgegentreten oder eine weichere Haltung gegenüber den Zielen Chinas und Russlands einnehmen. Länder in Asien und Europa könnten ein günstigeres Umfeld für chinesische Investitionen und Technologien schaffen, ihre noch jungen Kooperationen mit Taiwan beenden oder ihre Unterstützung für die Ukraine abschwächen. Darüber hinaus könnten diese Länder durch die Übernahme chinesischer Telekommunikationsinfrastrukturen wie 5G und 6G anfälliger für Pekings nachrichtendienstliche Operationen werden oder dessen Druckmittel erweitern. Washington verfügt jedoch weiterhin über die Fähigkeit, einige dieser negativen Entwicklungen zu verhindern – vorausgesetzt, es behält seinen Platz am Verhandlungstisch.
Ein Neuer Block auf der Bühne
Die Neuordnung zwischen den Verbündeten und Gegnern der Vereinigten Staaten könnte jene Institutionen schwächen, die die amerikanische Vormachtstellung bislang ermöglicht haben. Zwar lieferten die US-amerikanischen Industriezentren die nötige Kraft, um den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen, doch während des Kalten Krieges beruhte die amerikanische Überlegenheit vor allem auf Washingtons Fähigkeit, internationale Regeln zu setzen. China und Russland sind sich dieser Macht bewusst – und wollen sie für sich selbst beanspruchen. Überregionale Institutionen wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) und die BRICS-Gruppe beginnen, die traditionellen internationalen Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen, im Bereich der multilateralen Zusammenarbeit zu verdrängen. Durch diese Strukturen entwickeln China und Russland neue Finanzinstrumente und staatlich kontrollierte Modelle der Cybersicherheit.
Der SCO-Gipfel im September in Tianjin verdeutlichte das Ausmaß des Risikos für die Vereinigten Staaten. An dem Treffen nahmen mehr als 20 Staats- und Regierungschefs teil, darunter der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Chinas Staatschef Xi Jinping erklärte dort offen, dass seine Regierung nicht zulassen werde, dass „die von einigen wenigen Ländern festgelegten Hausregeln“ die globale Ordnung bestimmen. Die SCO-Staaten kündigten den Aufbau einer neuen Entwicklungsbank an – zusätzlich zu einer ähnlichen Struktur, die unter der Führung der BRICS und der Asiatischen Infrastrukturinvestmentbank Chinas geschaffen wurde. Außerdem sollen in der Region neue Koordinationszentren für Sicherheit, Terrorismusbekämpfung und Drogenprävention eingerichtet werden. Peking nutzte das Treffen auch, um die Globale Governance-Initiative vorzustellen, die darauf abzielt, den Einfluss des Westens in internationalen Institutionen zu verwässern.
Zwar existieren Organisationen wie SCO und BRICS seit Jahrzehnten, doch ihre bislang begrenzten Ergebnisse führten dazu, dass sie oft nicht ernst genommen wurden. Die zentralasiatischen Mitgliedsstaaten versuchen, eine übermäßige Abhängigkeit sowohl von Peking als auch von Moskau zu vermeiden. Auch herrscht nicht immer Einigkeit unter den Mitgliedern: Indien und Pakistan etwa sind beide Mitglieder der SCO, befinden sich jedoch weiterhin in tiefer Rivalität. Trotz dieser Beschränkungen verschaffen überregionale Organisationen China und Russland einen strategischen Vorteil beim Aufbau einer neuen Weltordnung.
China und Russland verfügen innerhalb der von ihnen geführten Institutionen über deutlich größere Einflussmöglichkeiten, als die Vereinigten Staaten sie etwa in den Vereinten Nationen oder der G20 besitzen. Peking und Moskau nutzen die eurasischen Institutionen als Testfeld für neue, westfeindliche Initiativen und bedienen sich ihrer Sichtbarkeit, um ihren Ideen globale Legitimität zu verleihen. Durch die Aufnahme neuer Dialogpartner in den letzten Jahren haben SCO und BRICS es China und Russland ermöglicht, Führungs- und Einflussansprüche nicht nur in Eurasien, sondern auch im sogenannten Globalen Süden zu erheben.
Die praktischen Auswirkungen dieser Institutionen sind nicht immer sofort sichtbar. Doch ihre Beständigkeit und ihr Wachstum zeigen, dass Peking und Moskau systematisch die Unzufriedenheit mit westlichen Normen und Handelspraktiken ausnutzen. China hat durch gezielte Entwicklungsinvestitionen in Afrika, Asien und Europa enormen Einfluss gewonnen. Auch wenn die Welt noch weit davon entfernt ist, den US-Dollar aufzugeben, bemühen sich SCO und BRICS aktiv, die Entdollarisierung zu beschleunigen. Ihre Mitglieder tauschen Währungen aus und schließen grenzüberschreitende Zahlungsabkommen ab.
Die Bemühungen Chinas und Russlands, die Weltordnung neu zu gestalten, haben Amerikas Verbündete beunruhigt und sie dazu veranlasst, in neuer und kraftvoller Weise zusammenzurücken. Nach Russlands umfassender Invasion in der Ukraine hat die NATO ihre Beziehungen zu Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea vertieft. Das aus Australien, Kanada, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten bestehende Nachrichtendienstbündnis „Five Eyes“ hat neue Schritte unternommen, um den Informationsaustausch zu intensivieren und die Sicherheit der Lieferketten zu gewährleisten. Die G7 lädt regelmäßig Australien, Indien und Südkorea zu ihren Gipfeltreffen ein.
Die Regierung Trump könnte diese Dynamik nutzen, um die Verbündeten zu größerer Eigenverantwortung zu bewegen. Eine erweiterte G7 („G7 Plus“) könnte sich zu einer zwischenstaatlichen Organisation entwickeln, die als Plattform für die Zusammenarbeit in Bereichen wie der Sicherung strategischer Rohstoffe oder der Bekämpfung des Drogenhandels dient. Die beiden sogenannten „Quad“-Gruppen der USA – eine im Indopazifik mit Australien, Indien und Japan, die andere in Europa mit Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich – könnten zusammengeführt werden, um eine Koordinierung zwischen beiden Regionen in den Bereichen Exportkontrollen, Industriepolitik und Technologieentwicklung zu ermöglichen.
Ob die Vereinigten Staaten sich beteiligen oder nicht – ihre Verbündeten werden weiterhin miteinander kooperieren. Doch ohne Washington können sie ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen. Vor achtzig Jahren war mutige amerikanische Führung und Diplomatie erforderlich, um die globale Ordnung zu schaffen. Heute braucht es ein ebenso innovatives Maß an Führung. Das in der Nachkriegszeit aufgebaute amerikanische Bündnissystem muss so umgestaltet werden, dass es die neue Ausrichtung der Gegner widerspiegelt. Trump zeigte bislang wenig Interesse daran, die Allianzen über den bloßen Druck auf die Partner zur Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben hinaus zu revitalisieren oder neu zu gestalten. Obwohl die Verbündeten der USA heute stärker sind, fehlt es noch immer an einer klaren Strategie zur Integration ihrer neuen Fähigkeiten. Ohne amerikanische Führung könnten die Koalitionen der Verbündeten nicht über die nötige Stärke verfügen, um Peking und Moskau wirksam entgegenzutreten.
Die Vereinigten Staaten können die wachsende chinesisch-russische Ausrichtung nicht allein steuern. Doch Washington kann auch kein mögliches Konfliktpotenzial in Eurasien ignorieren, das aus dieser Ausrichtung erwächst. Amerikas Verbündete verändern ihre Beziehungen – ob Washington es akzeptiert oder nicht – in rasantem Tempo. Diese Netzwerke können den Interessen der USA nützen oder ihnen schaden, je nachdem, wie Amerika mit ihnen interagiert. Wenn die Vereinigten Staaten ihre Beziehungen zu den Partnern in Asien und Europa nicht neu gestalten, laufen sie Gefahr, am Rand einer sich rasch wandelnden Weltordnung zu stehen.
Quelle: https://www.foreignaffairs.com/united-states/new-eurasian-order-smith-ford