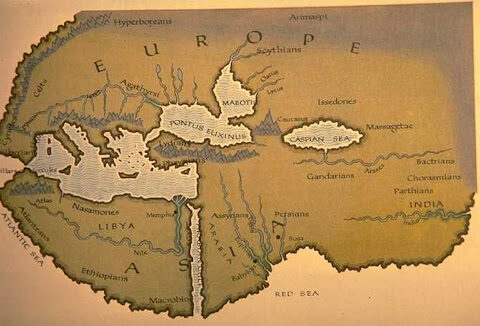Ursprünglich rief der Begriff Antisemitismus die Assoziation einer „Feindseligkeit gegenüber semitischen Völkern“ hervor. In seiner modernen Verwendung jedoch bezeichnet er fast ausschließlich den Hass und die Diskriminierung, die sich gegen Juden richten. Diese Bedeutungsverengung ist kein bloßer etymologischer Zufall, sondern das Ergebnis eines über Jahrhunderte gewachsenen Zusammenspiels religiöser Traditionen, demografischer Realitäten und politischer Transformationen Europas. Während Juden in der europäischen Geschichte als „innere Andere“ – im Zentrum des Rechtswesens, der städtischen Ökonomien und des Alltagslebens – präsent waren, wurden Muslime meist als „äußere Andere“ vorgestellt: als Gegenüber militärischer Rivalität oder als Objekt orientalischer Vorstellungen. Diese Asymmetrie führte dazu, dass der Begriff „Antisemitismus“ seine ursprüngliche semitische Weite verlor und sich auf Judenfeindlichkeit spezialisierte.
Der Begriff Antisemitismus entstand im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in Europa und hat sich bis heute fast weltweit als Bezeichnung für Vorurteile, Hass und Diskriminierung gegenüber Juden etabliert. Hinter dieser semantischen Festlegung stehen nicht nur sprachliche oder etymologische Gründe, sondern auch die soziopolitische Struktur, die demografischen Gegebenheiten und die historischen Erfahrungen Europas. Besonders das Fehlen einer nennenswerten muslimischen Bevölkerung bis in die Moderne hinein spielte eine indirekte, aber entscheidende Rolle dafür, dass „Antisemitismus“ ausschließlich mit Judenfeindlichkeit gleichgesetzt wurde.
Zwar lässt sich der Begriff ursprünglich als „Feindschaft gegenüber semitischen Völkern“ deuten, doch zwischen seiner sprachlichen Herkunft und seiner gesellschaftlichen Verwendung besteht eine deutliche Kluft. Der Ausdruck „semitisch“ entstand im 18. Jahrhundert als linguistische Klassifikation zur Bezeichnung von Sprachgruppen wie Arabisch, Hebräisch oder Amharisch. Mit dem Aufstieg der sogenannten „Rassenwissenschaft“ im 19. Jahrhundert wurden diese sprachlichen Kategorien jedoch in rassische überführt. Zwar sollte der Begriff „semitische Rasse“ theoretisch Araber, Juden und andere Völker des Nahen Ostens umfassen, doch im europäischen Kontext wurde das Wort „Semit“ fast vollständig mit „Jude“ gleichgesetzt.
Als Wilhelm Marr 1879 in seiner Broschüre Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum erstmals den Begriff „Antisemitismus“ verwendete, meinte er ausdrücklich die Juden. In jener Zeit wurden Juden, die in den urbanen Ökonomien sichtbar und einflussreich waren, durch soziale Eifersucht, nationale Homogenitätsvorstellungen und die Erschütterungen der Moderne zum ideologischen Ziel. „Antisemitismus“ wurde so von einem bloßen Vorurteil zu einer organisierten politischen Haltung.
Muslime hingegen waren in Westeuropa nach der Vertreibung aus Andalusien faktisch nicht mehr präsent; die muslimische Bevölkerung auf dem Balkan wurde in der europäischen Vorstellung nicht als zentrales gesellschaftliches Element, sondern als Randphänomen wahrgenommen. Der Orientalismus verfestigte diese Distanz. Während Muslime als zu „zivilisierende“ äußere Gesellschaften galten, wurden Juden als „innere, aber fremde“ Figuren diskutiert.
Die historischen Voraussetzungen dieser Bedeutungsverengung sind vielschichtig. Seit dem Mittelalter wurden Juden in Europa als innerer „Anderer“ der christlichen Theologie wahrgenommen. Das Christentum verstand sich als Fortsetzung und Überbietung des Judentums, weshalb Juden zugleich als „altes Volk Gottes“ und als „jene, die Christus ablehnten“ galten. Diese religiöse Erbschaft verankerte Misstrauen, Feindseligkeit und Ausgrenzung gegenüber Juden dauerhaft in der europäischen Kultur.
Juden nahmen eine besondere Position ein: Sie unterschieden sich durch ökonomische Funktionen (Geldverleih, Handel, Finanzen) und kulturelle Geschlossenheit, konnten jedoch nie vollständig ausgeschlossen werden. So wurden sie zum „inneren Anderen“ der europäischen Städte.
Muslime dagegen blieben über Jahrhunderte hinweg der „äußere Andere“. Nach dem Fall Andalusiens 1492 verschwand die muslimische Bevölkerung weitgehend aus Westeuropa. Zwar existierten im Osmanischen Reich und auf dem Balkan muslimische Gemeinschaften, doch sie gehörten nicht zum kulturellen Zentrum Europas, sondern zu dessen Peripherie. Daher fehlte in den europäischen Gesellschaften eine alltägliche Auseinandersetzung mit Muslimen; der Antimuslimismus blieb ein Ausdruck äußerer Rivalität, nicht innerer sozialer Spannung. Der Orientalismus verstärkte diesen Unterschied weiter: Muslime galten als rückständig, exotisch oder irrational, während Juden als Minderheit innerhalb der modernen europäischen Gesellschaft wahrgenommen wurden – bemüht um Assimilation, aber dennoch als fremd angesehen.
Diese historische und kulturelle Konstellation erklärt, warum „Antisemitismus“ in der modernen Welt zum Synonym für Judenfeindlichkeit wurde – ein Produkt der spezifisch europäischen Erfahrung, nicht eines universalen Begriffs.
Diese soziologische Differenz erwies sich auch auf begrifflicher Ebene als prägend.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts rückten die Juden als sichtbare Minderheit in den europäischen Städten ins Zentrum wirtschaftlicher Konkurrenz, nationaler Homogenitätsideale und sozialer Umbrüche. „Antisemitismus“ wurde in dieser Zeit nicht mehr nur als emotionales Vorurteil verstanden, sondern auch als Name einer ideologischen Bewegung. Antisemitische Parteien in Deutschland und Österreich verwandelten den Judenhass in eine rassenbasierte politische Doktrin. Gleichzeitig machte das Fehlen muslimischer Gemeinschaften in Europa eine Ausweitung des Begriffs im Sinne eines allgemeinen „Hasses auf semitische Völker“ faktisch unmöglich.
Der Zweite Weltkrieg fixierte diesen begrifflichen Prozess endgültig. Der von nationalsozialistischer Deutschland begangene Völkermord an den Juden schrieb den Antisemitismus als eine der dramatischsten Formen des Hasses in die Geschichte der Menschheit ein. In der Nachkriegszeit erhielt der Begriff nicht nur eine historische, sondern auch eine ethische und politische Dimension. In der Sprache internationaler Institutionen, der akademischen Welt und der Medien bezeichnete „Antisemitismus“ fortan ausschließlich den Hass auf Juden. Trotz seines „semitischen“ Ursprungs galt es als selbstverständlich, dass der Begriff weder Araber noch andere Völker einschließt.
Zur Festigung dieser Bedeutung trugen nicht nur historische Erfahrungen, sondern auch die kulturellen und rechtlichen Strukturen der Nachkriegszeit bei. Das Europa nach 1945 entwickelte ein besonderes moralisches Bewusstsein gegenüber dem Antisemitismus – aus dem Wunsch heraus, sich seiner eigenen Schuld zu stellen und eine neue ethische Ordnung zu schaffen. Der jüdische Holocaust galt als Endpunkt von Hass und Rassismus; dementsprechend wurde die Definition des Antisemitismus als spezifisch gegen Juden gerichtete Feindschaft auch von internationalen Institutionen normativ verankert. In den Dokumenten der Vereinten Nationen, der UNESCO und später des Europarats wurde der Begriff systematisch mit Judenfeindlichkeit gleichgesetzt. So erhielt die historische Verengung des Begriffs eine moralische Legitimation.
Der zahlenmäßig bedeutsame Zuzug muslimischer Bevölkerung nach Europa begann erst in den 1950er-Jahren mit den postkolonialen Migrationswellen. Algerier in Frankreich, Türken in Deutschland und Pakistaner im Vereinigten Königreich machten den Antimuslimismus zu einem neuen gesellschaftlichen Thema. Doch zu diesem Zeitpunkt war der Begriff „Antisemitismus“ längst unauflöslich mit den Juden verbunden. Für die Vorurteile und Feindseligkeiten gegenüber Muslimen setzte sich der Begriff „Islamophobie“ durch, womit beide Phänomene in getrennte begriffliche und historische Kategorien fielen.
Heute führt diese Trennung gelegentlich zu begrifflichen Debatten. Einige Forscher argumentieren, die ausschließliche Zuordnung des Antisemitismus zu den Juden habe die Sichtbarkeit von Rassismus gegenüber Arabern oder anderen semitischen Völkern geschwächt. Die meisten Historiker jedoch betonen, dass die spezifische Fokussierung auf Juden historisch unverzichtbar ist – denn der Begriff repräsentiert nicht einfach ein etymologisches Feld, sondern die inneren Traumata der modernen europäischen Geschichte.
Nach dem Holocaust wurde der Antisemitismus nicht nur als Form des Hasses verstanden, sondern auch als moralische Mahnung und als Symbol des kollektiven Gedächtnisses.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Dass der Begriff „Antisemitismus“ ausschließlich die Feindseligkeit gegenüber Juden bezeichnet, ist kein linguistischer Zufall, sondern das Ergebnis der spezifischen religiösen, demografischen und ideologischen Bedingungen der europäischen Geschichte.
Während Muslime in Europa weitgehend abwesend waren, wurden Juden zugleich als „innere Andere“ und als „Grenzfiguren der Moderne“ wahrgenommen – Faktoren, die den Bedeutungsgehalt des Begriffs entscheidend formten. In der Nachkriegszeit wurde diese Bedeutung ethisch wie politisch verfestigt: „Antisemitismus“ bezeichnete fortan normativ und historisch ausschließlich den Judenhass. Europas innere Dynamiken, sein religiöses Erbe, seine demografische Vergangenheit und das nach dem Holocaust entstandene Wertesystem haben den Begriff nicht nur auf Judenfeindlichkeit reduziert, sondern ihn auch zum Namen einer moralischen Selbstbelehrung der westlichen Zivilisation gemacht.