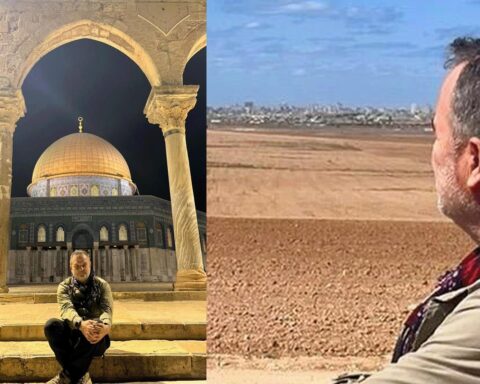I. Chile: Der bombardierte Palast, das widerständige Gedächtnis
Am Morgen des 11. September 1973 zerschnitten die Geräusche von Flugzeugen den Himmel über Santiago – und kündeten nicht nur von Bomben, die auf das Herz einer Hauptstadt gerichtet waren, sondern auch von einem Schlag gegen das Gedächtnis eines ganzen Volkes.
Der Angriff auf den Präsidentenpalast La Moneda war in Wahrheit die Zerstörung einer politischen Imagination, die von Gleichheit, Würde und Unabhängigkeit getragen war – verkörpert in der Person von Präsident Salvador Allende.
Was an jenem Tag in Chile geschah, war weit mehr als ein Machtwechsel: Es war die systematische Vernichtung eines kollektiven Gerechtigkeitsempfindens, der Hoffnung auf Freiheit und der historischen Selbstachtung eines Volkes.
Am Morgen des Putsches verkündeten Radiodurchsagen, das Land sei „befreit“ worden. Doch befreit wurde nicht die Volkssouveränität, sondern eine für koloniales Kapital neu geformte, fremdbestimmte Wirtschaftsordnung.
In den Rauchschwaden über La Moneda verbrannte das Recht Chiles auf Selbstbestimmung. Während Panzer durch die Straßen rollten, verstummten die Fabriken, Gewerkschaftsführer wurden verhaftet, Studierende verschwanden. Santiago verwandelte sich binnen eines Tages von einer „befreiten Hauptstadt“ in einen lautlosen Friedhof.
In seiner letzten Ansprache sagte Allende: „In dieser Etappe der Geschichte lassen sich die Prozesse der Völker nicht aufhalten.“
Dieser Satz war kein bloßer Abschied, keine tröstende Floskel – er war eine politische Metaphysik, eingebrannt in den jahrhundertelangen Freiheitskampf Lateinamerikas.
Denn auch wenn Allendes Stimme im Donner der Bomben unterging, hallte sie über den Kontinent wider: „Die Idee der Gleichheit kann nicht getötet werden.“
Aus diesem Satz erwuchs ein ontologisches Prinzip des Widerstands – ein Glaube daran, dass selbst aus der Asche historischer Gewalt die menschliche Würde neu erstehen kann.
II. Die letzte Rede eines Präsidenten: Die Anatomie der Würde in La Moneda
Allendes letzte Ansprache war keine politische Rede im herkömmlichen Sinn; sie war das ethische Manifest eines Menschen, der den Tod in Kauf nahm, um dem Leben einen neuen Sinn zu geben.
Seine Worte hallen nicht im Dunkel der Niederlage, sondern in der Klarheit des Bewusstseins.
Der Sprechende ist nicht bloß ein Politiker, sondern ein Repräsentant der Menschlichkeit – kein besiegter Führer, sondern ein Wesen, das seine Würde selbst am Rand des Todes bewahrt.
Allendes Tod erscheint auf den ersten Blick wie ein Selbstmord, war im Innersten jedoch keine Kapitulation, sondern ein Akt des bewussten Widerstands – eine tragische Verteidigung der Würde gegen den Nihilismus der Moderne.
Wie die Helden der antiken Tragödie trat er wissend auf die Bühne, dass der Tod unausweichlich war.
Denn er wusste: Die Tragödie ist nicht nur das Spiel des Schicksals, sondern der Ort, an dem menschlicher Wille und Bedeutung einander begegnen.
Als er sagte „Ich werde hierbleiben“, verteidigte er nicht einen Ort, sondern ein Prinzip:
„Wenn hier der Wille meines Volkes zerstört wird, dann muss auch ich hierbleiben.“
Als La Moneda unter Bomben einstürzte, fiel nicht nur ein Gebäude – mit ihm zerbrach auch der zentrale Anspruch des modernen Staates: „Der Staat schützt sein Volk.“
In diesem Moment der Zerstörung wurde Allende zum letzten Präsidenten, der den Staat an sein Volk zurückgeben wollte.
Heute ist La Moneda wiederaufgebaut, die Fassade frisch geweißelt.
Doch in seinen Mauern haftet noch immer ein Brandgeruch: der Geruch der Geschichte.
Und dieser Geruch ist nicht nur Asche der Vergangenheit – er ist das unversehrte Herz von Würde, politischer Loyalität und dem Glauben an Gerechtigkeit.
III. Washingtons langer Schatten: CIA, Konzerne und der ökonomische Putsch des Kalten Krieges
Das Dröhnen der Flugzeuge am Morgen des 11. September 1973 war nicht nur das Echo des chilenischen Militärs, sondern auch der Klang einer dunklen Bürokratie in Washington.
Die Bomben, die auf La Moneda fielen, waren das letzte Kapitel eines Drehbuchs, das in CIA-Büros, in anonymen Memoranden und in den Randnotizen geheimer Sitzungen verfasst worden war.
Der Codename dieses Drehbuchs: Project FUBELT – operativ bekannt als Track II.
Enthüllte Dokumente zeigen, dass der chilenische Putsch kein spontaner Militärakt war, sondern ein kalt kalkuliertes Projekt politischer Ingenieurskunst.
Die Lateinamerika-Abteilung der CIA entwickelte eine dreigleisige Strategie zur Beseitigung der Allende-Regierung: wirtschaftliche Sabotage, politische Isolation und militärische Koordination.
Der Befehl „Make the economy scream“ – „Lasst die Wirtschaft schreien“ – wurde in den Protokollen des Weißen Hauses persönlich von Nixon gegeben.
Dieses Diktum markierte nicht nur den Beginn eines Angriffs auf Chile, sondern die Geburtsstunde eines neoliberalen Labors, das bald den gesamten Kontinent prägen sollte.
Henry Kissingers Worte fassen die moralische Schizophrenie des Kalten Krieges in brutaler Klarheit zusammen:
„Wenn das Volk eines Landes aus eigener Verantwortung den Kommunismus wählt, ist das ein Problem, das wir nicht akzeptieren können.“
Diese Aussage war das ideologische Manifest einer Epoche, in der Demokratie nur dann als legitim galt, wenn sie mit den Interessen Washingtons übereinstimmte.
Der Putsch in Chile war somit nicht bloß eine militärische Intervention, sondern die Generalprobe einer finanziellen Besetzung.
Bald ersetzten die Chicago Boys die Panzer, und die durch Bomben zerstörte gesellschaftliche Struktur wurde von der unsichtbaren Hand neoliberaler Reformen neu geformt.
Diese unter der Aufsicht Milton Friedmans an der Universität Chicago ausgebildeten Technokraten machten Chile zum ersten Versuchsfeld des freien Marktes.
Privatisierungen, Zerschlagung der Gewerkschaften und Demontage sozialer Sicherungssysteme eröffneten eine Ära der „experimentellen Modernisierung“ Lateinamerikas – und schufen das erste reale Labor des globalen Neoliberalismus.
Allendes Tod war damit nicht nur das Ende eines Menschen, sondern das Ende des Glaubens, dass eine andere Welt möglich ist.
Doch zugleich hinterließ er eine Frage, die bis heute nachhallt:
Wenn die Freiheit dem Markt überlassen wird – wem gehört dann das Volk?
Die Hinterzimmer eines Putsches: Project FUBELT
In den 1990er-Jahren freigegebene US-Archivdokumente bewiesen, dass der chilenische Putsch keine spontane „militärische Reaktion“ war, sondern eine systematisch geplante Operation.
Der Codename: Project FUBELT.
Im Rahmen dieses Projekts entwickelte die Lateinamerika-Abteilung der CIA eine dreigleisige Strategie, um die Regierung Allende zu stürzen:
Wirtschaftliche Sabotage: Stilllegung amerikanischer Investitionen, Unterbrechung der Kreditlinien, Blockade des Kupferexports.
Politische Isolation: Stigmatisierung Chiles auf internationalen Plattformen als „kommunistische Bedrohung“.
Militärische Koordination: Direkte Kontakte zu hochrangigen Offizieren des chilenischen Militärs und logistische Unterstützung.
Henry Kissingers berüchtigte Aussage aus jener Zeit brachte die moralische Grundlage dieser Strategie auf den Punkt:
„Wenn das Volk eines Landes aus eigener Verantwortung den Kommunismus wählt, ist das ein Problem, das wir nicht akzeptieren können.“
Dieser Satz entlarvt die Heuchelei des Kalten Krieges:
Demokratie galt nur so lange als legitim, wie sie mit Washingtons Interessen vereinbar war.
Unternehmen, Kapital und die Ökonomie des Putsches
Chile verfügte in jenen Jahren über eine der größten Kupferreserven der Welt.
Diese strategische Ressource lag in den Händen amerikanischer Bergbaukonzerne wie Anaconda Copper und Kennecott.
Als Allende 1971 diese Unternehmen verstaatlichte, schrillten in Washington die Alarmglocken.
Kupfer war das Rückgrat der chilenischen Wirtschaft – und zugleich ein unverzichtbarer Rohstoff für die US-Industrie.
Zur selben Zeit kontrollierte ITT (International Telephone and Telegraph) die Telekommunikationsinfrastruktur Santiagos.
Die ITT-Führung hielt geheime Treffen mit CIA-Vertretern ab und stellte Millionen Dollar zur Verfügung, um Allende zu stürzen.
In einem internen ITT-Memo war zu lesen:
„Allende hat die Wahl gewonnen, aber das bedeutet nicht, dass wir dieses Land verlieren müssen.“
Dies war die neue Form wirtschaftlicher Kolonisierung:
Statt Panzern agierten Börsen, statt Generälen Unternehmenslobbys.
Der chilenische Putsch war somit nicht nur eine militärische, sondern auch eine finanzielle Invasion.
Die Doktrin „Zerstöre die Wirtschaft, gewinne das Volk“
Die CIA-Strategie für Chile zu Beginn der 1970er Jahre wurde in den folgenden Jahrzehnten in vielen lateinamerikanischen Ländern wiederholt.
Ihr Kern ließ sich in einem Satz zusammenfassen:
„Bring die Wirtschaft zum Einsturz – und das Volk wird die Generäle als Retter begrüßen.“
Die künstlich angeheizte Inflation, die Blockade internationaler Kredite und die gezielte Förderung von Streiks durch Unternehmer schufen die Voraussetzungen für den Putsch.
Die Lkw-Streiks von Santiago, eines der sichtbarsten Elemente dieser Sabotage, wurden direkt von der CIA organisiert.
Laut später veröffentlichten Washington Post-Dokumenten flossen über 8 Millionen Dollar an die Organisatoren.
Die Chicago Boys: Die neue koloniale Ökonomie
Unmittelbar nach dem Putsch rief das Regime chilenische Ökonomen zurück, die an der Universität Chicago unter Milton Friedman studiert hatten.
Sie nannten sich selbst die Chicago Boys.
Diese Gruppe präsentierte die freie Marktwirtschaft als „wissenschaftliche Erlösung“ und transformierte die chilenische Ökonomie radikal.
Staatliche Unternehmen wurden privatisiert, Bildung und Gesundheit marktförmig organisiert, Gewerkschaften verboten.
Ende der 1970er Jahre war Chile das erste „Experimentierfeld des Neoliberalismus“.
Für das globale Kapital war dies nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern ein Prototyp.
Im Schatten der Diktatur wurde die Geburt einer neuen Wirtschaftsordnung gefeiert.
IV. Neoliberales Paradies, gesellschaftliche Hölle: Pinochets Labor
Das Regime Pinochets brachte ein Land militärisch zum Schweigen – und formte es zugleich ökonomisch neu.
Während Panzer auf den Straßen für Ruhe sorgten, feierten die Börsen „Stabilität“.
In den Gefängnissen hallten Schreie, während die Schuldenindikatoren „Erholung“ signalisierten.
Aus diesem Widerspruch entstand die grausamste Ironie der Moderne: das neoliberale Paradies.
Das Werkzeug dieses „Paradieses“ war nicht die Waffe, sondern der Markt.
Der Rückzug des Staates aus der Wirtschaft bedeutete in Wahrheit den Rückzug des Lebens aus den Händen des Volkes.
Löhne wurden eingefroren, Bildung und Gesundheit privatisiert, Gewerkschaften zerschlagen.
Unter dem Banner der „wirtschaftlichen Freiheit“ wurde gesellschaftliche Knechtschaft institutionalisiert.
Die Gesellschaft zerfiel in isolierte Individuen; das Individuum wurde zum Konsumenten, der Konsument vergaß, Bürger zu sein.
Pinochets „Neues Chile“ war eine marktwirtschaftliche Utopie, gebaut durch Gehorsamstechnik.
In diesem Labor war der menschliche Körper das stumme Opfer des Experiments.
Zwischen 1973 und 1990 wurden rund 3.200 Menschen getötet oder verschwanden, über 28.000 gefoltert, Zehntausende ins Exil gezwungen.
Diese Zahlen sind keine Statistik – sie sind unterbrochene Lieder, ungeschriebene Bücher, gestohlene Kindheiten.
Arbeiter wurden als „Bedrohung“, Gewerkschafter als „Kommunisten“, Studierende als „Anarchisten“ gebrandmarkt.
Frauen – insbesondere die Madres de los Desaparecidos – wurden zu Trägerinnen des kollektiven Gedächtnisses.
Während die Männer verstummt waren, trugen die Frauen ihre Fotos durch die Straßen und wurden zum Gewissen einer Nation.
Ihr stiller Widerstand wurde zum menschlichen Echo des kalten Wortes „Modernisierung“.
Doch die Kultur überlebte im Untergrund des chilenischen Herzens.
Víctor Jara’s Te Recuerdo Amanda wurde in den Zellen geflüstert,
Isabel Allende’s Das Geisterhaus trug die Stimmen der Verschwundenen in die Literatur,
Ariel Dorfman zeigte in Der Tod und das Mädchen das aufgeschobene Gesicht der Gerechtigkeit.
Diese Werke waren nicht bloß Kunst – sie waren ontologische Zeugnisse des Traumas, pulsierende Arterien des kollektiven Gedächtnisses.
Während neoliberale Reformen Chile in den IMF-Berichten zur „Erfolgsgeschichte“ machten, löste sich das soziale Gefüge wie das Nervensystem eines Labortiers auf.
Netzwerke der Solidarität zerbrachen, das öffentliche Gedächtnis wurde privatisiert, die ethische Sprache durch Finanzjargon ersetzt.
„Effizienz“ wurde zur neuen Religion; der Markt ersetzte Gott, und an die Stelle der Schlachthäuser traten die Börsen.
Rückblickend ist die Ära Pinochet nicht nur das Kapitel einer Diktatur,
sondern eines der ersten großen Siege des globalen Neoliberalismus –
ein Sieg, der zugleich den gesellschaftlichen Zerfall des Menschen beschleunigte.
Denn dieses Paradies war in Wahrheit eine gesellschaftliche Hölle,
in der Tausende Leben dem Gott des Marktes geopfert wurden –
und ihre Asche brennt noch immer leise.
VI. Im Spiegel Lateinamerikas: Chile – Kollektives Gedächtnis, Ökonomische Gewalt und die Kultur der Gerechtigkeit
Der Putsch in Chile 1973 erschütterte nicht nur das demokratische Gedächtnis eines Landes, sondern die gesamte zivilisatorische Vorstellung des Kontinents. Denn dieser Putsch war weder ein plötzlich hereinbrechender Morgennebel noch allein auf Pinochets kalte Befehle beschränkt. Dahinter stand ein grenzüberschreitender Mechanismus: Operación Cóndor, ein Geheimdienstnetzwerk, das die Diktaturen Südamerikas zu einem einzigen tödlichen System verband – eine unsichtbare Maschine.
Operación Cóndor: Ein Kontinentalnetz des Schweigens
Geheime Gründung 1975 in Santiago:
Chile, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Brasilien und Bolivien koordinierten unter einem gemeinsamen Ziel:
„Opposition über Grenzen hinweg auslöschen.“
Die Militärputsche waren keine isolierten Ereignisse, sondern Bestandteile eines regionalen Gewaltökosystems.
Die Datenströme von Cóndor wurden von CIA und DIA bereitgestellt, lokale Geheimdienste trugen Oppositionelle in gemeinsame schwarze Listen ein. Wer auf diesen Listen stand, verschwand – egal ob in Buenos Aires, Montevideo oder Washington DC.
Einige wurden in Autos in Buenos Aires exekutiert, andere bei „Flugoperationen“ ins Meer geworfen. Diese systematische Kette von Morden internationalisierte staatliches Verbrechen. Historiker schätzen, dass Cóndor für über 60.000 Verhaftungen und knapp 20.000 Morde verantwortlich sein könnte. Diese Zahlen sind nicht nur Gewaltbilanz, sondern statistische Spuren des ethischen Zusammenbruchs von Nationalstaaten.
Nunca Más: Das institutionalisierte Gewissen
Als der Schleier des Kalten Krieges sich hob, sprach in Lateinamerika erstmals die Wahrheit gegen den Staat.
Der 1984 veröffentlichte Bericht Nunca Más („Nie wieder“)“ in Argentinien war ein kraftvoller Schlag gegen die Stille.
Die CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) dokumentierte über 9.000 Opfer, kartographierte Folterzentren und Militärbefehlsketten.
Wichtiger noch: Der Bericht verwandelte den Satz
„Der Staat hat kein Recht zu vergessen“
in ein historisches Prinzip.
Nunca Más war mehr als ein Bericht – es war ein ethisches Manifest.
Von Argentinien bis Chile, von Uruguay bis Guatemala breitete sich dieses Bewusstsein aus: Lateinamerika wurde zum Kontinent des Erinnerns, nicht der Vergessenheit.
In Chile waren Comisión Rettig (1991) und Comisión Valech (2004) direkte Erben dieser Inspiration.
Der Rettig-Bericht dokumentierte 2.279 Todesfälle, der Valech-Bericht über 28.000 Fälle von Folter – ein Zittern der Erinnerung aus der Stille, hartnäckig und beharrlich.
Gewaltgeborene Ökonomie
Pinochets Vision des „Neuen Chile“ wurde im Schatten der Waffen geschrieben.
1974 verabschiedetes Programa de Recuperación Económica: Staat schrumpft, Markt wächst, Volk schweigt.
Entworfen von den Chicago Boys und unter Milton Friedmans historischem Besuch gesegnet, wurde Chile zum „wundersamen Labor der freien Marktwirtschaft“ – während tausende Menschen in den Hinterhöfen verschwanden.
Ökonomische Erfolgskurven stiegen auf blutgetränkten Pfeilen. Pinochets Neoliberalismus war mehr als ein Modell – er war Gehorsamsengineering. Gesellschaft fragmentierte, das Individuum wurde zum Konsumenten, der Konsument vergass Bürger zu sein.
Das künstliche Paradies: Mythos ökonomischer Wunder
Anfang der 1980er geriet Chiles Wirtschaft in die Wirbel der Auslandsschuldenkrise.
Das als „neoliberales Wunder“ präsentierte Modell begann unter eigenen Widersprüchen zu zerbrechen.
Die feste Wechselkurspolitik 1979 und die finanzielle Liberalisierung erzeugten eine fragile Wirtschaft, abhängig von kurzfristigen Kapitalströmen.
1982 traf die lateinamerikanische Schuldenkrise auch Chile: Hunderte Banken pleite, Arbeitslosigkeit bei ~30 %, Reallöhne halbiert.
Die „unsichtbare Hand des Marktes“ wurde spürbarer Schmerz im Magen der Arbeitslosen.
Darauf reagierte Pinochets Regime mit den Rezepten internationaler Finanzinstitutionen.
IMF und Weltbank erzwangen neue Kredite gegen Strukturanpassungsprogramme: Privatisierung, Deregulierung, Abbau öffentlicher Dienstleistungen, endgültige Schwächung des Sozialstaates.
Chile verwaltete nun nicht mehr seine eigene Wirtschaft, sondern die globale Kapitaldisziplin.
Unabhängigkeit verschwand in den Fußnoten internationaler Kreditdokumente.
Die westlichen Medien präsentierten das anders: Chile glänzte in The Economist und Financial Times als „ökonomisches Wunder Lateinamerikas“.
Dieses „Wunder“ war ein Tempel ohne Gerechtigkeit, ohne Ehre, ohne Gleichheit.
Während Indikatoren stiegen, verfiel die soziale Struktur still.
Die Einkommensschere vertiefte sich: Die reichsten 10 % erhielten fast die Hälfte des nationalen Einkommens, die ärmsten 50 % unter 15 %.
Bildung wurde privatisiert, Wissen ein Marktprodukt, Gesundheitssystem auf Profit ausgerichtet.
Ein Arztbesuch entsprach dem Wochenlohn eines Arbeiters. Wohnrecht wurde zu „Bodenwert“, Gerechtigkeit zu „wirtschaftlichem Zugang“.
Staatsabbau bedeutete soziale Isolation.
„Freiheit“ war Rhetorik für soziale Entfesselung.
Selbst menschliche Beziehungen wurden marktfähig. „Wahlfreiheit“ hallte wider zwischen Hunger, Schulden und Verzweiflung.
Chile individualisierte sich, der kollektive Zusammenhalt erodierte wie langanhaltende Dürre den Boden.
Wenn Chile ein Labor war, wurde das Volk zum Versuchstier.
Sozialwissenschaftler nennen dies „menschenloses Wachstum“: Wirtschaft wächst, Mensch schrumpft; Statistik glänzt, Erinnerung verdunkelt sich.
Das neoliberale Wunder war der technische Name einer ethischen Katastrophe.
VII. Der Schatten der Gerechtigkeit: General in London 1998 festgenommen
An einem kalten Morgen 1998 erschütterte eine unerwartete Stille die Weltpolitik.
Augusto Pinochet, 82 Jahre alt, wurde in London wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgenommen.
Dies war mehr als die Festnahme eines Generals – es war der Moment, in dem die Geschichte ihrem eigenen Schatten begegnete.
Die Festnahme beruhte auf der Klage des spanischen Richters Baltasar Garzón.
Er argumentierte auf Basis des Prinzip der universellen Jurisdiktion, dass Pinochet für Verbrechen gegen Bürger in Argentinien, Chile, Uruguay und Spanien international vor Gericht gestellt werden könne.
Dieser mutige Schritt erschütterte das traditionelle internationale Recht, das auf der Immunität von Staatsoberhäuptern basierte.
Souveränität war nun kein Schutzschild mehr, sondern ein überprüfbares historisches Privileg.
London: Gerichtsbühne und Theater der Erinnerung
Pinochet war nach einer Operation im The Clinic-Hospital in London.
Als die Polizei den Haftbefehl um Mitternacht zustellte, war die Kamera abwesend; diesmal wurde nicht das Volk, sondern der General zum Schweigen gebracht.
Das Foto des alten Mannes im Rollstuhl, den Kopf gesenkt, fasste die Ironie eines ganzen Jahrhunderts zusammen: Der Architekt der Angst fürchtete nun seinen eigenen Schatten.
Die demokratisierte chilenische Regierung war gleichermaßen überrascht und beunruhigt.
Pinochets Immunität bestand formal, doch im Gewissen war sie längst aufgehoben.
Die Londoner Festnahme war mehr als ein juristischer Akt – sie internationalisierte Erinnerung.
Zum ersten Mal wurde ein Diktator nicht in seinem eigenen Land, sondern vor dem Gericht der Menschheit verhandelt.
Der langsame Triumph der Gerechtigkeit
Der juristische Prozess in England dauerte zwei Jahre.
Das House of Lords bestätigte die Entscheidung von Innenminister Jack Straw, Pinochets Auslieferung zu erlauben.
Doch aus gesundheitlichen Gründen durfte er 2000 nach Chile zurückkehren – erneut warf der „Schatten des Vergessens“ sein Licht auf die Gerechtigkeit.
Ab diesem Moment war nichts mehr wie zuvor.
Bei seiner Rückkehr empfing ihn am Flughafen eine gemischte Menge: Einige applaudierten, andere weinten.
Dieses Bild symbolisierte nicht die Macht des Regimes, sondern den Zusammenbruch des Gewissens.
Pinochet starb 2006 unter Hausarrest, ohne Verurteilung oder Freispruch – nur das Echo einer Geschichte, die keine Antwort erhielt.
Die Gerechtigkeit des Gedächtnisses
Der Pinochet-Fall markierte die Geburt eines neuen Konzepts im internationalen Recht: „universelles Gedächtnis“.
Gerechtigkeit wird nun nicht nur in Gerichten, sondern auch im kollektiven Bewusstsein gesucht.
In Chile führten daraufhin ab den 2000er-Jahren aufeinanderfolgende Verfahren zur Anklage von über 1.300 Soldaten.
Viele Verbrechen waren verjährt, doch das Gedächtnis kennt keine Verjährung.
Pinochets Festnahme war kein Ende, sondern ein ethischer Anfang.
Gerechtigkeit konnte ihn nicht einsperren, doch sie fügte der Sprache der Geschichte ein neues Wort hinzu: Rechenschaftspflicht.
Wie einige Philosophen sagen:
„Gerechtigkeit bedeutet manchmal nicht die Bestrafung des Täters, sondern das Aufrechtstehen des Zeugen.“
Und das chilenische Volk ist der lebendige Körper dieses Zeugnisses.
Unter dem Schatten der Gerechtigkeit: Eine neue Morgendämmerung
Heute sind in Santiagos Straßen Allendes Gesicht noch blassblau gemalt; daneben steht in kleinen Buchstaben:
„Vergessen ist ein Luxus.“
Pinochets Traum vom „neoliberalen Paradies“ ist nur noch eine Fußnote der Geschichte.
Doch im Gedächtnis des Volkes lebt sein Schatten weiter, denn der Schatten der Gerechtigkeit ist das am längsten leuchtende Licht.
Und dieses Licht hallt von den chilenischen Anden bis zu den Straßen von Valparaíso:
„Man kann die Geschichte eines Volkes nicht bombardieren.“
Denn am Ende spricht die Geschichte mit der Sprache der Gerechtigkeit.