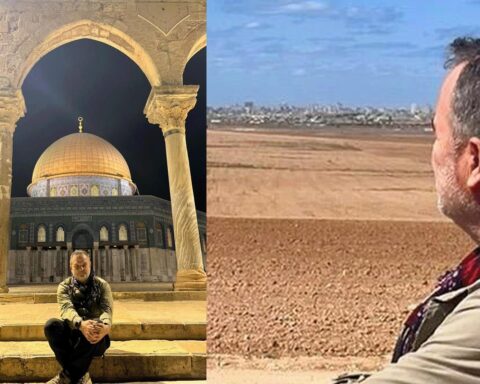Welche Art von Wandel steht dem Iran bevor?
Zum ersten Mal seit fast vier Jahrzehnten steht der Iran an der Schwelle zu einem Führungswechsel – und vielleicht sogar zu einem Regimewechsel. Während die Herrschaft des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei sich ihrem Ende nähert, legte ein zwölftägiger Krieg im Juni die Zerbrechlichkeit des von ihm geschaffenen Systems offen. Israel bombardierte iranische Städte und Militäranlagen, woraufhin die Vereinigten Staaten 14 bunkerbrechende Bomben auf iranische Nuklearanlagen abwarfen. Der Krieg enthüllte die enorme Kluft zwischen Teherans ideologischer Rhetorik und den begrenzten Fähigkeiten eines Regimes, das einen Großteil seiner regionalen Macht verloren hat, seinen Luftraum nicht mehr kontrolliert und nur noch eingeschränkte Kontrolle über seine Straßen ausübt. Am Ende des Krieges trat der 86-jährige Khamenei aus seinem Versteck hervor, um mit heiserer Stimme den Sieg zu verkünden – ein Schauspiel, das Stärke ausstrahlen sollte, stattdessen jedoch die Schwäche des Regimes offenbarte.
Im Herbst der Ajatollahs stellt sich die zentrale Frage, ob das theokratische Regime, das Khamenei seit 1989 führt, fortbestehen, sich wandeln oder zusammenbrechen wird – und welche politische Ordnung an seine Stelle treten könnte. Die Revolution von 1979 verwandelte den Iran von einer westlich orientierten Monarchie in eine islamistische Theokratie – und machte ihn über Nacht von einem amerikanischen Verbündeten zu einem erklärten Feind. Da der Iran auch heute noch ein Schlüsselstaat ist – eine Energiemacht, deren innenpolitische Dynamik die Sicherheits- und politische Ordnung des Nahen Ostens beeinflusst und weltweit ausstrahlt –, hat die Frage, wer (oder was) Khamenei nachfolgen wird, enorme Bedeutung.
In den vergangenen zwei Jahren – seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, den Khamenei als einziger unter den großen Weltführern offen unterstützte – ist sein Lebenswerk durch Israel und die Vereinigten Staaten in Schutt und Asche gelegt worden. Seine engsten militärischen und politischen Vertrauten wurden getötet oder ermordet. Seine regionalen Stellvertreter sind geschwächt. Sein riesiges Atomprogramm, das die iranische Wirtschaft unermesslich belastet hat, liegt unter Trümmern begraben.
Die Islamische Republik versucht, ihre militärische Demütigung in eine Gelegenheit zu verwandeln, das Land unter der Flagge der Einheit zu sammeln. Doch die alltäglichen Entbehrungen lassen sich nicht übersehen. Die 92 Millionen Menschen im Iran bilden die größte Bevölkerung der Welt, die seit Jahrzehnten vom globalen Finanz- und politischen System isoliert ist. Die iranische Wirtschaft gehört zu den am stärksten sanktionierten der Welt. Seine Währung zählt zu den am meisten entwerteten. Sein Pass ist einer der meistabgelehnten. Sein Internet ist eines der am stärksten zensierten. Und seine Luft gehört zu den am meisten verschmutzten.
Die beständigen Parolen des Regimes – „Tod Amerika“ und „Tod Israel“, aber niemals „Lang lebe Iran“ – machen deutlich, dass seine Priorität der Trotz ist, nicht die Entwicklung. Stromausfälle und Wasserrationierungen sind Teil des Alltags geworden. Eines der zentralen Symbole der Revolution – der verpflichtende Hijab, den Ayatollah Ruhollah Khomeini, der erste Oberste Führer der Islamischen Republik, einst als „Fahne der Revolution“ bezeichnete – ist zerrissen, da immer mehr Frauen sich offen weigern, ihr Haar zu bedecken. Irans vermeintliche Patriarchen können die Frauen des Landes ebenso wenig kontrollieren wie seinen Luftraum.
Um zu verstehen, wie der Iran an diesen Punkt gelangt ist, muss man die Leitprinzipien von Khameneis 36-jähriger Herrschaft betrachten. Seine Amtszeit ruhte auf zwei Säulen: unerschütterlicher Loyalität gegenüber den revolutionären Prinzipien im In- und Ausland sowie der kategorischen Ablehnung politischer Reformen. Khamenei war stets überzeugt, dass eine Verwässerung der Ideale und Vorschriften der Islamischen Republik dasselbe Schicksal herbeiführen würde wie Gorbatschows Glasnost für die Sowjetunion – nämlich ihren Zusammenbruch, nicht ihre Erneuerung. Ebenso unbeirrt blieb Khamenei in seiner Ablehnung einer Normalisierung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten.
Khameneis Alter, seine Unnachgiebigkeit und sein bevorstehender Abschied haben Iran in einem Schwebezustand zwischen langem Verfall und plötzlichem Umbruch zurückgelassen. Sobald Khamenei nicht mehr da ist, zeichnen sich mehrere mögliche Zukünfte ab. Die totalitäre Ideologie der Islamischen Republik könnte in den zynischen Machtstil eines starken Mannes übergehen, wie er das postsowjetische Russland prägt. Wie China nach dem Tod Mao Zedongs könnte Iran eine Neujustierung vornehmen, indem es starre Ideologie durch pragmatisches nationales Interesse ersetzt. Es könnte sich auch – wie Nordkorea seit Jahrzehnten – auf Repression und Isolation zurückziehen. Die geistliche Herrschaft könnte einer militärischen Dominanz weichen, wie es in Pakistan der Fall war. Und obwohl zunehmend unwahrscheinlich, könnte Iran sich doch in Richtung einer repräsentativen Regierung bewegen – ein Kampf, der bis zur Verfassungsrevolution von 1906 zurückreicht. Irans Weg wird einzigartig sein, und sein Verlauf wird nicht nur das Leben der Iraner, sondern auch die Stabilität des Nahen Ostens und der globalen Ordnung prägen.
DER PARANOIDE STIL
Iraner sehen sich oft als Erben eines großen Imperiums, doch ihre moderne Geschichte ist von wiederholten Invasionen, Demütigungen und Verrat geprägt. Im 19. Jahrhundert verlor Iran fast die Hälfte seines Territoriums an räuberische Nachbarn, gab den Kaukasus (das heutige Armenien, Aserbaidschan, Georgien und Dagestan) an Russland ab und musste unter britischem Druck Herat an Afghanistan abtreten. Anfang des 20. Jahrhunderts teilten Russland und Großbritannien das Land in Einflusszonen auf. 1946 besetzten sowjetische Truppen den iranischen Teil Aserbaidschans und versuchten, ihn zu annektieren. 1953 organisierten das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten einen Putsch, der Premierminister Mohammad Mossadegh stürzte.
Dieses Erbe hat Generationen iranischer Herrscher hervorgebracht, die überall Verschwörungen wittern und selbst ihre engsten Berater verdächtigen, ausländische Agenten zu sein. Reza Schah, der Gründer der Pahlavi-Dynastie – von vielen Iranern bis heute verehrt – wurde während des Zweiten Weltkriegs von den Alliierten zum Rücktritt gezwungen, da man ihm eine Nähe zu Nazi-Deutschland nachsagte. Er war, so sein Berater Abdolhossein Teymourtash, „misstrauisch gegenüber jedem und allem“. „Es gab wirklich niemanden im ganzen Land, dem Seine Majestät vertraute.“ Sein Sohn Mohammed Reza Schah empfand ähnlich. „Falsche amerikanische Versprechen haben mich meinen Thron gekostet“, stellte er nach der Revolution von 1979 fest. Nach seiner Machtübernahme ließ Ajatollah Khomeini Tausende Gegner hinrichten – wegen angeblicher Verbindungen zu ausländischen Mächten; sein Nachfolger Khamenei würzt nahezu jede Rede mit Anspielungen auf amerikanische und zionistische Komplotte.
Dieses tiefe Misstrauen beschränkt sich nicht auf die Eliten, sondern durchzieht den gesamten politischen Körper. Iraj Pezeshkzads Roman Mein Onkel Napoleon – später 1976 als ikonische Fernsehserie adaptiert – verspottet einen paranoiden Familienpatriarchen, der überall ausländische Intrigen, insbesondere britische, vermutet. Das Werk ist bis heute ein kultureller Bezugspunkt und spiegelt die verschwörerische Denkweise wider, die Irans Politik und Gesellschaft weiterhin prägt. Eine World Values Survey von 2020 ergab, dass weniger als 15 Prozent der Iraner glauben, „dass man den meisten Menschen vertrauen kann“ – einer der niedrigsten Werte weltweit.
Im iranischen paranoiden Stil werden Außenseiter als Raubtiere dargestellt, Insider als Verräter, und Institutionen beugen sich persönlicher Herrschaft. Im vergangenen Jahrhundert haben nur vier Männer das Land regiert; Personenkulte ersetzten stabile Institutionen, und die Politik schwankte zwischen kurzen Phasen der Euphorie und langen Jahren der Ernüchterung. Die Islamische Republik hat dieses Muster verschärft, indem sie ihre Bürger offiziell in „Insider“ und „Außenseiter“ unterteilt. In einem solchen Klima des Misstrauens herrscht negative Auslese: Mittelmäßigkeit wird belohnt, Unauffälligkeit befördert, Loyalität über Kompetenz gestellt. Khameneis Aufstieg im Jahr 1989 war ein Paradebeispiel für diese Dynamik, und die gleichen Kriterien dürften auch seine Nachfolgeregelung bestimmen. Diese tief verwurzelte Kultur des Misstrauens – durch Geschichte geprägt, von Herrschern verstärkt und von der Gesellschaft verinnerlicht – perpetuiert nicht nur autoritäre Herrschaft, sondern behindert auch die kollektive Organisation, die für eine repräsentative Regierung nötig wäre. Sie wird weiterhin einen langen Schatten über Irans Zukunft werfen.
Autoritäre Übergänge folgen selten einem festen Drehbuch, und Irans wird keine Ausnahme sein. Der Tod oder die Handlungsunfähigkeit Khameneis wäre der offensichtlichste Auslöser für Veränderung. Äußere Schocks – ein Einbruch der Ölpreise, verschärfte Sanktionen, erneute militärische Angriffe Israels oder der USA – könnten das Regime zusätzlich destabilisieren. Doch die Geschichte zeigt, dass auch unerwartete interne Funken – eine Naturkatastrophe, die Selbstverbrennung eines Obstverkäufers, der Tod einer jungen Frau wegen „zu offenem“ Haar – ebenso folgenreich sein können.
Fast fünf Jahrzehnte lang wurde Iran von Ideologie regiert; seine Zukunft jedoch wird von Logistik abhängen – vor allem davon, wer ein Land fast fünfmal so groß wie Deutschland mit riesigen Ressourcen, aber ebenso großen Herausforderungen am effektivsten führen kann. Aus dieser Unbeständigkeit könnten verschiedene Ordnungen nach Khamenei entstehen: nationalistische Diktatur, klerikale Kontinuität, militärische Dominanz, populistische Wiederbelebung oder eine einzigartige Mischform. Diese Möglichkeiten spiegeln Irans Fraktionalismus wider. Die Geistlichen wollen die Ideologie der Islamischen Republik bewahren. Die Revolutionsgarden (IRGC) wollen ihre Macht festigen. Entrechtete Bürger, einschließlich ethnischer Minderheiten, fordern Würde und Chancen. Die Opposition ist zu zersplittert, um sich zu vereinen, aber zu hartnäckig, um zu verschwinden. Keine dieser Gruppen ist monolithisch – doch ihre Ambitionen und Handlungen werden den Kampf darüber bestimmen, was für ein Land Iran in Zukunft sein wird.