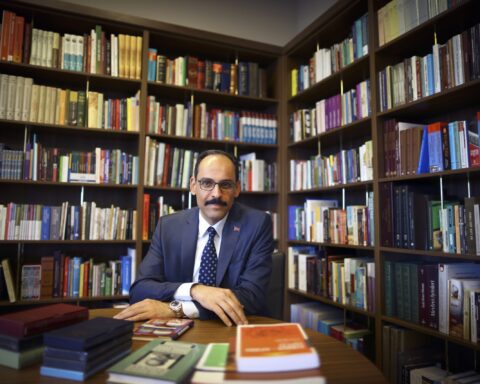Die Einstellung der Menschen zu Besitz und Geld – zum Anhäufen und Horten, zu Verschwendung und Verschwendungssucht – war in allen Epochen der Geschichte sowohl Gegenstand von Kritik als auch von Ermahnungen. Auch in der modernen, kapitalistischen Geldwirtschaft gibt es diese Haltungen, doch der größte Unterschied zu früheren Zeiten ist, dass solche Aussagen in einem nie dagewesenen Ausmaß zugenommen haben, während andere Stimmen angesichts der offenen und versteckten Befehle der herrschenden ideologischen Ordnung – „Du musst konsumieren!“, „Je mehr du konsumierst, desto glücklicher wirst du!“ – verblassen und an Bedeutung verlieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass das allmähliche Verschwinden des Moralischen und Tugendhaften aus unserem Leben und unserem Sinnhorizont eine der prägenden Grundfiguren der Moderne ist.
Setzen wir unser Gespräch über die Philosophie und Psychologie des Geldes mit dem Thema „Geiz“ fort. Versuchen wir, die heutigen Bedeutungen des Geizes etwas freizulegen.
„Und denjenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, verkünde eine schmerzhafte Strafe! An jenem Tag… ‚Dies ist das Gold und Silber, das ihr gehortet habt; nun kostet die Strafe für das, was ihr angehäuft habt‘, wird gesagt.“ (Sure at-Tauba 34–35) „Diejenigen, die geizig sind mit dem, was Allah ihnen aus Seiner Huld gegeben hat, sollen nicht meinen, es sei gut für sie – im Gegenteil, es ist schlecht für sie. Das, womit sie geizten, wird ihnen am Tag der Auferstehung um den Hals gelegt.“ (Sure Al-Imran 180).
Trotz solcher Warnungen war Geiz und das Horten von Besitz im Laufe der Geschichte eines der bestimmenden und richtungsweisenden Verhaltensmuster vieler Menschen. Unter den Verantwortlichen für die ungerechte Weltordnung steht die Gier nach Geld- und Besitzanhäufung, die Weigerung zu teilen (infak), an erster Stelle. Meiner Meinung nach ist der größte Schwachpunkt von Theorien wie dem Marxismus, die Ungerechtigkeiten rein auf soziologische Klassenstrukturen und Machtformen zurückführen, gerade dieser Reduktionismus. Sie übersehen, dass die Psychologie keine Struktur ist, die sich in Soziologie und Politik auflösen lässt, sondern im Gegenteil eine angeborene Grundlage bildet, die auch diese bestimmt.
Ich denke, viele Menschen sind mit mir einer Meinung, dass das Festhalten an einem Verhalten, das so sehr verurteilt und als Übel für die Menschheit gilt, psychologische Ursachen hat. Leider gibt es jedoch nicht genug Untersuchungen über die psychologischen Grundlagen solcher soziologisch sichtbaren Phänomene. Zur Psychologie des Geizes hat außer Freud kaum jemand Bemerkenswertes beigetragen.
Freud versucht, geiziges Verhalten damit zu erklären, dass die psychologische Entwicklung des Menschen gestört ist, dass er in den frühesten Phasen der Kindheit steckenbleibt und seine Lustmechanismen wie ein zweijähriges Kind betreibt, das Freude daraus zieht, das, was es hat, für sich zu behalten. Er ordnet den Geiz vor allem einer zwanghaften (obsessiven) Persönlichkeitsstruktur zu. Nach Freud, der glaubt, dass unbewusste Wünsche und Triebe im Verhalten des Menschen bestimmender sind als das Bewusstsein oder der Verstand, ist Geiz das Ergebnis ungestillter, in der Kindheit unvollendeter Triebe, die im Erwachsenenalter in anderer Gestalt zu befriedigen versucht werden. Da Laien dies leicht missverstehen können, ist es nicht nötig, hier auf die Details von Freuds Überlegungen einzugehen, wie die in der Kindheit auf bestimmte Objekte gerichteten Investitionen später auf Geld, Edelmetalle und Besitz gelenkt werden. Seine Sicht lässt sich in groben Zügen so umreißen.
Doch diese Perspektive erklärt das Horten nicht wirklich und eröffnet auch keine Möglichkeiten, über die Ungerechtigkeiten in der Welt nachzudenken. Viele wollten Marx’ Soziologie psychologisch stützen oder psychologische Theorien mit marxistischen Elementen ergänzen. Meiner Ansicht nach waren all diese eklektischen Versuche vergeblich und unsinnig. Ich finde, dass das Kapitel über den „Geizigen“ in Georg Simmels Werk Philosophie des Geldes weitaus brauchbarer ist. Schauen wir es uns an.
Geiz – mit der Habgier verwandt
Wenn der Charakter des Geldes als letztes Ziel die Intensität übersteigt, die Ausdruck einer bestimmten ökonomischen Kultur ist, können wir von Geiz und Habgier sprechen. Auch wenn sie nicht identisch sind, haben beide denselben Ursprung und treten mit der modernen Geldwirtschaft viel deutlicher zutage. Das Einzige, was solchen Menschen etwas wert ist, ist, dass sie das, was sie besitzen, stets behalten.
In der Vormoderne äußerten sich Geiz und Habgier vor allem darin, dass das Anhäufen von Gütern zum Endzweck wurde. Da landwirtschaftliche Produkte nicht leicht zu lagern waren, war vor allem der Grundbesitz wichtig. Die Menge an Landbesitz galt als Quelle von Ansehen, dem Land wurde nahezu ein religiöser Wert beigemessen. Land war das Symbol der familiären Einheit und der Abstammung; Land zu verkaufen galt nicht nur als Vergehen gegenüber den Kindern, sondern auch gegenüber den Ahnen.
In der modernen Geldwirtschaft zeigen sich Geiz und Habgier vor allem darin, dass Geld selbst zum Endzweck wird. Da Geld ein universelles Tauschmittel ist, macht die Geldgier alle anderen Ziele zu bloßen Mitteln. Simmel sagt dazu:
„Das Geld begnügt sich nicht damit, neben Weisheit und Kunst, persönlicher Bedeutung und Macht, Schönheit und Liebe ein weiteres Endziel zu sein; soweit es diese Stellung einnimmt, gewinnt es die Kraft, die anderen Ziele auf die Ebene von Mitteln herabzusetzen … Der Geizhals liebt das Geld so, wie man jemanden liebt, den man nur durch seine Existenz kennt und bewundert, ohne dass die Beziehung zu ihm eine konkrete Form von Genuss annimmt.“
Er platziert den Wert des Geldes in seiner inneren Welt auf eine unüberwindbare Distanz und vermeidet es, es zu benutzen. So wird das Geld, das als Potenzial zu allem, einschließlich Macht und Herrschaft, betrachtet wird, selbst zu einer Quelle unbegrenzlicher Lust. Genau hier liegt der Unterschied zwischen Sparsamkeit und Geiz: Der Sparsame kümmert sich nicht um die kleinsten Beträge, die er angespart hat – für ihn zählt, was er mit dem Geld anfangen wird.
„Geiz ist eine Form von Machtstreben, die nicht in Erfahrung und Genuss umgewandelt wird.“
Bei manchen, die in ihrer Jugend den Weg der Herrschaft anstelle des Dienstes an der Menschheit gewählt haben, zeigt sich im Alter dieser Zusammenhang besonders deutlich: Sie werden geizig, als wollten sie ihr Geld mit ins Grab nehmen. Wenn der Reiz von Lebensfreude und Idealen verloren geht, bleibt für Macht und Einfluss nur noch der Besitz von Geld und die Ausübung von Einfluss übrig.
Wenn man über Geld und das Ansammeln ohne Spenden (Infak) nachzudenken beginnt, versteht man besser, warum der Islam und – bis zum Aufkommen des Protestantismus – auch die Kirche Zinsnahme, Wucher und unrechtmäßigen Gewinn so klar und deutlich ablehnten. Ich erkenne, dass wir ohne eine Veränderung des Menschen selbst die Geldwirtschaft niemals überwinden können.
Natürlich dürfen wir den Bezug zur Realität nicht verlieren und müssen im Leben „immer fest auf dem Boden der Wirklichkeit stehen“. In dieser kapitalistischen Geldwirtschaft und Konsumgesellschaft besitzt Geld zweifellos einen enormen Wert und eine enorme Macht. Geld ist die „universelle Ware“, und wir sollten uns dessen bewusst sein. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, auf die Wirklichkeit stets aus dem Fenster unserer Ideale, Träume und der ersehnten Welt zu blicken. Der Mensch ist ein Wesen mit Träumen und Idealen, und diese Seite kann niemals durch das ersetzt werden, was Geld bietet.
Heute haben wir Marx stark kritisiert. Geben wir ihm aber auch die Ehre. Einer derjenigen, der am treffendsten ausdrückt, dass jede Form von Ansammeln und Für-sich-Behalten, die das Entfalten menschlicher Potenziale verhindert, uns von uns selbst entfremdet, ist Marx – der Autor der folgenden Worte:
„Je weniger du isst, trinkst, Bücher kaufst, ins Theater, zum Ball oder in die Kneipe gehst, je weniger du denkst, liebst, Theorien entwickelst, singst, malst, fechtest usw., desto mehr kannst du sparen – und desto größer wird dein Schatz, den weder Motten noch Rost verzehren, dein Kapital. Je weniger du bist, je weniger du dein Leben ausdrückst, desto mehr besitzt du – und desto größer ist dein entfremdetes Leben und die Anhäufung deines entfremdeten Seins.“
(Karl Marx, „Ökonomisch-philosophische Manuskripte“ 1844)