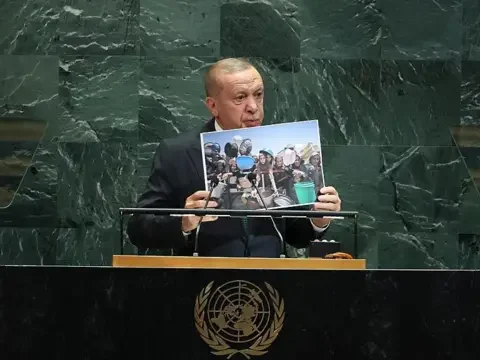Die jüngsten Spannungen zwischen Drusen und sunnitischen Arabern im Süden Syriens am 13. Juli haben sich von einem lokalen Konflikt zu einer umfassenderen Krise ausgeweitet, die eine regionale Stammesmobilisierung auslöste. Um die sunnitischen Araber zu unterstützen, begaben sich bewaffnete Mitglieder zahlreicher Stämme nicht nur aus Syrien, sondern auch aus den Nachbarländern in Richtung As-Suwayda. Dutzende Stammesführer erklärten ihre offene Solidarität mit den sunnitischen Arabern, und trotz der drohenden Intervention Israels führte die Verlegung von zehntausenden bewaffneten Stammesmitgliedern in die Region zu einer bedeutenden Entwicklung, die die ethnischen, konfessionellen und stammesbezogenen Dimensionen des Konflikts vertiefte.
Kann die jüngste Spannung im Süden Syriens zwischen Drusen und sunnitischen Arabern nicht nur als ein lokaler ethnisch-religiöser Konflikt, sondern auch als ein kritischer Indikator zur Verständnis regionaler politischer Tendenzen betrachtet werden? Was bedeutet es, dass die arabischen Stämme Syriens aufgrund dieser Spannungen den Aufruf zur Mobilisierung gegen die Drusen zur Unterstützung der sunnitischen Araber erhoben haben? Und darüber hinaus: Deutet die Unterstützung dieser Haltung durch arabische Stämme in Libanon, Jordanien und dem Golf darauf hin, dass sich die arabische Solidarität über den lokalen Konflikt hinaus auf einer ethnisch-nationalistischen Linie neu formiert?
Dieser Artikel zielt darauf ab, die starke Reaktion der arabischen Gesellschaften auf die Spannungen zwischen Drusen und sunnitischen Arabern im Süden Syriens zu analysieren – trotz der vergleichsweise stillen Haltung gegenüber Israels systematischen Angriffen mit genocidaler Dimension auf die Palästinenser – und auf einen bedeutenden Bruch in der regionalen Politik hinzuweisen. Im Fokus steht dabei die Beobachtung, dass das seit langem mobilisierende Prinzip der „islamischen Solidarität“ im Nahen Osten und in der islamischen Welt an Boden verliert, während eine neue Welle von „Nationalismus“ auf ethnischer, konfessioneller und regionaler Identitätsbasis wieder an Stärke gewinnt. Die drusisch-sunnitischen Spannungen im Süden Syriens werden als eines der letzten und eindrucksvollsten Beispiele für diese Transformation betrachtet und werfen Licht auf die sich wandelnde Natur der identitätsbasierten politischen Mobilisierung.
Ideologien massenhafter politischer Aktivierung im Nahen Osten
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Region Naher Osten von einer starken Welle erfasst, die den ideologischen Boden für massenhafte politische Mobilisierung bildete: der sozialistische arabische Nationalismus. Diese Ideologie entwickelte sich besonders in den 1950er und 1960er Jahren zur vorherrschenden geistigen Strömung, die die politische Orientierung der arabischen Welt prägte. Unter der Führung des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser schuf diese Ideologie nicht nur eine antiimperialistische Widerstandslinie, sondern verkörperte auch eine politische Vision, die auf sozialer Gerechtigkeit, Unabhängigkeit und Einheit zwischen den arabischen Völkern beruhte. Der um Nassers charismatische Führung gruppierte „sozialistische Nationalismus“ verfolgte das Ziel, das Selbstbestimmungsrecht der arabischen Nation gegen westliche Einmischung zu verteidigen und die regionale Solidarität unter dem Namen „Arabische Liga“ zu institutionalisieren.
Der Arabisch-Israelische Krieg von 1967 war nicht nur eine militärische Niederlage, sondern auch ein Wendepunkt, der das Vertrauen in die sozialistische arabische Nationalismusideologie tief erschütterte. Die schwere Niederlage der arabischen Armeen gegen Israel schwächte das Vertrauen in den von Gamal Abdel Nasser geführten sozialistischen Nationalismus erheblich. Mit Nassers Tod im Jahr 1970 verschwand auch die ideologische Führung, was den Einfluss des arabischen Nationalismus auf die regionale Politik weiter abschwächte.
Ab den 1970er Jahren führten neue gesellschaftliche und politische Dynamiken in der arabischen Welt zur Entstehung einer anderen ideologischen Grundlage, die die entstandene Lücke füllte: der Islamismus. Besonders durch den Anstieg des ölbedingten Reichtums in den Golfstaaten gewannen sowohl der ideologische Export konservativer status-quo-orientierter Regime wie Saudi-Arabien als auch der revolutionäre schiitische Islamismus nach der iranischen Islamischen Revolution an Bedeutung und wurden zu zwei Hauptströmungen, die die politische Rhetorik und massenhafte Mobilisierung in der Region prägten.
In dieser Zeit erreichten islamistische Ideologien eine Mobilisierungskraft, die der des arabischen Nationalismus überlegen war. Sowohl der wahhabitisch-panislamistische Diskurs Saudi-Arabiens als auch der revolutionäre, antiimperialistische schiitische Islamismus Irans stellten das Konzept der „Umma“ in den Mittelpunkt und förderten die „islamische Solidarität“. Dies wurde besonders in den 1980er und 1990er Jahren zur Referenz vieler politischer Bewegungen und bewaffneter Widerstandsgruppen von Afghanistan über Libanon bis Sudan und Palästina.
So wurde der Islamismus zur Hauptquelle der ideologischen Mobilisierung in einer Zeit, in der der arabische Nationalismus an Einfluss verlor, und erlangte Legitimität als Träger von Forderungen nach Gerechtigkeit, Widerstand und Freiheit. Die palästinensische Frage blieb sowohl für den sozialistischen arabischen Nationalismus als auch für den Islamismus ein gemeinsames Symbol und eine zentrale Quelle der Mobilisierung. Die palästinensische Sache wurde bis in die 2020er Jahre hinein als Symbol des Widerstands gegen Imperialismus in der arabischen Welt und des Umma-Bewusstseins in der islamischen Welt betrachtet und löste die breitesten und wirksamsten gesellschaftlichen Mobilisierungen in der Region aus.
Was bedeutet das Schweigen der arabischen Öffentlichkeit nach dem 7. Oktober?
Seit Beginn der 2020er Jahre haben wir einen Prozess miterlebt, in dem einerseits Israels systematische Gewaltpolitik gegen die palästinensischen Gebiete zugenommen hat, andererseits die Priorität der palästinensischen Sache in der arabischen Welt abgenommen hat. Die Schritte einiger arabischer Regime zur Normalisierung der Beziehungen mit Israel sowie die wachsende Abkapselung mancher arabischer Gesellschaften aufgrund regionaler Instabilität und innerer Probleme gehören zu den Haupttriebkräften dieser Veränderung. Zudem haben die gescheiterten Erfahrungen des Arabischen Frühlings und die regionalen Polarisierungen die ideologische und politische Legitimität der palästinensischen Sache, die lange Zeit um den Diskurs der islamischen Solidarität zentriert war, in der arabischen Welt geschwächt. In diesem Kontext wurde die palästinensische Frage sowohl auf der politischen Agenda der arabischen Regime als auch im kollektiven Bewusstsein der arabischen Völker zunehmend in den Hintergrund gedrängt.
Die Palästina-Frage hat bei den arabischen politischen Eliten und Gesellschaften weitgehend an Priorität verloren. Das deutlichste Anzeichen dafür ist die schwache und zerstreute Reaktion in der arabischen Welt auf die nach dem 7. Oktober von Israel vor allem im Gazastreifen und generell auf dem gesamten palästinensischen Gebiet begangenen Völkermordverbrechen. Dass ein Großteil der arabischen Bevölkerung angesichts dieses seit fast zwei Jahren vor aller Welt sichtbaren bislang größten Völkermordes in der Menschheitsgeschichte relativ still blieb, zeigt nicht nur den Verlust der einst zentralen Stellung der Palästina-Frage in der arabischen Welt an, sondern macht auch die bemerkenswerte Schwächung der massenhaften Aktivierung auf der Basis „islamischer Solidarität“ sichtbar.
Zeigt die Mobilisierung der arabischen Stämme einen bedeutsamen Bruch in der regionalen Politik?
Zunächst ist festzuhalten, dass die Palästina-Frage, obwohl sie als gemeinsame Angelegenheit der arabischen Welt gilt, im Wesentlichen ein Problem ist, das durch den Akzent auf „islamische Solidarität“ geprägt wurde. Die religiöse und symbolische Bedeutung Palästinas und Jerusalems für die islamische Welt verleiht diesem Thema eine besondere Stellung auf der regionalpolitischen Agenda. Insbesondere seit den 1980er Jahren, als der Einfluss säkularer arabischer Kräfte in der palästinensischen Politik zurückging und islamistische Bewegungen an Bedeutung gewannen, wurde die Wahrnehmung der Palästina-Frage als ein auf islamischer Solidarität basierendes Anliegen gestärkt. Diese Transformation trug dazu bei, dass die palästinensische Sache zu einem zentralen Referenzpunkt islamischer Identität in politischen und gesellschaftlichen Mobilisierungen in der Region wurde.
Die jüngste hohe Mobilisierung arabischer Stämme im Zuge der Spannungen zwischen Drusen und sunnitischen Arabern im Süden Syriens, betrachtet im Kontext der relativen Gleichgültigkeit der arabischen Welt gegenüber der Palästina-Frage, kann als ein bedeutsamer und eindrucksvoller Bruch in der regionalen Politik gewertet werden. Obwohl die Palästinenser ethnisch ebenfalls der arabischen Identität angehören, wurde gegen die systematische Gewalt- und Völkermordpolitik Israels keine vergleichbare stammesbasierte Massenmobilisierung beobachtet.
Diese Entwicklung zeigt, dass das lange dominierende Narrativ der „islamischen Solidarität“ zunehmend an Boden verliert und stattdessen ethnische und konfessionelle Identitäten bestimmend werden. Die Stammesmobilisierung im Drusen-Araber-Konflikt ist insofern bemerkenswert, als die Stämme entsprechend ihrer konfessionellen und ethnischen Zugehörigkeiten Position beziehen und handeln. Dies weist darauf hin, dass demographische Nähe, lokale Konkurrenzdynamiken und historische Feindschaften eine stärkere Mobilisierungsbasis bieten als globale oder umma-basierte Anliegen.
Die zentrale Frage lautet daher: Warum erfolgte eine so schnelle und umfassende Mobilisierung für den Konflikt mit den Drusen, nicht aber für Palästina? Die Antwort muss in der Transformation der Identitätspolitik in der Region gesucht werden. Während die Palästina-Frage zunehmend „abgenutzt“ und instrumentalisiert erscheint, bieten lokalere und historisch direkter wahrgenommene Konflikte wie die mit den Drusen Felder, in denen sich stammesbasierte ethnisch-nationalistische Reflexe leichter identifizieren lassen. So wird aus dem Diskurs der „islamischen Solidarität“ zunehmend eine neue politische Phase, in der stammeszentrierte ethnisch-nationalistische Impulse dominieren.
Die Schwächung der islamischen Solidarität als Mobilisierungsbasis ist auch auf die Schwierigkeiten islamistischer Bewegungen zurückzuführen, die Erwartungen der Bevölkerung im Zuge des Arabischen Frühlings zu erfüllen. Obwohl die Straßenproteste Anfang der 2010er Jahre nicht direkt von Islamisten initiiert wurden, wurde die Muslimbruderschaft, die am besten organisierte soziale Struktur der Region, später zu einer der Hauptakteure dieser Aufstände. Dennoch hat die Region trotz anderthalb Jahrzehnten weiterhin politische Instabilität, wirtschaftliche Probleme, gesellschaftliche Zerstörung und zahlreiche Opfer erlebt, was sowohl die Legitimität der Proteste als auch das Ansehen der islamistisch geführten Bewegungen als Träger islamischer Transformation erheblich untergraben hat.
Der jüngste Konflikt zwischen Drusen und arabischen Stämmen im Süden Syriens sollte nicht nur als lokales Sicherheitsproblem, sondern als klarer Ausdruck des Wandels in der auf Identitäten basierenden politischen Mobilisierung in der regionalen Politik verstanden werden. Diese Krise zeigt, dass der lange dominierende Diskurs der „islamischen Solidarität“ zunehmend von „ethno-nationalistischen“ Reflexen abgelöst wird. Die breit angelegte stammesbezogene Mobilisierung in einem auf den ersten Blick begrenzten und lokalen Konflikt wie dem zwischen Drusen und sunnitischen Arabern verdeutlicht diesen Wandel.
Für ein besseres Verständnis der neuen Identitätspolitik in der Region ist es daher essenziell, sowohl den ideologischen Niedergang des Islamismus als auch die Wiedergeburt des arabischen Nationalismus in neuen Formen genau zu analysieren. Diese Transformation wird nicht nur für Syrien, sondern auch für den Libanon, Jordanien und vor allem die Golfstaaten wegweisend für die zukünftige politische Dynamik in der gesamten arabischen Welt sein.
Nach den 12 Tagen der Kämpfe zwischen Iran und Israel wurden bei den Trauermärschen im Monat Muharram patriotische Konzepte so stark betont, dass sie den schiitischen Glauben übertrafen. Die ständigen Appelle des syrischen Präsidenten Ahmed Al-Shara zur Verteidigung der Heimat verdeutlichen die zunehmende Verdrängung des universellen Prinzips der islamischen Solidarität durch nationale und patriotische Narrative. Diese Entwicklung ist ein auffälliges Beispiel dafür, wie religiöse und konfessionelle Aufrufe zur Einheit im Kontext regionaler Sicherheitskrisen zunehmend von nationalistischen Diskursen verdrängt werden.