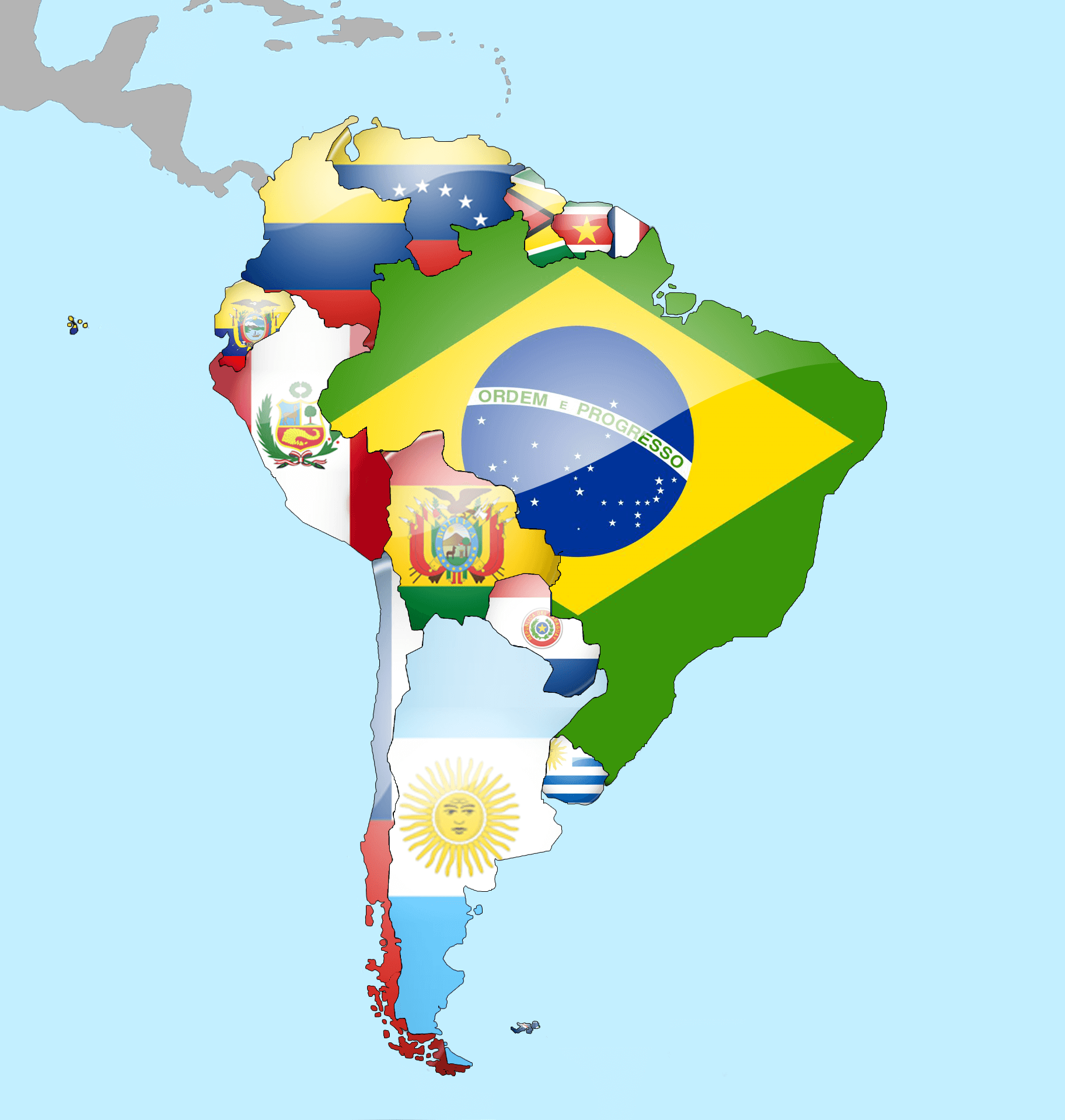Ein marktorientiertes Modell und wachsende Ungleichheit führten zum Aufstieg der Rechten. Diese Situation erfordert eine neue regionale Solidarität.
Der Zweite Weltkrieg endete mit der Gründung des multilateralen Systems der Vereinten Nationen und einem Koexistenzabkommen, das Staat, Markt und Demokratie als Arenen politischer Auseinandersetzungen zusammenführte. In Lateinamerika spiegelte sich dies im Modell der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC) wider, das Protektionismus förderte und soziale Probleme durch fiskalische Maßnahmen adressierte.
Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts jedoch zwangen dieselben Nachkriegsorganisationen ein neues, marktorientiertes Modell auf. Wert wurde vom Preis verdrängt, Freihandel erhielt Priorität, und soziale Fragen wurden den Marktgesetzen unterworfen. Die Konzentration des Kapitals und die Erschütterung der Legitimität der Demokratie brachen den früheren Konsens. Obwohl progressive Regierungen aufkamen, konnten sie den Aufstieg einer neuen autoritären Rechten mit Unterstützung faktischer Machtzentren wie Medien, Kirche, Militär und Technokratie nicht verhindern. Die Repräsentationskrise, die die politischen Parteien von ihren Basis entfremdete, öffnete den „Anti-Politiker*innen“ eine Plattform in den Mainstream-Medien.
Unterdessen verschlechterte sich das soziale Bild. Die bereits strukturelle Ungleichheit vertiefte sich nach 2016 weiter und explodierte während der Pandemie; Ende 2020 lebten 209 Millionen Lateinamerikaner*innen unterhalb der Armutsgrenze. Diese Ungleichheit untergräbt die Legitimität der Demokratie. Gleichzeitig konzentrierten sich progressive Regierungen eher auf die Verringerung von Diskriminierung basierend auf Geschlecht, Rasse oder Beruf als auf Klassenbezogene Ausgrenzung.
Dieser Kampf wurde von der Rechten attackiert, die die Minderheitenverteidigung der Progressiven als „Wokeismus“ brandmarkte und die Gesellschaft der Spaltung bezichtigte. Tatsächlich ist dies eine Verpflichtung zu kollektiver Solidarität. Ungleichheit und Diskriminierung schließen einander nicht aus; vielmehr ergänzen sie sich.
Diese weitreichenden ideologischen Veränderungen führten in den USA, Costa Rica, Panama, Ecuador, Argentinien und Paraguay zur Rückkehr der Rechten; dies ist erklärbar durch Radikalisierung politischer Projekte, Polarisierung in sozialen Netzwerken, „Lawfare“ (juristische Kampfführung), anhaltende Ungleichheit und Behauptungen über Wahlbetrug.
Mediale Botschaften und das Entstehen digitaler Silos verschärften die Polarisierung aufs Äußerste. Politische Botschaften werden mittels KI segmentiert, zugeschnitten auf die Ängste der Wähler*innen. Soziale Medien bombardieren uns emotional und ersetzen Diskussionen über reale Alternativen durch ideologische Konflikte. Diese digitalen Blasen erzeugten virtuelle Führungspersönlichkeiten, die den Medienkonglomeraten der neuen Rechten dienen.
Neben der digitalen Invasion findet auch eine Juridifizierung der Politik statt. Staatsanwälte und Richter behandeln Konflikte, die demokratisch gelöst werden sollten, ohne Verfahren und Unschuldsvermutung. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wurde im Wahlprozess 2018 juristisch ausgebootet, in dem Bolsonaro gewann; Bolsonaro wird heute wegen des Versuchs untersucht, Lulas Amtseinführung 2023 zu verhindern. In Kolumbien sieht sich Präsident Gustavo Petro „weichen Putsch“-Versuchen ausgesetzt, die seine Macht schwächen.
Mit der Wahl von Trump 2.0 fand die globale extreme Rechte in Florida und der Region ein Echo und erhielt Unterstützung von politischen Führern in den USA, El Salvador und Argentinien. Am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit sagte Trump: „Lateinamerika brauchen wir nicht“ und verschärfte die Anti-Lateinamerika-Politik mit Maßnahmen gegen Migranten, Einstellung von Hilfsprogrammen über USAID, verschärften Sanktionen gegen Kuba und Venezuela sowie unbegründeten territorialen Ansprüchen auf den Golf von Mexiko und den Panamakanal. All dies deutet auf die Rückkehr von „Onkel Sam“ aus den 1950ern und der Operation Condor der 1970er und 80er Jahre hin.
Angesichts dieser Bedrohung ist es notwendig, ein neues solidarisches Entwicklungsmodell aufzubauen, das Wachstum, Inklusivität und Demokratie vereint; hierzu können breite Fronten wie die Morena-Partei in Mexiko oder die Führung Yamandú Orsis in Uruguay gebildet werden. Lateinamerika sollte sich regional neu integrieren und ein aktiver Teil des Globalen Südens werden: „réspice similia“ (schau auf deine Nachbarn).
Die trumpistische Rechte fördert Deglobalisierung, zieht sich aus der Weltgesundheitsorganisation zurück, leugnet die Klimakrise und attackiert die internationale Justiz. Das nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Modell des Zusammenlebens steht zwar unter Krise, sollte aber nicht durch ein anderes hegemoniales Modell ersetzt werden, sondern durch den Aufbau einer neuen globalen Ordnung gestärkt werden, die sich um die Prinzipien sozialer Harmonie, Koexistenz und kollektiven wirtschaftlichen Fortschritts konsolidiert — wie es China vertritt.
In diesem neuen Szenario sollte Lateinamerika sich der Welt gegenüber integriert und mit einer Stimme präsentieren. Die Region braucht keine Internierungslager für Migranten, um zu verstehen, dass sie sich auf einen faschistischen Abgrund zubewegt; das einzige Gegenmittel ist, wie immer, der Fortschritt.
*Ernesto Samper Pizano war von 1994 bis 1998 Präsident Kolumbiens.
Quelle: https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jul/09/latin-america-shifting-right